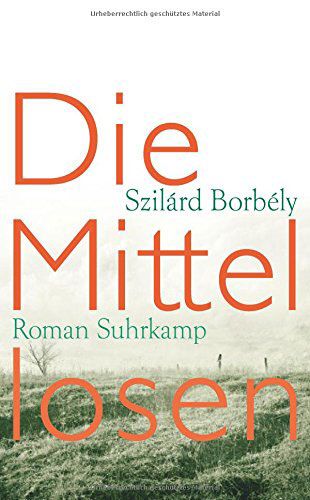Jetzt stehe ich wieder da wie damals vor dem Geschäft, schaue an mir hinunter und sehe meine neuen Schuhe, braune Lederschuhe, ich sehe auch die Ösen und Schuhbänder, warme Winterschuhe sind es, wir nennen sie "Pelzschuhe", weil sie gefüttert sind, und ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder meine Angst hinunterschlucken soll.
Neue Schuhe habe ich bekommen, der Winter kann kommen, ich werde nicht frieren an den Füßen oder nass werden, aber die Schuhe sind zu groß, Mutter musste mir größere kaufen, damit sie auch im nächsten Winter noch passen, sie kann nicht jeden Winter neue Schuhe kaufen.
Es tut weh, mich so dastehen zu sehen mit meiner Angst, dass sie es in der Schule bemerken, dass meine Schuhe zu groß sind, und mich wieder auslachen, nicht ohne Grund habe ich mich all die Jahrzehnte nicht daran erinnert; erst der Roman Die Mittellosen von Szilárd Borbély hat mich wieder meine Schuhe sehen und dastehen lassen wie damals.
Ein Film hätte das nicht vermocht, da hätten die Schuhe eine andere Farbe gehabt und eine andere Form, ich wäre hängengeblieben an den Schuhen der Filmfigur, aber in das Buch habe ich mei- ne eigenen hineinsehen können. Manchmal braucht es eben doch ein Buch, damit ich weiß, wer ich war und bin.
Auch die Stelle vor der Brücke sehe ich wieder, wo Mutter und ich abgebogen sind in den Wald, um Holz zu sammeln für den Winter; und wie die Mutter des Romans musste auch meine im Dorf immer ein Kopftuch tragen, obwohl sie es hasste. "Wir gehen und schweigen. Dreiundzwanzig Jahre trennen uns. Die Dreiundzwanzig kann man nicht teilen. Die Dreiundzwanzig ist nur durch sich selbst teilbar. Und durch eins. So ist die Einsamkeit zwischen uns. Man kann sie nicht in Teile zerlegen. Man schleppt sie als Ganzes mit sich."
Mich trennten von meiner Mutter 43 Jahre. Auch die 43 ist nur durch sich selbst teilbar und durch eins, doch daran dachte ich nicht, ich entwickelte nicht solche Rechenspiele als Überlebensstrategien wie der Bub im Roman, ich füllte meine Einsamkeit mit anderen Fantasien auf, und sie war auch nicht so absolut wie die seine. Doch der entscheidende Unterschied ist: Ich wurde nicht verprügelt und musste nie hungern.
Vieles war bei mir anders als beim Kind des Romans, beim Lesen überkommt mich die Dankbarkeit, dass ich als Kind ein eigenes Bett hatte, und ich denke nach, ob das für alle meine Klassenkameraden in der Volksschule zu Beginn der 1960er-Jahre zutraf, und bin mir der Antwort nicht sicher. Auch hatte ich keine Geschwister und keinen Vater, und Borbélys Roman hat mir die Augen dafür geöffnet, wie viele Schmerzen mir diese Wunde vielleicht erspart hat. "Mein Vater schnarcht und stinkt", konstatiert der Bub beiläufig. Der Vater verprügelt seine Frau wie die Kinder.
Der Bub flieht in die Fantasie: "Ich stelle mir vor, mein Vater ist tot. Das beruhigt mich." Ich hab mir nur gewünscht, dass mein Vater da wäre, mein Fahrrad repariert und mir eine Schaukel baut.
Szilárd Borbély ist in einem kleinen Dorf im nordöstlichen Winkel Ungarns aufgewachsen, im Dreiländereck mit Rumänien und der Ukraine, und er war sieben Jahre jünger als ich.
Der Erzähler des Romans ist nicht einfach ein Alter Ego des Autors, denn der Roman ist nicht eins zu eins autobiografisch; dennoch ist das Buch eine Sonde in ein reales Milieu und Spiegel einer tatsächlich erlebten Kindheit. Dass sie anders war als meine eigene, liegt auch am unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen System.
Im Roman ist besondere Vorsicht geboten vor den neuen Herren im Dorf, den Parteileuten. Sie haben das Sagen und normieren die Sprache, doch kaum hören sie nicht zu, sprechen die Leute ganz anders. Unverhohlen treten die Sympathien für das alte System, für den "Reichsverweser" Miklós Horthy, ja sogar für die Pfeilkreuzler, die ungarischen Nationalsozialisten, zutage.
So wird diese Dorfwelt auch zu einem Schlüssel für die triste gesellschaftliche und politische Situation im heutigen Ungarn. Bis 1989 hat es dort nie eine Demokratie gegeben, keine freie Rede, nur genormte Sprachmasken, hinter denen man sich verschanzt hat.
In meinem Dorf kam es vor allem darauf an, wer wie viel Grund und wie viele Kühe hatte; am mächtigsten war der Sägewerksbesitzer, dann kamen die Eigentümer der Gasthäuser und Geschäfte. Keine gute Basis für ein Häusler-Kind, aber mit mehr Chancen, seiner Herkunft zu entkommen.
Doch trotz aller Unterschiede bringt mir dieses Buch mehr von meiner Kindheit zurück als andere, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Das liegt auch an der bruchlosen Verzahnung von unmittelbarer Gegenwart des Erlebten (im Präsens erzählt) und späterer Reflexion. Indem der Erzähler darauf hinweist, wie Dinge im Dorf bezeichnet werden (in der Übersetzung großartig nacherfunden!), generiert er Authentizität bei gleichzeitiger Markierung seiner Distanz.
Das Ineinander von subtiler Distanzierung und harter Unmittelbarkeit ist das Konstruktionsprinzip des Romans. Szilárd Borbély hat das ostungarische Dorf der 1960er-Jahre auf die Romanbühne gehoben wie seinerzeit Franz Innerhofer die Dorfwelt des Salzburger Landes, doch durch seine Erfahrungen als Lyriker und als Literaturwissenschafter, der mit der Ästhetik des 18. Jahrhunderts vertraut war, ist er mit dem autobiografischen Stoff viel raffinierter umgegangen.
Borbély selbst sprach von diesem Buch als einer "biografisch grundierten, das heißt eingeschränkten Fiktion". Das Fiktive an diesem Roman mindert jedoch keineswegs die Wucht des Erlebten, ganz im Gegenteil, es steigert sie. Die kurzen, schmucklosen Sätze, die Genauigkeit der Details, sie rücken mir diese Welt so erschreckend nahe. Dabei wird mir klar, dass Borbélys ostungarisches Dorf und mein Bergdorf im Salzburger Tennengau in den 1960er-Jahren trotz der unterschiedlichen politischen Systeme mehr miteinander gemeinsam hatten als sein Dorf mit Budapest oder meines mit Wien.
Dass ich, seit es mich in die Hauptstadt verschlagen hat, so gerne entlegene mittelosteuropäische Landschaften aufsuche, hängt vielleicht auch damit zusammen – in der Fremde sind die Spuren des Eigenen oft leichter zu finden, zumindest solange man sich vom Eigenen abstoßen und distanzieren muss; um mein Dorf habe ich bis vor einigen Jahren einen weiten Bogen gemacht.
Weil Szilárd Borbélys Romandebüt nach seinem frühen Tod vor dem Erscheinen der deutschen Übersetzung zu seinem Vermächtnis geworden ist, enthält das Buch auch zwei Essays des Autors, die den Roman und seine Entstehung reflektieren. Darin bezeichnet sich Borbély mit einem genauen Blick auf Details von Sprache und Lebenswelt als "kultureller Migrant, der die verräterischen Spuren vertuschen muss, die in seine Vergangenheit führen".
Das war mir sofort plausibel als Formulierung für das, was auch mit mir geschehen ist; und vielleicht mit manchen anderen, die wie ich gerne so tun, als seien sie schon im urbanen Intellektuellenmilieu auf die Welt gekommen. Die Sprache, die ich heute spreche, hat mit der meiner Kindheit kaum etwas zu tun; um anzukommen in der neuen Sprache, musste ich den Kindheitsdialekt vergessen, und jetzt, wo ich dabei bin, ihn wiederzufinden, ist kaum jemand geblieben, der ihn noch spricht. So bleibt nur die Erinnerung. Und wie Borbély konstatiert: "Auch die Erinnerung ist Fiktion."
In diese Erinnerung hat mir Borbélys Roman Die Mittellosen hineingeholfen; und mir, dem Mi- lieu-Migranten, meine Nähe zu den Länder-Migranten ausgeleuchtet.
Vielleicht öffnet er nicht nur mir die Schleusen, meine Migrationsgeschichte zu erzählen. Wenn mehr solcher Geschichten erzählt werden, müssen vielleicht weniger Menschen ihr halbes Leben verstecken. Und Borbélys Roman ist als Kunstwerk groß und vielschichtig genug, dass man sich nicht schämen muss, hinter ihm zurückzubleiben. Es hat schon sein Gutes, dass ich mich wieder so dastehen sehe mit meinen braunen Pelzschuhen, die mir zu groß sind. (Cornelius Hell, Album, 12.9.2015)