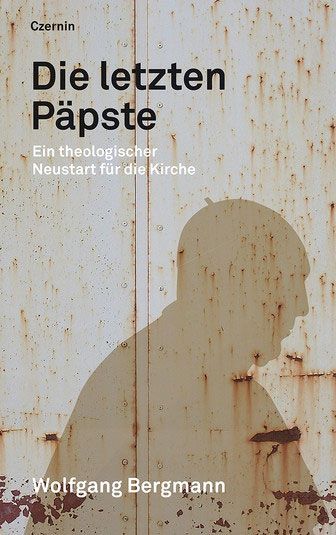Die Diskussion um das Ehesakrament, genauer gesagt die absolute Unauflöslichkeit des sakramentalen Ehebandes, das in dieser Form in gewisser Weise ein Sondergut der katholischen Kirche darstellt, ist nun an der Spitze der katholischen Hierarchie angekommen. Bislang wurde die Diskussion dazu niedergehalten; Papst Franziskus hat sie ausdrücklich zugelassen.
Zentraler Punkt des katholischen Verständnisses ist jene Erzählung in den Evangelien, in der Jesus zur Ehescheidung befragt wird. Er erläutert, dass die Praxis der Entlassung aus der Ehe, die Mose legitimierte, nur auf die Hartherzigkeit der Menschen zurückgehe. Im Anfang sei es nicht so gewesen. Mit der Berufung auf das Buch Genesis (" ... sie werden ein Fleisch") fügte er hinzu: "Was aber Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen."
Dies hat die katholische Kirche normativ genommen, obwohl schon in der ersten Generation der Christen diese Aussage durch Paulus relativiert wurde. Er ermöglichte die Scheidung, wenn ein Partner Christ wurde und der andere dies nicht unterstützen wollte. Ausdrücklich berief er sich dabei nicht auf Jesus, sondern auf seine eigene Autorität. Diesen Widerspruch versucht die Kirche durch die Konstruktion der sakramentalen Ehe zu überwinden. Nur die unter Christen geschlossenen und vollzogenen Ehen seien nicht auflösbar, die anderen schon.
Jesus kannte kein Ehesakrament
In der Entwicklungsgeschichte der katholischen Ehe fällt auf, dass die Ehe in langen geschichtlichen Phasen mehr ein öffentliches Ordnungsprinzip darstellte, als dass sie ein Recht des Menschen war, Lebensbeziehungen einzugehen. Die Kirche trat nicht dagegen auf, als die Ehe vom Adel als politisches Instrument eingesetzt wurde, indem Kinder miteinander verheiratet wurden – aus heutiger Sicht nichtige, sittenwidrige Verträge. Auch trat sie nicht für die niedrigen Stände ein, denen eine Eheschließung aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund mangelnder Zustimmung der Herrschaft versagt blieb. Weiters nahm sie in Kauf, dass der Schutz der Institution der Ehe negative gesellschaftliche Auswirkungen hatte, insbesondere auf die soziale und rechtliche Schlechterstellung von unehelichen Kindern. Es war nicht nur ein Inkaufnehmen, es gab auch eine aktive Diskriminierung. So war die uneheliche Geburt bis zum CIC von 1983 ein Weihehindernis. Für die Priesterweihe bedurfte es einer Dispens, die nicht selbstverständlich gewährt wurde. Ein christlicher Irrweg.
Was bei dem Konstrukt der unauflöslichen sakramentalen Ehe übersehen wird: Jesus hatte ja nicht zu getauften Christen gesprochen, die es damals noch gar nicht gab, sondern zu den Juden. Sein Ideal, die Ehe nicht aufzulösen, bezog sich daher auf die Ehepraxis seiner Zeit, also aus heutiger Sicht auf "nichtsakramentale" Ehen. Solche Ehen werden heute aber, weit über die Ausnahme des Paulus hinaus, als auflösbar gehandhabt. Es stellt kein unüberwindliches Hindernis dar, wenn jemand, der schon staatlich verheiratet war und auch Kinder aus dieser Beziehung hat, eine andere Person kirchlich heiraten möchte.
Auch wird übersehen, dass Jesus in seiner Aussage erklärte, dass man Ehen nicht auflösen soll bzw. darf, nicht wie im jetzigen katholischen Verständnis, dass man sie gar nicht auflösen kann, weil eben durch das Sakrament ein unauflösbares Band entstanden sei.
Diese spätere ontologische Interpretation ist nicht biblisch fundiert. Dieses ontologische Verständnis vom Eheband bedeutet nämlich, dass auch dort, wo Partner sich in völligem Einvernehmen trennen, ohne dass ein "Verlierer" zurückbleibt, eine Scheidung unmöglich ist.
Die Kirche kennt jedoch die sogenannte Annullierung einer Ehe. Diese stellt keine Scheidung im eigentlichen Sinn dar, sondern die Feststellung, dass eine gültige Ehe gar nicht zustande gekommen ist. Hier kommt wieder das römische Rechtsverständnis ins Spiel, das versucht, die Komplexität von Beziehungen auf einzelne Rechtsaspekte zu reduzieren. Das Unbefriedigende dabei ist, dass "Ehen", die jahrelang bestanden, aus der vielleicht sogar Kinder hervorgegangen sind, schlicht als nichtig gelten können, als sei da nichts gewesen. Hier wäre vielfach eine Scheidung eine Lösung, die nicht versucht, die Vergangenheit auszulöschen. Zudem kennt das Kirchenrecht die sogenannte Trennung von Tisch und Bett. Es wird also anerkannt, dass es Lebenssituationen geben kann, die ein weiteres Zusammenleben unmöglich machen. In der Praxis also durchaus das, was man bei der Frage an Jesus als Entlassung aus der Ehe bezeichnet hat. Die katholische Problemstellung ergibt sich ja nicht, wie weit verbreitet irrtümlich angenommen wird, schon aus der staatlichen Scheidung. Das Problem ist, dass beim katholischen Trennungsverständnis ausgeschlossen bleibt, eine neue Partnerschaft einzugehen. Hier wird das unauflösbare Eheband in der Praxis nur zu einem Hindernis für einen Neubeginn, ohne dass die bisherige Ehe praktisch erhalten bleibt.
Die Kirche hat ihre Unbeweglichkeit bisher mit dem strikten Herrenwort begründet, von dem sie meint, nicht abweichen zu können. So strikt war die Aussage gar nicht. Jesus nennt die Ausnahme der Unzucht. Die Regel gilt damit nicht bedingungslos.
Ebenso ist hier zu berücksichtigen: Die gesamte Ehelehre an einem einzelnen Zitat aufzuhängen hat fundamentalistische Züge. Die Botschaft Jesu rund um die Gebote kennt einen wichtigen Grundsatz: Der Sabbat ist für den Menschen da. Nicht umgekehrt. Daher kann es auch Ausnahmen zu den strengen Sabbatgeboten geben, z. B. wenn diese Ausnahmen zur Heilung eines Menschen beitragen. Dieser Grundsatz kann im Kontext der Ehe nicht ignoriert werden.
Johannes Paul II. empfiehlt Patchwork
Da der Umgang mit der Institution Ehe immer sehr freizügig vom Trennungsverbot abgewichen ist, steht einer Neuorientierung, z. B. an der Praxis der Ostkirche, nichts im Wege.
Macht es die Sache einfacher? Nicht unbedingt. Die eigentliche Unauflöslichkeit einer Ehe – jeder Ehe, nicht nur der katholischen – besteht darin, dass Menschen in besonderer Weise eine Beziehung eingegangen sind, die das Leben des anderen und das eigene geprägt hat, aus der Verpflichtungen entstanden sind, die man nicht ein- fach abstreifen kann. Diese unaufhebbare Geschichte wird einen begleiten, auch wenn man getrennt ist. Es wird, wenn die Kirche weitere Eheschließungen ermöglicht, zur Gewissensfrage des Einzelnen, ob er in einer Situation ist, in der er "vor Gottes Angesicht", wie es in der liturgischen Eheformel heißt, einen neuen Bund eingehen kann.
Eine bedeutende, aber in der Diskussion kaum wahrgenommene Relativierung des unauflösbaren Ehebundes hatte schon Johannes Paul II. vorgenommen. In seiner Enzyklika Familiaris consortio führte er aus, dass es für geschiedene Wiederverheiratete die sittliche Verpflichtung geben kann, z. B. wegen gemeinsamer Kinder, in der neuen Beziehung zu bleiben. Salopp formuliert war dies das erste Plädoyer für ein Patch-working. Er verlangt dafür aber die sexuelle Enthaltsamkeit des neuen Paares. Ein striktes Unauflöslichkeitsverständnis müsste jedoch auch in solchen Situationen die Bereitschaft zur Rückkehr zum früheren Partner verlangen. Dass Johannes Paul II. den geschiedenen Wiederverheirateten die sexuelle Enthaltsamkeit auferlegt, widerspricht dem seelsorgerlichen Grundsatz des ersten Apostelkonzils, wonach man Menschen keine "Lasten aufbürden" soll. Die frühere Ehe wird durch diese Askese nicht mehr heil. Es greift zu eng, Ehebruch nur sexuell zu interpretieren. Die Ehe ist dadurch gebrochen bzw. zerbrochen, dass das gemeinsame Lebensprojekt beendet wird, mit oder ohne neue sexuelle Beziehung.
Was hier von Johannes Paul II. aber erstmals erkannt und anerkannt wurde, ist der sittliche Wert von gemeinsamen Lebensformen, in denen Menschen Verantwortung füreinander übernehmen, ob verheiratet oder auch nicht. Genau das ist der inhaltliche Kern, aus dem ein neues kirchliches Partnerschafts- und damit Eheverständnis erwachsen kann und wohl auch wird. Ein Blickwinkel, der nicht auf die Sexualität fixiert ist, sondern auf die besondere Beziehung von Menschen zueinander. In diesem Verständnis von Ehe wird man auch für gleichgeschlechtliche Beziehungen in gleicher Weise wie für heterosexuelle Paare den Segen Gottes für das gemeinsame Lebensprojekt erbitten. Nach kirchlichem Verständnis spenden die Eheleute das Sakrament einander. Wer kann hier verbieten oder kontrollieren, wo dies geschieht?
Blutsverwandtschaft zählt nicht
Die Diskussion um die Unauflösbarkeit der Ehe versuchte Papst Franziskus in gewisser Weise aber doch abzubremsen, indem er die Synode unter das weiter gefasste Thema der Familie stellte. Doch dieser Schwenk führt in eine Sackgasse. Das "Evangelium von der Familie" findet sich weder in der Bibel noch in der Geschichte des Christentums. Im Gegenteil: Das Christentum hat die Herrschaft der Sippe relativiert. Geradezu verächtlich distanzierte sich Jesus von Nazareth von seiner Herkunftsfamilie, als diese ihm Grenzen setzen wollte und formulierte: "Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter." Das Christentum versteht sich als eine Gemeinschaft, in der alle durch die Taufe zu Brüdern und Schwestern werden. Blutsverwandtschaft hat hier keine Bedeutung. Das Verlassen der Familie um des Glaubens willen, in diesem Fall auch des Ehepartners, gehört zum Selbstverständnis der Kirche.
Zu beachten ist auch, dass der Begriff der Familie durch die Geschichte einem hochgradigen Wandel unterworfen ist. Die heutige Klein- bzw. Kernfamilie aus Vater, Mutter und Kind(ern) gibt es in dieser Form noch nicht lange. Das alte jüdische Familienverständnis war das einer patriarchalischen Sippe, in der für die Menschen ihre eigene Nachkommenschaft wichtig war. Die rigide Sexualmoral kann dabei unter einem doppelten Aspekt gesehen werden: Zum einen war sie in gewisser Weise eine Sozialgesetzgebung, die Frauen und Kindern Schutz verschaffte – allerdings unter Aufgabe der eigenen Freiheit -, auf der anderen Seite wollte sie verhindern, dass die leibliche Nachkommenschaft der Patriarchen infrage stand. In diesem Konzept war auch die Polygamie für Männer selbstverständlich, wie sie auch vom Stammvater der monotheistischen Religionen, Abraham, erzählt wird. Im alten Israel gibt es eine nur sehr langsame Entwicklung von der Polygamie zur Monogamie. Wie wichtig die eigene Nachkommenschaft war, zeigt auch die Institution der sogenannten Leviratsehe, wo der Bruder eines kinderlos Verstorbenen verpflichtet war, mit dessen Frau ein Kind zu zeugen. Dieses galt dann als Kind des Verstorbenen.
In der jungen Kirche war die Familie die große Hausgemeinschaft, die nicht nur Verwandte umfasste. Die Rolle dieser Großfamilien als Hauskirche wurde sehr rasch durch die priestergeführte Kleruskirche abgelöst. Familien waren bloß Objekt der Seelsorge und nicht Subjekt der Kirche. Den niederen Ständen waren über lange Zeit Familiengründungen praktisch verwehrt oder zumindest von der Zustimmung der Herrschaft abhängig, aus heutiger Sicht ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte. Der idyllische und romantische Familienbegriff bildete sich erst in der Neuzeit.
Gerade weil sich der Familienbegriff im Lauf der Geschichte stark verändert hat, kann die heutige weitverbreitete Patchworkfamilie als lediglich ein weiterer sozialer Wandel verstanden werden. Theologisch stellt sich nicht die Frage, ob sich nur eine Familienform aus der Botschaft Jesu ableiten lässt, sondern in welcher Weise Beziehungen so gelebt werden können, dass sie Ausdruck der göttlichen Liebe sind. Man muss auch fragen: Können alle Ehen, denen die katholische Kirche das Bestehen eines Ehebandes zuschreibt, für sich in Anspruch nehmen, diese göttliche Liebe spürbar zu repräsentieren? (Wolfgang Bergmann, 25.9.2015)