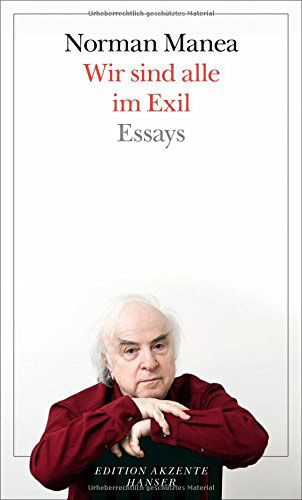Er ist im abgeklärten Alter, in seinen gleichmäßig weisen Erzählungen blitzt höchstens ein wenig Ironie auf. Aber einmal wurde Norman Manea richtig zornig. Das war, als ihn Saul Steinberg bei einem "dîner en ville" in New York fragte: "Gibt es überhaupt noch eine rumänische Literatur?"
Manea, außer sich, konterte giftig: "Wann sind Sie denn aus Rumänien weggegangen?" Dann nannte er die Namen, die ihm recht gaben: Rebreanu, Petrescu, Blecher, Urmuz, den Ionesco als seinen großen Vorläufer beschrieben habe. Steinberg, der exzentrische, durch seine verzerrten Weltkarten im New Yorker berühmte Illustrator, musste kleinlaut beigeben. Später wurden die beiden Exilrumänen Freunde.
Man kann sich fragen: War es für sein Heimatland oder eher für seine Literaten, dass sich der jüdische Emigrant Manea so vehement in die Bresche schlug? Er, der 1941 als fünfjähriger Knirps vom faschistischen Regime in Bukarest im Eisenbahnzug in ein KZ in Transnistrien deportiert worden war, der sich 1986 wegen des Ceausescu-Regimes und der realsozialistischen Zensur voller Bitterkeit nach Westberlin ausgereist war, dort Freundschaft mit dem Briefträger schloss, der schließlich "mit Fragen über das Fremdsein regelrecht gemartert" wurde, wie er sich in seinem neuen Essayband Wir sind alle im Exil erinnert.
Die Frage des Fremdseins, des Exils, ist auch die Frage der Sprache. Manea wuchs mit der rumänischen Sprache auf, spricht aber auch Deutsch, stammt er doch aus der früher österreichischen Bukowina – wie Paul Celan. Dessen Deutsch war aber, so Manea, "von vornherein eine exilierte Sprache, die aus Wien, nicht aus Berlin in die habsburgische Bukowina gelangte".
Anders als sein Landsmann Emil Cioran, der im Pariser Exil auf Französisch wechselte, blieb Manea beim Rumänischen – auch als er 1988 in die USA übersiedelte. Dort lebt er bis heute, und dort befand er, die Sprache sei wie das Schneckenhaus, das die Schnecke überallhin mitnehme.
"Für den Schriftsteller, der nirgends eine Heimat hat, ist Sprache wie eine Plazenta. Für ihn, der im eigenen Land denkbar 'fremd' ist, ist sie nicht nur eine sanfte und herrliche Eroberung, sondern die geistige Legitimation, sein Zuhause." An anderer Stelle bezeichnet er sie gar als "Ort des Überlebens", um fast trotzig anzumerken: "Keiner kann einem die Sprache nehmen."
Bloß gibt es dabei laut Manea ein Problem: Die "Sprache der Innerlichkeit, der gedämpfte Klang der Gedanken" brauche die "äußere Phonetik"; ohne das gesprochene Wort führe das Exil notgedrungen zur "sozialen Entwertung der Muttersprache". Sein Englisch bleibt hingegen nur "eine Mietsprache, die sich ein Robinson Crusoe für gesellschaftlich notwendige Verhandlungen ausgeliehen hat, um sich dem Stamm, der ihn beherbergt, sprachlich anzupassen."
Natürlich gibt es für den Schriftsteller die Möglichkeit von Übersetzungen. Sie ermöglichen ihm die literarische Aufnahme wie ein "Einreisevisum", so Manea. Seine tiefe Identitäts- und Schreibkrise ließ sich dennoch nicht vermeiden. Das Englische sei zumindest in New York temporeicher, einfacher und geradliniger als das "lateinisch-orientalische Gemisch" des Rumänischen, musste er feststellen.
Mehrmals habe er sich dabei ertappt, wie er seinen Stil vereinfacht habe, um die Übersetzung in die Sprache seines Wohnortes überhaupt zu ermöglichen. Er schrieb "nicht wie früher für einen virtuellen Leser (dessen Bild im Exil noch virtueller, noch vager wird) und auch nicht, wie sonst, für mich selbst, sondern für den Übersetzer".
Richtig, für den Übersetzer! Auf der Strecke blieb indessen die Komplexität, es mangelte an Ironie, Geheimnis, Mehrdeutigkeit, Stil, wie Manea merkte. "Ich hatte Mühe, diese Krise zu überwinden, und ich weiß nicht, wie weit es mir gelungen ist." Auf jeden Fall habe es lange gedauert, "ehe ich den Mut hatte, mich wieder in erzählender Prosa zu versuchen".
Der letzte Versuch ist gelungen. Maneas neue Essaysammlung enthält Texte über die rumänische Kommunistin und Exaußenministerin Ana Pauker, die Opfer des latenten Antisemitismus stalinistischer Prägung wurde; des Weiteren über Cioran, dem wiederum der Antisemitismus der Rechten unterstellt wurde. Manea urteilt über seinen Landsmann, den er in Paris selber getroffen hatte, objektiv, aber konzessionslos. Und dann auch über Celan, der in Paris seinerseits an seinem "Exildeutsch" festhielt, "selbst wenn die Sprache Deutsch und der Dichter Jude" war.
Worauf sich Manea selber fragen muss, ob man als jüdischer Deportierter und Regimegegner noch Rumänisch schreiben könne. Aber er tut es, und zwar nach eigener Darstellung vor allem wegen der rumänischen Volksmärchen, die ihm als Kind eine literarische Wiege gewesen waren.
Langsam vereinigen sich seine Kernthemen – Totalitarismus und Shoah, Exil und Sprache – zu einem einzigen, dem einzigen auch, das bezeichnenderweise nicht mehr direkt mit Rumänien zu tun hat, sondern darüber hinausgeht: Kafkas "Unmöglichkeiten".
Die erste ist die Unmöglichkeit, nicht zu schreiben (weil ihn das Schreiben am Leben hält), die zweite die Unmöglichkeit, auf Deutsch zu schreiben (wegen der Entfremdung zum deutschen Alltag); die dritte besteht in der Unmöglichkeit, anders zu schreiben (als auf Deutsch), die vierte in der Unmöglichkeit zu schreiben (weil sich die Verzweiflung auch dadurch nicht beruhigen lässt).
Manea analysiert dieses widersprüchliche, unentwirrbare und letztlich unentrinnbare Netz, in dem Kafka gefangen war, und wundert sich: Eigentlich hätte der Prager eine fünfte Unmöglichkeit anführen müssen – die Unmöglichkeit, im Exil zu schreiben, oder schlichter gesagt die Unmöglichkeit des Exils. Sie sei eine Art Quintessenz, ein Kondensat der vier ersten Unmöglichkeiten, meint Manea. Und sie zwingt ihn, seine frühere Feststellung zu revidieren, der Exilant werde durch das mitgeführte Schneckenhaus der Muttersprache beschützt.
In Wirklichkeit sei sie stets bedroht, denn der Exilschriftsteller pralle unvorbereitet auf sein neues Umfeld, er erlebe "den neuen Boden und den neuen Himmel, die neuen Lebewesen, den Klang ihrer einladenden oder abweisenden Sprache". In der heißen Wüste sei die Schnecke trotz ih-res Häuschens gefährdet, und damit auch die Chance des "schriftstellerischen, sprachlichen Überlebens".
Und dieses Schicksal drohe heute, wie Manea schreibt, nicht mehr nur dem Schriftsteller, Emigranten oder Juden, sondern allen Sterblichen. Im neuen Jahrtausend würden Mobilität und Migration, so Manea, bald schon normal, damit auch "trivial"; unsere Welt werde damit "kosmopolitisch, postmodern, post- und intensivkafkaesk, zentrifugal".
Fast dreißig Jahre nach seiner Abreise aus Bukarest kommt der 79-jährige Rumäne zu einem düsteren Schluss: Was man euphemistisch "unbegrenzte Möglichkeiten" nenne, sei in Wahrheit die Zunahme von Exil und Entfremdung, der Verlust von Erinnerung und Hoffnung.
Man könnte sich nun seinerseits wundern, warum Manea eine sechste Unmöglichkeit auslässt, nämlich jene der Rückkehr des Exilanten. Ist sie nur möglich für nationale Denker wie Alexander Solschenizyn, der 1994 nach Russland zurückkehrte? Manea schweigt sich dazu aus, obwohl man nach seinem Erinnerungsbuch Die Rückkehr des Hooligan und einer kurzen Rückreise nach Rumänien mehr zu dem Thema erwartet hätte. So ist das einzige Indiz, dass er in den New Yorker Dinners die Literatur "seines" Landes verteidigt, nicht Rumänien als solches.
In seine Landessprache zurückfallen, wie das Cioran auf seinem Sterbebett tat, ist für Manea kein Thema: Er ist ihr immer treu geblieben. Damit entfällt zumindest ein Grund, warum der rumänische Autor in das Land seiner Muttersprache zurückkehren sollte.
Und angesichts der kreativen Kraft seiner jüngsten Essays scheint das Leben fern der Heimat zumindest möglich, wenn nicht gar vorzuziehen zu sein. Vielleicht gibt es doch etwas wie die Möglichkeit des Exils. (Stefan Brändle, Album, 5.12.2015)