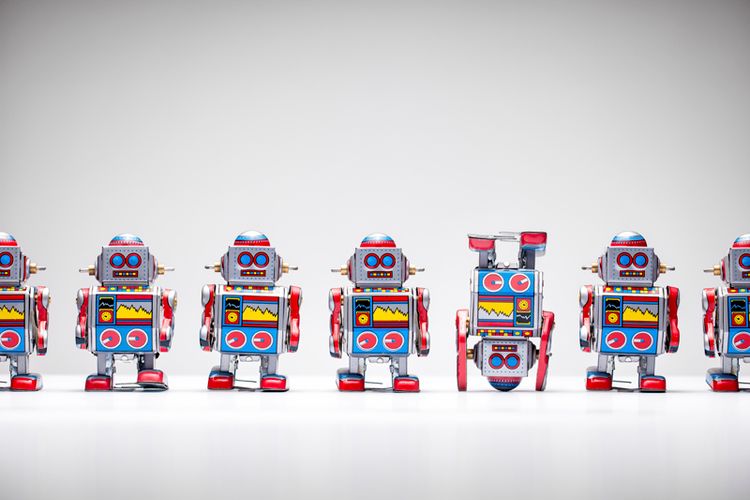STANDARD: Wie geht es Kindern und Jugendlichen in Österreich?
Vavrik: Es wäre schön, wenn ich diese Frage beantworten könnte. Eines unserer größten Probleme in Österreich ist, dass wir zu wenig Daten über Kinder- und Jugendliche haben. In Deutschland wird das im Rahmen der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (KIGGS) vom unabhängigen Robert-Koch-Institut gemacht. Jeder Experte bedient sich dieser Ergebnisse in der Planung von gesundheitspolitischen Maßnahmen.
STANDARD: Warum?
Vavrik: Weil das Fundament für die Gesundheit einer Gesellschaft in der Kindheit und Jugend gelegt wird. Darüber gibt es einen breiten Konsens. Wir haben bis dato kein entsprechendes Monitoring.
STANDARD: Was ist mit dem Mutter-Kind-Pass?
Vavrik: Weder aus dem Mutter-Kind-Pass noch aus den Untersuchungen der Schulärzte, die hier ebenfalls eine wichtige Rolle haben könnten, werden die erhobenen Daten gesammelt. Ohne empirische Fakten ist es schwierig, rechtzeitig Maßnahmen zu setzen.
STANDARD: Wer ist dagegen?
Vavrik: Im Prinzip niemand, es ergreift nur niemand ausreichend engagiert die entsprechende Initiative. Die aufgesplitterten Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherungen machen Fragen der Verantwortungsübernahme sehr schwierig.
STANDARD: Es gibt aber offensichtlich Probleme, etwa die steigende Zahl adipöser Kinder?
Vavrik: Genau, dafür gibt es sogar Daten einer OECD-weiten Befragung von Kindern und Jugendlichen. Wir wissen, dass Prävention schon in der frühen Kindheit für die Vermeidung von Adipositas eine Schlüsselrolle spielt. Hier müssten Programme für Gesundheitsförderung ansetzen. Ernährung, Bewegung, psychische Gesundheit, das hängt eng zusammen.
STANDARD: Es gibt doch Pilotprojekte?
Vavrik: Pilotprojekte gibt es in Österreich ausreichend. Aber wenn es darum geht, Projekte in die Regelversorgung zu übernehmen, beginnen die Schwierigkeiten. Einzig bei den "Frühen Hilfen" ist uns das gelungen. Junge Familien mit Belastungen bekommen Unterstützung, der Benefit für die Kinder ist enorm.
STANDARD: Was macht Ihnen Sorgen?
Vavrik: Unter anderem die steigende Kinderarmut. Die Schere zwischen Arm und Reich wird größer. In manchen Bundesländern müssen Kinder und Jugendliche eineinhalb Jahre auf eine Ergotherapie auf Krankenschein warten. Einen Wahltherapeuten können sich nur wohlhabendere Familien leisten. 40 bis 60 Euro pro Woche für Therapie zu zahlen geht sich für sozial schwächer Gestellte einfach nicht aus, obwohl diese Gruppe den dringendsten Bedarf hätte. Ähnlich sieht es bei Psychotherapie aus. Auch angesichts der Flüchtlingskinder hat das dramatische Folgen.
STANDARD: Inwiefern?
Vavrik: Gesundheitspolitik muss langfristig denken. In Österreich werden 70.000 Kinder pro Jahr geboren, allein in den letzten Jahren sind 30.000 bis 40.000 Kinder hierher geflohen. Wir brauchen Konzepte, um sie zu integrieren. Bildung, auch darüber herrscht Konsens, ist ein zentraler Punkt.
STANDARD: Die Lehrer wollen diese Aufgabe wahrscheinlich nicht übernehmen?
Vavrik: Das ist zu kurz gefasst, so wie es auch bloß eine zusätzliche Turnstunde gegen den grassierenden Bewegungsmangel wäre. Es geht darum, grundsätzlich gesundheitsfördernde Strukturen in der Schule zu schaffen. Schulärzte beziehungsweise entsprechende Teams könnten hier eine ganz neue Rolle bekommen. An den Nachmittagen könnte Gesundheitsförderung stattfinden: Kochen, Ausflüge in die Natur, Psychohygiene, Bewegung. All das. Gesundheit zieht sich durch sämtliche Bereiche des Lebens. Gerade für Flüchtlingskinder könnten solche Betreuungsteams inklusive einer traumakompetenten Pädagogik eine Riesenchance sein.
STANDARD: Das klingt nach Sozialarbeit?
Vavrik: Gesundheit wird großteils nicht in Krankenanstalten gemacht, sondern von einer Gesellschaft, die entsprechende Rahmenbedingungen schafft. Dafür brauchte es eine Politik, die über angestammte Ressortgrenzen hinaus denkt, etwa dass Bildungspolitik auch Verantwortung für Gesundheit übernimmt und umgekehrt. Gerade Kinder und Jugendliche brauchten diese Kooperationen.
STANDARD: Wie können Kinder von der Gesundheitsreform profitieren?
Vavrik: Wenn das Konzept der Primary-Health-Care-Zentren tatsächlich in Österreich Einzug hält, wäre das eine große Chance, für Kinder und Jugendliche und deren Familien spezialisierte Einrichtungen zu schaffen. Dort arbeiten Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter zusammen. Gebündelte Expertise also. Wichtig wäre allerdings, dass Kinder nicht bei den Erwachsenen miteingegliedert werden – aus unberechtigter Sorge davor, Parallelstrukturen zu schaffen.
STANDARD: Kinder- und Jugendrehabilitation in Österreich ist ein langes Projekt. Wie ist der Letztstand?
Vavrik: Das erste Konzept dafür wurde 1996 geschrieben. Seither ist viel Zeit vergangen, es gibt sie noch nicht, aber es hat sich einiges bewegt. Man hat sich auf eine gemeinsame Finanzierung der Kinderreha zwischen Ländern und Sozialversicherung geeinigt und darauf, dass alle Kinder ohne Unterschied der Störungsursache Rehab erhalten können. Derzeit läuft das Ausschreibungsverfahren für konkrete Standorte. Meine Hoffnung ist, dass über Österreich verteilt drei oder vier Zentren entstehen. Wichtig ist, dass die 1996 geplante Maßnahme endlich Realität wird. (Karin Pollack, 9.12.2015)