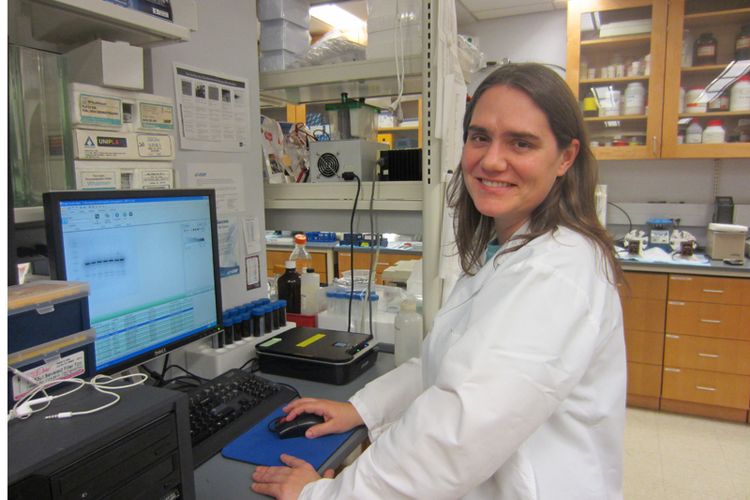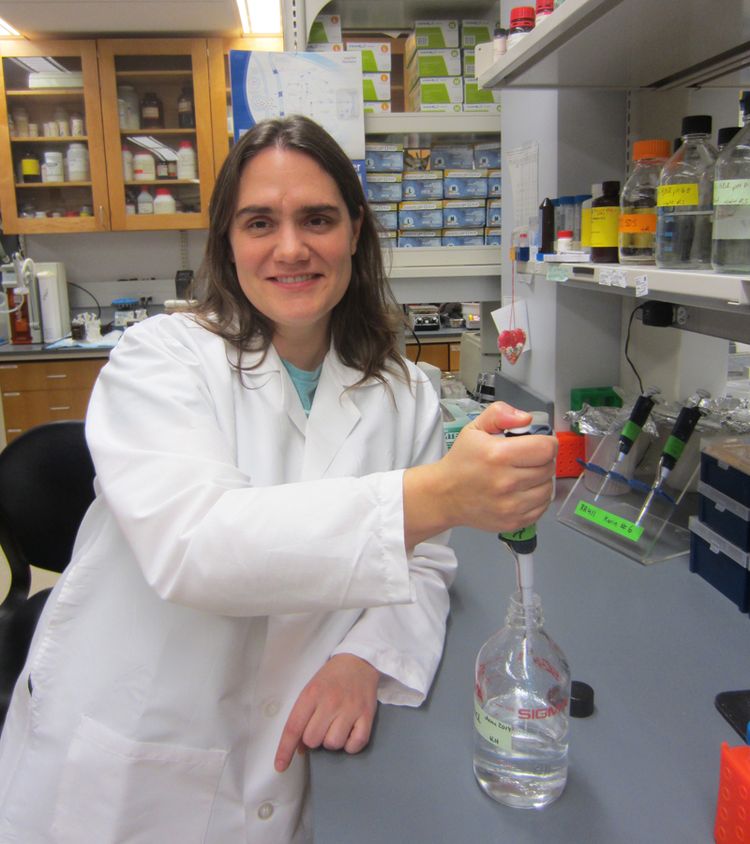Karin Hochrainer war die Erste in ihrer Familie, die studiert hat. Nach dem Besuch eines neusprachlichen Gymnasiums entschied sich die 1976 in Gmunden Geborene doch für ein naturwissenschaftliches Studium, die Biologie: "Durch den ersten Abschnitt habe ich mich durchgebissen, aber den zweiten habe ich in einem Jahr gemacht, denn da konnte ich mich schon auf das spezialisieren, was mich wirklich interessiert." Im Jahr 2000 machte sie ihren Abschluss in Mikrobiologie, 2005 das Doktorat in Molekularer Biologie an der Medizinuniversität Wien.
"Wenn du nicht im Ausland warst, bekommst du heute keine Professur in Österreich. Erst treibt man die Leute weg, dann hofft man, dass sie wiederkommen. Aber das tun die wenigsten", sagt Hochrainer. Sie selbst ging nach ihrem PhD nach New York an das Weill Cornell Medical College zu Neurwissenschafter Josef Anrather. "Das war ein Zufall", erklärt sie, "ich wäre überall hingegangen, wenn es fachlich gepasst hätte. Wir hatten gerade einmal telefoniert und uns nie persönlich gesehen, als ich zusagte. Dann stand ich in New York mit zwei Koffern und kannte niemanden."
Jedes Jahr Evaluation
Heute ist sie ebendort Assistenzprofessorin für Neurowissenschaften. "In den USA wird man jedes Jahr evaluiert, und es ist ganz transparent, was für den nächsten Karriereschritt notwendig ist", sagt Hochrainer. "Das ermöglicht Planbarkeit und gibt den Leuten Aussicht. Das ist extrem wichtig." Sie ergänzt: "Mir haben die Zustände an der Universität in Österreich nicht gefallen, wie da mit Posten geschachert wurde."
In den USA geblieben sei sie aus privaten und beruflichen Gründen. "Mein Mann ist Associate Professor in New York, er ist ein in Indien geborener Chemiker. 2010 haben wir in Indien geheiratet, aber leben wollen wir dort nicht." Sie selbst wolle eher nach Europa zurück, wegen "der Eltern und der Geschwister". Aber nach Österreich ziehe es sie aufgrund des wissenschaftlichen Umfelds nicht, eher nach Deutschland, in die Schweiz oder nach Schweden.
"Man wird im Ausland patriotisch"
Am meisten vermisse sie in den USA das österreichische Essen: "Die Käsekrainer", sagt sie. Und: "Ich bin glücklich dort, wo ich bin. Aber wenn das Flugzeug in Wien landet, merke ich die emotionale Verbindung. Man wird erst im Ausland patriotisch."
In Österreich ortet sie einen "Personenkult". "Wenn du im Ausland nicht schon ein großes Labor hast, bist du für Österreich nicht attraktiv. Da wird dann ein großer Fisch an Land gezogen, und mit demselben Geld könnten zehn Jungforscher finanziert werden." Sie selbst glaubt eher an die Sinnhaftigkeit von "multidisziplinären Centern" als von Einzelpersonen.
Eine Sache, die unabhängig von großen finanziellen Mitteln auch in Österreich umsetzbar wäre: "In den USA sind wir gezwungen, Mentoren zu haben. Das ist sinnvoll, denn man braucht Vorbilder. Aber solche, die sich auch wirklich für einen interessieren und um einen kümmern." (Tanja Paar, 18.12.2015)