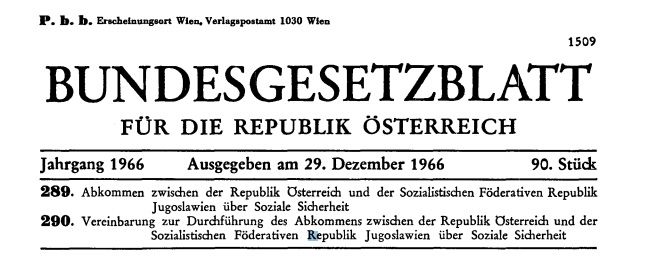"Sie sind ein Bestand unserer Stadt wie die Donau und der Stephansdom", sagte Helmut Zilk im Juni 1989 über die jugoslawischen Gastarbeiter und begrüßte sie "mit Liebe und Zuneigung als Bürger dieser Stadt". Diese und weitere schmeichelnde Worte sprach der damalige Wiener Bürgermeister im Hanappi-Stadion anlässlich der 10. Arbeitersportspiele, einer bundesweiten Veranstaltung des sogenannten Jugoslawischen Dachverbands. Seit 1980 gab es die Arbeitersportspiele, die zehnte Auflage im Hanappi-Stadion war eine der letzten großen Veranstaltungen der jugoslawischen Gastarbeitervereine.
Jugoslawische Arbeiter waren zu diesem Zeitpunkt seit knapp 30 Jahren die größte Migrantengruppe in Österreich. Seit Beginn der 1960er-Jahre kamen tausende junge Männer und Frauen, um vor allem auf Baustellen und in Fabriken zu arbeiten. Sie wurden händeringend von den Unternehmen gesucht, die Arbeitslosenrate lag in Österreich unter drei Prozent.
Am 4. April 1966 wurde nach jahrelangen Verhandlungen mit der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien die bereits gelebte Realität offiziell gemacht: Das "Abkommen zur Beschäftigung jugoslawischer Arbeitnehmer in Österreich" trat in Kraft. Mit dem Abkommen wurde die Arbeitsmigration rechtlich geregelt, die jugoslawischen Arbeiter erhielten darin die Gleichstellung im Lohnabgaben- und Krankenversicherungssystem zugesichert.
Ankommen am Südbahnhof
Nach dem Inkrafttreten des Abkommens beginnt die Zahl der Gastarbeiter aus Jugoslawien kontinuierlich zu steigen. Im Jahr vor dem Abkommen arbeiteten knapp 20.000 jugoslawische Staatsbürger in Österreich, ab 1966 stieg ihre Zahl steil an, um im Jahr 1973 mit 178.134 Arbeitern ihren vorläufigen Höhepunkt zu erreichen. Zwischen 1980 und 1987 verließen viele wieder Österreich, einige hatten wohl schon die österreichische Staatsbürgerschaft und wurden nicht mehr in der Statistik erfasst. 1987 arbeiteten 82.000 Jugoslawen in Österreich. Die wirtschaftliche und politische Krise trieb sie Ende der 1980er wieder ins Ausland. Die Zahl der in Österreich Beschäftigten, die 1974 auf dem Höhepunkt der Arbeitsmigration verzeichnet wurde, wurde erst Mitte der 1990 wieder erreicht. Unter diesen Arbeitern waren aber auch viele Flüchtlinge der Jugoslawienkriege.
Familie Emrić
Unter den ersten Jugoslawen, die sich auf den Weg nach Österreich machten, waren auch die Eltern von A. Emrić*. "Sie stammen beide aus kleinbäuerlichen, kinderreichen bosnischen Familien. In der Migration sahen sie ihre einzige Chance, den Lebensunterhalt der Familie zu sichern", erzählt Emrić heute. Im Sommer 1968, wenige Monate nach ihrer Geburt, beschlossen die Eltern, nach Österreich zu gehen, weil ein entfernter Verwandter dort bereits Arbeit gefunden hatte. Die Mutter ging voran und fand sofort Arbeit in einer kleinen Fabrik im siebten Wiener Bezirk – für sich und den Ehemann. Bereits bei ihrer Ankunft am Südbahnhof hatte Frau Emrić vier Stellenangebote erhalten.
Arbeit lag damals auf der Straße. Das ist der einhellige Befund aller Gastarbeiter der ersten Stunde. Die meisten Jugoslawen kamen nicht durch Vermittlungsbüros, sondern wurden von Verwandten oder Freunden aus dem Dorf eingeladen. Nicht selten zahlten die Firmen Provisionen für die Vermittlung neuer Arbeitskräfte.

Milutin Borisavljević wurde an einem Sonntag im Jahr 1969 am Wiener Südbahnhof von einem Bekannten in Empfang genommen, und schon am Montag darauf begann er in einer Firma in Simmering zu arbeiten. Ursprünglich wollte er nur wenige Monate bleiben, um ein Haus in seinem Heimatdorf in der Nähe der serbischen Stadt Čačak zu bauen, erzählt Borisavljević in der dreisprachigen Biografiensammlung "Wir, die Zugvögel", die der Autor Goran Novaković für den Wiener Integrationsfonds zusammengetragen hat.
Prekäres Wohnen
Arbeit gab es genug, doch die Wohnungssuche verlief in den meisten Fällen zäh. Gab es für Alleinstehende oft Mehrbettzimmer, die teilweise von der Firma zur Verfügung gestellt wurden, war es für Familien sehr schwierig, geeigneten Wohnraum zu finden. Monatelang dauerte es, bis das Ehepaar Emrić eine Wohnung fand, um das wenige Monate alte Baby aus Bosnien nachzuholen. Ohne Deutschkenntnisse waren sie auf die Hilfe einer Dolmetscherin angewiesen, die gleichzeitig ihre Maklerin war.
Die Tochter erzählt eine beliebte Familienanekdote aus dieser Zeit. "Die Dolmetscherin hat meine Eltern dazu angehalten, Ausschau nach einem 'Wohnung frei'-Schild zu halten. Sie war sehr erbost, als sie dann von meinen Eltern gerufen wurde, um in einem Haus nachzufragen, und vor einem 'Einfahrt freihalten'-Schild stand." Erst vier Monate nach der Ankunft konnte Familie Emrić in eine Hausbesorgerwohnung ziehen.
Hausbesorger und Arbeiter
Der Politologe Hannes Wimmer untersuchte in den 1980er-Jahren die Wohnverhältnisse der Arbeitsmigranten und kam zu dem Ergebnis, dass die Gastarbeiter Zugang zu jenen Wohnungen bekamen, die für die Einheimischen unattraktiv waren. 80 Prozent von ihnen lebten in Substandardwohnungen der Kategorie D, ein Viertel davon war ohne fließendes Wasser und WC. Da ab 1970 gleichzeitig der Hausbesorgerberuf in Wien wegen geringer Bezahlung und schlechter Dienstwohnungen immer unbeliebter wurde, besetzten die jugoslawischen Gastarbeiter diese Stellen. Sie zogen in die kleinen, finsteren und feuchten Erdgeschoßwohnungen und verrichteten die Hausbesorgertätigkeit meist neben der regulären Arbeit in der Fabrik oder auf der Baustelle.
Keine Einladungen
Eine winzige Hausbesorgerwohnung, zunächst in der Burggasse, dann in Breitensee, ist auch A. Emrićs erste Erinnerung an Wien. Sie spielte im Innenhof mit den anderen Kindern und lernte Deutsch, während die Mutter vergeblich auf eine Kaffee-Einladung ihrer Nachbarinnen wartete. "Meine Mutter war damals sehr einsam, glaube ich. Sie fühlt sich heute noch gekränkt, weil sie nie auf einen Plausch eingeladen wurde, immer nur zum Putzen. Dabei war und ist sie eine sehr kontaktfreudige Person und wollte unbedingt ein Teil der Hausgemeinschaft sein", erinnert sich die Tochter.

Viel Kontakt zu den Landsleuten gab es in der ersten Zeit ebenfalls nicht. Erst einige Jahre später lernte die Familie andere Gastarbeiter aus Bosnien kennen, und man verbrachte gemeinsam die freien Wochenenden.
Ähnliche Erfahrungen haben Milutin Borisavljević und seine Frau Melanija gemacht. Sie zogen in eine 42 Quadratmeter große Hausbesorgerwohnung in Wien-Währing. Die Wohnung war zwar sehr hell, aber es gab darin kein Wasser, erinnert sich Melanija Borisavljević in "Wir, die Zugvögel".
Auch die Borisavljevićs klagen über wenig Kontakt: "Die Österreicher haben nicht gewagt, zu uns zu kommen. Sie haben uns nur beobachtet." Gute Erinnerungen haben sie lediglich an Frau Kuhn, eine sehr betagte Dame, die ihnen am Anfang in Österreich bei der Wohnungssuche half.
"An uns Österreicher!"
Von dem distanzierten Verhältnis zwischen den Arbeitsmigranten und der Mehrheitsbevölkerung zeugt auch ein Sonderheft der "Diakonischen Information" vom Mai 1971. Ein Appell mit dem Titel "An uns Österreicher" ruft die Leser dazu auf, über die sozialen Probleme und die Diskriminierung nachzudenken: "Warum muss ein Großteil der Gastarbeiter in menschenunwürdigen Wohnungen leben?", "Warum kann ein Gastarbeiter nicht als Betriebsrat gewählt werden?", und zum Schluss noch eine Frage in Fettschrift: "Warum verlangen wir eigentlich von den Gastarbeitern, dass sie unsere Sprache erlernen, sie unsere Andersartigkeit akzeptieren und sie sich anpassen? Müssten nicht auch wir Versuche in diese Richtung unternehmen?"
Ohne den Begriff zu nennen, forderte die Diakonie einen sehr progressiven Zugang zur "Integration". Allerdings gab es schon ein Jahr zuvor im Rahmen der 3. Österreichischen Konferenz für Sozialarbeit 1971 einen Appell an die Politik, die Integration von Gastarbeitern "gezielt zu fördern".
"Sidbanof"
Die frommen Wünsche der Diakonie und die Rufe der Sozialarbeiter blieben vorerst auf dem Papier, die Gastarbeiter unter sich. Die Freizeit verbrachte man, wenn das Wetter es erlaubte, außerhalb der beengten Wohnungen. Jene, die schon Familien nachgeholt hatten, trafen Landsleute in Parks oder auf Wiesen in den Außenbezirken, die Alleinstehenden gingen meist zum Südbahnhof. Der "Sidbanof" war ein beliebter Treffpunkt, um Neuigkeiten aus der Heimat auszutauschen, nach einer neuen Arbeitsmöglichkeit zu fragen oder um Hilfe bei Behördenwegen zu bitten.
Die Mehrheitsbevölkerung und die Stadtregierung missbilligten diese informellen Treffpunkte. Der Südbahnhof, so hieß es, solle nicht "balkanisiert" und zum "Basar" umfunktioniert werden. 1971 gab es unter dem SPÖ-Bürgermeister Felix Slavik sogar Überlegungen, rund um den Bahnhof ein eigenes "Gastarbeiterviertel" zu errichten, um die Einwanderer räumlich vom Rest der Bevölkerung zu trennen.

"Balkanesisches Woodstock"
Spontane Treffen im öffentlichen Raum beschäftigten die Politik auch im Jahr darauf, als im Sommer 1972 im Wiener Augarten ein nicht angemeldetes Fest mit Musik und Verkaufsständen stattfand. Malte Olschewski nannte es in der "Presse" vom 12. August 1972 ein "Balkanesisches Woodstock". Die "Arbeiterzeitung" vom 17. August berichtete darüber, dass den Gastarbeitern für Zusammenkünfte nun ein Platz unter der Reichsbrücke zur Verfügung gestellt wurde, der mit Müllcontainern und am Wochenende mit Sanitärlastwagen ausgestattet war. Richtig angenommen wurde dieser Platz an der Peripherie der Stadt aber nie.
Einen offiziellen und repräsentativen Ort der Gastarbeitergeschichte erforscht der Zeithistoriker Ljubomir Bratić. Das Filmcasino in Wien-Margareten diente der jugoslawischen Community zwischen 1979 und 1989 als Veranstaltungsort für kulturelle Aktivitäten. Hier zeigten die Arbeitervereine neue Kinofilme aus der alten Heimat und hielten Folkloretanz-Proben ab, hier trafen sich die Schiedsrichter der Sportvereine und die Lehrer für den muttersprachlichen Unterricht. "Das war kein Raum im Souterrain, sondern ein mitten in der Stadt gelegener repräsentativer Ort", erklärt Bratić die Besonderheit des Filmcasinos. Finanziert wurden die Aktivitäten mithilfe der jugoslawischen Gewerkschaft und des ÖGB.

Die Rolle, die der ÖGB in der Gastarbeitergeschichte gespielt hat, bezeichnet die Historikerin Vida Bakondy als "ambivalent". Es gab klare Diskriminierung wie den Ausschluss vom Betriebswahlrecht und die klare Bevorzugung der Inländer durch die Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes. Andererseits gab es auch immer wieder Zusammenarbeit mit der jugoslawischen Gewerkschaft und eben Geld für die Aktivitäten der jugoslawischen Arbeiter, erklärt Bakondy.
Neben der Diskriminierung, der prekären Wohnsituation und den Bemühungen, die Gastarbeiter in der Öffentlichkeit unsichtbar zu machen, war die Schulintegration ein weiteres soziales Problem, das mit dem Konzept der "Gastarbeit" einherging.
Obwohl es ursprünglich nicht so vorgesehen und auch von den ersten Gastarbeitern nicht so geplant war, holten Anfang der 1970-Jahre immer mehr Jugoslawen ihre Kinder nach Österreich. Das österreichische Bildungssystem war auf sie nicht vorbereitet, beziehungsweise wurden diese Schüler als ein vorübergehendes Phänomen betrachtet. Unverhältnismäßig viele Gastarbeiterkinder landeten in Sonderschulen, die Drop-out-Rate war hoch, ebenso die Zahl jener, die Klassen wiederholen mussten.
Außenseiter in der Schule
Die Bildungsbiografie von A. Emrić verlief im Vergleich zu jenen vieler anderer Gastarbeiterkinder sehr erfolgreich. Sie besuchte Anfang der 1970er-Jahre das Gymnasium auf der Schmelz im 15. Bezirk. Eine damals neueröffnete, moderne Schule, wie sie betont. "Aber ich war eines von lediglich zwei Migrantenkindern damals. Und ich habe mich bis zur Matura und darüber hinaus als Außenseiterin gefühlt." Nach der Matura studierte sie und ging am Ende des Studiums auch für ein paar Semester nach Jugoslawien.
Vorübergehend und für immer
"Klar möchte ich dazugehören. Nämlich selbstverständlich."
"Ich bin wohl die Einzige von uns vier Geschwistern, die diese Idee der Rückkehr von den Eltern übernommen und weitergeführt hat. Ich wollte unten ins Gymnasium gehen und auch unten studieren", sagt Emrić. Erst vor 15 Jahren, im Alter von 33, wurde ihr klar, dass sie definitiv nach Österreich gehört. An den Zeitpunkt erinnert sie sich genau: Es war bei der Demonstration, die unter dem Titel "Transnationaler MigrantInnenstreik" jedes Jahr am 1. März stattfindet. "Ich stand da, und mir wurde klar: Meine Eltern haben diese Stadt mit aufgebaut, meine Kinder sind hier geboren. Ich bin ein Teil dieser Geschichte, ich habe das Recht, hier zu sein."
Die Unsicherheit darüber, ob man nach Österreich gehört, ist ein fester Bestand der Gastarbeiterbiografien und wird unterbewusst auch an die Kinder weitergegeben. Begründet und begünstigt wurde dieses Dilemma durch das ursprünglich geplante "Rotationsprinzip" mit temporären Arbeitskräften. Die Gastarbeiter sollten möglichst bald in ihre Heimatländer zurückkehren und bei Bedarf durch neue Arbeiter ersetzt werden. Doch weder für die Arbeiter selbst noch für die Arbeitgeber erwies sich das als ein sinnvolles und praktikables Prinzip.
Einige Monate oder höchstens einige Jahre wollten die Gastarbeiter bleiben, ein Haus in der alten Heimat bauen, etwas auf die Seite legen. Aber es kam anders. Der Großteil der Gastarbeiter ist in Österreich geblieben. Ihre Kinder und Enkelkinder sind hier aufgewachsen und ein fester Bestandteil der Gesellschaft geworden. "Sie sind Österreicher", sagt Emrić über ihre Kinder, Nichten und Neffen. (Text: Olivera Stajić, Video: Siniša Puktalović, 3.7.2016)