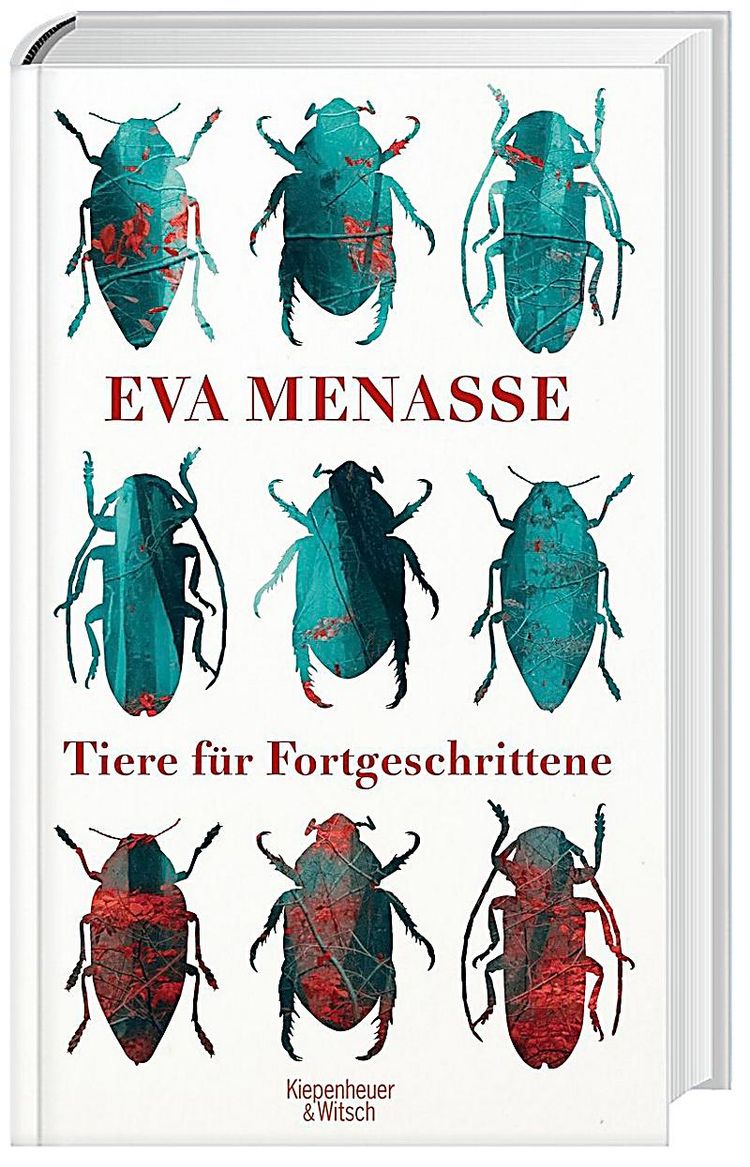STANDARD: Sie sind eine große Beobachterin der menschlichen Spezies. Haben Sie persönlich Vorbilder für ein gelungenes Leben?
Eva Menasse: Für mich ist das Leben meines Vaters gelungen oder auch das meiner Tante Edith. Die standen mit einem Fuß schon im Jenseits und schafften doch die Flucht. Sie haben nach dem Krieg trotz aller Verluste ein positives Leben führen können. Das war einerseits einfach glücklicher Zufall, lag aber andererseits auch an einer Einstellung, an der man arbeiten kann. Wenn mein alter Vater sich heute seine Kinder- und Enkelschar anschaut, weiß er schon, was da geglückt ist.
STANDARD: Haben Sie das Gefühl, dass diese ältere Generation, die es härter hatte, eine bessere Haltung gegenüber dem Leben hat?
Menasse: Ja, ich denke, dass wir wehleidig geworden sind. Mit fast 50 erkenne ich, was ich von zu Hause mitbekommen habe. Zum Beispiel eine Dankbarkeit dafür, dass wir da sind und dass es uns gutgeht. Ich bin gegen das ständige Raunzen. Es kommt einer Wohlstandsverwahrlosung gleich, dass Menschen heute manchmal so eingesperrt sind in ihren angeblichen Problemen. Aber mir fällt natürlich auch auf, wie aggressiv die Leute mittlerweile sind. Man fährt jemanden versehentlich mit dem Einkaufswagen an, und es gibt gleich eine Schreierei.
STANDARD: In einer Rezension zum Roman "Quasikristalle" stand über die Protagonistin Xane, sie sei "unter Druck ausgehärtet". Was bringt ein Leben unter Druck?
Menasse: Der unglaubliche Zeitdruck, unter dem die allermeisten – auch ich – leiden, ist absurd. Unsere Abhängigkeit von Mobiltelefonen ist krank. Die an sich gute Idee, immer erreichbar zu sein und von zu Hause aus arbeiten zu können, hilft uns nicht weiter. Im Gegenteil: Wir können zwischen Arbeit und Beruf nicht mehr unterscheiden. Das zerstört die menschlichen Bindungen. Wir müssten mittlerweile Entzugskuren von diesen Geräten machen. Erst kürzlich sah ich vier ungefähr zwölfjährige Mädchen in der U-Bahn. Sie standen wie ein Kleeblatt um eine Haltestange. Mit einer Hand hielten sie sich fest, mit der anderen wischte jede auf ihrem Handy. Sie haben sich unterhalten, sich dabei aber nicht angeschaut. Bei uns zu Hause gibt es Handyverbot bei Tisch.
STANDARD: Sie sind gewissermaßen eine Patchwork-Expertin. Das Thema kommt in Ihren Erzählungen vor, und Sie kennen solche Erfahrungen sowohl als Kind als auch als Erwachsene. Beobachten Sie Unterschiede von früher zu heute?
Menasse: Mein Eindruck ist, dass sich Menschen heute mangels existenzieller Probleme gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Früher ging das freundlicher und friedlicher zu. Der unerbittliche Hass ist eher ein Phänomen der heutigen Zeit. Es ist wie moderner Krieg. Mein Bruder ist ja der Sohn meines Vaters aus erster Ehe. Bis heute gibt es die allerbesten Beziehungen. Bei den Familienfesten kommen alle zusammen. Was sich bei anderen heutzutage abspielt – das sind doch Stellvertreterkriege.
STANDARD: Wenn tatsächlich etwas Schlimmes passiert, zum Beispiel der plötzliche Tod eines Freundes wie jener von Michael Glawogger 2014, was hilft einem, damit umzugehen?
Menasse: Ich erinnere mich noch an den langen Zug, in dem ich mit anderen durch den Ort zum Friedhof gegangen bin. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, warum wir das machen. Diese alten Rituale haben Sinn. Der Tag war schrecklich, aber er war auch kathartisch und erhebend. Michael Glawoggers Frau hat das großartig gemacht. Kürzlich hat sie gesagt, wenn sie etwas aus diesem Verlust gelernt hat, dann: Nichts auf später verschieben! Nicht warten, bis die Kinder aus dem Haus sind, bis man in Pension ist. Nein, jetzt! Das ist ein Schlüssel zu einem geglückten Leben. Ein weiterer, den ich fürs Schreiben benutze, ist, in die Schuhe anderer zu steigen. Wie geht es dem? Wie hat der das gesehen? Wenn man etwas davon in sein Leben überträgt, ist vieles nicht mehr so schlimm.
STANDARD: Sie haben selbst schon sehr offen über einen Zusammenbruch gesprochen. Was führt zu solchen Schräglagen im Leben? Und: Was hat Ihnen nach diesem Zusammenbruch geholfen?
Menasse: Zusammenbruch ist nicht das richtige Wort. Es war eine Krise, die ich nach einer traumatischen Fehlgeburt hatte. Wenn ich etwas nicht kann, ist es zu warten. Der Prozess, bis klar war, dass aus dieser Schwangerschaft nichts mehr wird, hat sich über Wochen gezogen. Dieses eine Mal war das eine zu viel. Früher konnte ich Probleme gut wegschieben: Das geht schon. Das passiert anderen Leuten auch. Solche Sätze habe ich auch als Kind oft gehört. Aber man muss sich den Dingen stellen. In meiner Arbeit gelingt mir das besser. Wenn ich um einen Text angefragt werde, vor dem ich sofort Angst habe, weil ich denke, das kann ich nicht, weiß ich, den muss ich machen. Im Privaten habe ich das lange nicht gemacht. Aber damals war ich so im Eck – ich wusste, ich muss etwas in meinem Leben ändern, weil ich sonst nicht mehr auf die Beine komme.
STANDARD: Sind ein unerfüllter Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit oder Fehlgeburten nach wie vor Tabus?
Menasse: Ja. Ich glaube, dass hier das Thema Gleichberechtigung noch nicht umgesetzt ist. Viele alternde Schriftsteller schreiben hemmungslos über ihre Impotenz und ihre Prostataprobleme, siehe Philip Roth. Max Frisch, den ich sehr verehre, hat schon mit 40 Jahren begonnen, sich am alternden Mann abzuarbeiten. In meiner Generation sind diese Frauenthemen immer noch mit Scham behaftet. Allein dieser Satz: Sie hat das Kind verloren. Das klingt so, als wäre es aus Unachtsamkeit passiert.
STANDARD: Was haben Sie in Ihrer Krise unternommen?
Menasse: Ich habe eine Therapie begonnen. Und ich habe begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen. Mir war plötzlich klar, dass es etwas im Leben gibt, wovor ich mich immer gefürchtet habe, aber immer machen wollte: singen. Mein Jugendwunsch war, Radiosprecherin zu werden. Worauf ich fast am stolzesten bin in den vergangenen Jahren, sind nicht die Preise, die ich für meine Bücher bekommen habe, sondern die Tatsache, dass mich jemand vom Radio als Erzählstimme für ein Feature angefragt hat. Der Gesangsunterricht hat mich gerettet. Das Tollste daran: Ich habe mir damit nicht nur einen verdrängten Wunsch erfüllt, sondern beim Singen gelernt, wie das mit dem Schreiben funktioniert. Es ist ein ähnlicher Prozess. In dem Moment, wo ich loslasse und ein Teil meiner Aufmerksamkeit woanders hinfließt, läuft es. Es geht um den Mix aus Kontrolle und Chaos.
STANDARD: Unsere Generation ist die erste, die vermehrt therapeutische Hilfe nutzt. Ein gutes Mittel, um durch schwierige Zeiten zu kommen?
Menasse: Ich glaube, es ist hilfreich, über sich selbst zu sprechen. Das können besonders Männer nicht sehr gut. Und wer über sich selbst nicht sprechen kann, denkt auch über sich selbst nicht nach. Ich glaube, dass eine Therapie einen gescheiter macht. Ich bin aber nicht sicher, ob sie einen unbedingt glücklicher macht. Aber ich persönlich möchte gern klüger werden, weil alt werden muss ich eh. Ich will immer noch mehr begreifen vom Leben. Deswegen schreibe ich. Mit meiner Literatur umkreise ich Themenkomplexe, die mich interessieren, und dringe so zu tiefer liegenden Wahrheiten vor. Ich verstehe auch immer besser, welche Qualität im Zuhören liegt. Es hat gar nichts damit zu tun, immer einen Tipp parat zu haben. Gutes Zuhören bedeutet: Sag mir, wie es dir geht, und ich höre es mir an. Genau das machen Therapeuten: dir zuhören, wo du hinwillst. Und nicht, dir zu sagen: Das und das musst du tun.
STANDARD: Helfen Ihnen auch Arbeitsroutinen?
Menasse: Ich habe immer gesagt, man muss so schreiben wie Thomas Mann, wie ein Beamter mit fixen Schreibzeiten. Früher, als ich noch in der Stabi (Staatsbibliothek zu Berlin, Anm.) geschrieben habe, begann ich immer um fünf vor neun. Ich musste dort immer denselben Schreibtisch haben und, weil die um neun aufsperren, war ich immer schon vorher da. Mittlerweile arbeite ich von zu Hause, das habe ich in meiner Zeit in der Villa Massimo in Rom gelernt. Ich muss heute zum Arbeiten nicht mehr woanders hingehen. Ich schreibe vormittags, bis mein Kind aus der Schule kommt. Aber oft ist diese Vormittagsarbeit nur eine Vorbereitung, und so richtig geht es erst abends weiter, wenn das Kind im Bett ist. Ich fühle mich dann wie ein Sportler, der sich lange aufwärmen muss für diesen einen Sprung.
STANDARD: Sie sind als Schriftstellerin auch Kritik ausgesetzt. Wie lernt man, damit umzugehen? Wie lernt man Resilienz?
Menasse: Ich glaube, dass mir meine Jahre als Journalistin helfen. Da ich bin viel, vor allem von älteren männlichen Kollegen, kritisiert worden. Sachlich fundierte Kritik wie die von meiner Lektorin halte ich gut aus. Auf persönlich abwertende Zeitungskritiken reagiere ich empfindlich. Am Anfang meiner literarischen Karriere hatte ich zwei, drei Kritiken, die wehgetan haben. Das sind Narben, die bleiben. Alles, was nachher kam, war nie mehr so schlimm. Da gibt es offensichtlich einen Abhärtungsprozess.
STANDARD: Eines Ihrer Bücher heißt "Lässliche Todsünden". Welches Laster macht krank?
Menasse: Ich denke, dass Neid ein großes Problem ist. Wenn man sich mit sich selbst nicht mehr freuen kann. Wenn man immer darauf schauen muss, ob der andere mehr oder es besser hat. Flüchtlinge bekommen jetzt mehr Geld als die armen Mindestrentner! Solche Aussagen stimmen zwar meist nicht, aber man kann sie zumindest einmal behaupten. Neid ist etwas Vergiftendes. Im neuen Glawogger-Film "Untitled", den Monika Willi jetzt fertiggestellt hat, ist schön zu beobachten, wie sich diese armen Menschen gegenseitig unterstützen. Das hat mir meine Tante auch immer erzählt, wie viel man sich nach dem Krieg geholfen hat. Je mehr man hat, desto weniger will man geben. Das ist eine unangenehme menschliche Eigenschaft.
STANDARD: In Ihrer Erzählung "Haie" schreiben Sie: Die Welt ist so unübersichtlich geworden und der durchschnittliche Mensch so unerträglich privat in seinen Sorgen." Wie sollen wir leben?
Menasse: Wir können nur hoffen, dass eine Art von Umbruch im Gange ist. Es gibt wieder junge Leute, die auf die Straße gehen und politisch werden. Sicher ist vieles schiefgelaufen in der Flüchtlingskrise, aber ebenso sind viele über sich selbst hinausgewachsen. Jeder von uns kann so viel mehr. Man muss sich den Herausforderungen stellen. Man darf auch scheitern, auch dazu haben wir leider ein sehr schlechtes Verhältnis. Es zu probieren und zu scheitern ist für die psychische Konstitution sicher hilfreicher, als es nie probiert zu haben. Wir sollten mehr wagen, aber nicht beim Bungee-Jumping, sondern in Hinsicht auf soziale Beziehungen.
STANDARD: In einer Ihrer aktuellen Erzählungen schreiben Sie über ein altes Paar: Ein Mann pflegt seine an Alzheimer erkrankte Frau, es kommt zum Konflikt mit den Töchtern. Ist Altwerden zum Problem geworden?
Menasse: Wir sind als Gesellschaft unempathisch geworden. Die Leute haben heute so große Angst, selbst einmal pflegebedürftig zu werden, dass sie lieber einen Vertrag bei Exit in der Schweiz unterschreiben. Aber wir haben unseren Kindern auch den Arsch gewischt und sie großgezogen. Das wäre der Kreislauf des Lebens. In der Erzählung "Raupen" versuche ich aber, meinen Figuren Raum zu lassen. Ich möchte eine Geschichte so schreiben, dass man wie mit einer Kamera rundherum fährt. Mich interessieren keine Bücher, die fertig sind, wenn ich sie zuklappe. Wenn mich ein Buch tagelang später beschäftigt, ist es ein gutes Buch.
STANDARD: In dieser Geschichte kommt auch das Tabuthema Sex im Alter vor ...
Menasse: Wir müssen uns doch bloß erinnern, dass wir als Jugendliche gedacht hatten, dass unsere Eltern keinen Sex mehr haben. Da waren die um vieles jünger als ich jetzt. Es wäre doch traurig, wenn das aufhören würde. Diese Form von körperlicher Nähe und Vertrautheit brauchen wir. Man sieht es Menschen an, die jahrzehntelang niemanden mehr umarmt haben. Mir fällt an mir selbst auf, dass ich körperlicher werde, meine Freunde öfter umarme. Ich war als junge Frau sehr distanziert, aber vielleicht auch deswegen, weil damals die Männer mehr gegrapscht haben.
STANDARD: Kinder geben einem auch viel Körperlichkeit. Sie haben einmal gesagt, dass Menschen ohne Kinder der Blick auf sich selbst fehlt. Sehen Sie das immer noch so?
Menasse: Ich weiß, dass Kinderlose ärgerlich werden, wenn man so etwas sagt, weil sie sich dann als weniger wertvolle Menschen angesehen fühlen. Das ist nicht, was ich meine. Wenn ich keine Kinder habe, dann bleibe ich in gewisser Hinsicht immer Kind. Dann lebe ich mein Leben in Bezug zu meinen Eltern. Wer Kinder hat, der merkt irgendwann, dass man plötzlich Dinge macht, die man selbst an seinen Eltern gehasst hat. Man tut sie aber, weil sie gut sind für das Kind. Als ich meinen Sohn zum ersten Mal im Arm gehalten habe, war das ein Schock, der bedeutet hat: Jetzt bist du verletzlich.
STANDARD: Was Sie an manchen Stellen Ihrer Geschichten schon ein bisschen vorwegnehmen, ist, wie es sich dann für Sie anfühlen wird, wenn das eigene Kind aus dem Haus geht.
Menasse: Allein die Frage, was mit dem Kinderzimmer passiert, ist für viele meiner Freunde nicht einfach. Lässt man alles so, oder schafft man mehr Platz für sich selbst? Die wenigsten Eltern schaffen das. Es wäre gelogen, dass dieses Korsett einen nicht einengt: jeden Tag aufstehen, jeden Tag Frühstück machen, jeden Tag da sein. Manchmal denke ich daran, wie es wieder ohne diese Verantwortung sein wird.
STANDARD: Fühlen Sie sich in Ihrer Lebensmitte?
Menasse: Ich fürchte, ich bin wie Max Frisch und denke schon viel zu früh über das Altern nach. Ich bin in meinem Kopf auch immer ein Jahr älter, als ich tatsächlich bin.
STANDARD: In Ihrer Geschichte "Opossum" lassen Sie eine Frau sagen: "Wenn ich die Arme hochhebe, sehen meine Brüste noch ganz toll aus."
Menasse: Das macht man doch als Frau so, oder? (lacht)
STANDARD: Haben Sie Angst vor dem Altwerden?
Menasse: Angst? Aus privaten Gründen ist mein Leben jetzt wieder sehr viel offener geworden, als es lange Zeit war. Es fühlt sich gut an, dass vieles nicht mehr so festgezurrt ist. Ich bin eher neugierig. (Mia Eidlhuber, CURE, 16.4.2017)
Zum Weiterlesen:
Untitled: Traumpfade ins verwunschene Paradies
Emotionen beeinflussen die Empathiefähigkeit
Spiegelneurone: Zwischenmenschliches beeinflusst auch Organe