Psychisch gesunde Menschen können sich eine Erkrankung wie eine Depression kaum vorstellen. In der Literatur spielte das Leiden aber immer schon eine große Rolle. Wenn es um das Verständnis von Verzweiflung geht, ist die Lektüre von Texten depressiver Autoren erhellend

Um sein Leben schreiben
Mit seinem Buch "Die Welt im Rücken" ist dem Schriftsteller Thomas Melle ohne Zweifel etwas Großes gelungen. Mit einer unglaublichen Sprachgewalt, Radikalität und Wahrhaftigkeit hat der Berliner Autor seine manisch-depressive Erkrankung, an der er seit vielen Jahren leidet, aufgeschrieben.
Es gibt nicht viele Bücher, die, obwohl so herausragend gut geschrieben, so anstrengend zu lesen sind. Die Wucht der psychotischen Schübe seiner bipolaren Erkrankung, die ausschweifenden Manien, die darauffolgende Depression und Erschöpftheit, schlussendlich die Ausweglosigkeit dieser sich stets wiederholenden Episoden breiten sich auch auf den Leser aus. Und das, obwohl dieser Roman, der eigentlich gar kein Roman ist, so meisterhaft und gekonnt strukturiert ist. So stellt sich etwa der Autor Melle schon früh die Frage nach dem Warum einer solchen Erkrankung, gibt zudem analytische Erklärungen und mäandert selbst krankhaft noch genialisch durch die Pop- und Kulturgeschichte. Keine Zeile Koketterie oder Selbstmitleid. Im Gegenteil. Kein Wunder, dass so ein rasend guter Stoff nicht nur Leser fesselt. Jan Bosses Adaption für das Wiener Akademietheater mit einem zweieinhalb Stunden über furios präsenten Joachim Meyerhoff ist großes Theater – und schafft noch einmal mehr Verständnis für eine sehr schwere Erkrankung. (Mia Eidlhuber)
Thomas Melle: "Die Welt im Rücken". Rowohlt-Verlag 2016, 352 Seiten, 20,60 Euro
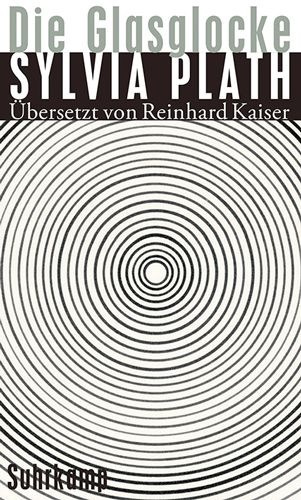
Gelähmtheit und Selbstabwertung
Mit ihrem einzigen Roman "Die Glasglocke", 1963 in den USA veröffentlicht, hat sich die Lyrikerin Sylvia Plath in der Literaturgeschichte verewigt. Die damals knapp 30-Jährige schildert die schwere Existenzkrise der 20-jährigen Amerikanerin Esther Greenwood, die bis zum Versuch geht, sich das Leben zu nehmen. Genau das hat Plath mit knapp 20 Jahren auch gemacht. Dass ihr zweiter Suizidversuch kurz nach Veröffentlichung von Glasglocke "glückte", lässt bis heute über den autobiografischen Gehalt des Buches spekulieren. Dass die Bezüge zu ihrem eigenen Leben eher stark sein dürften, verleiht Plaths Text etwas existenziell Dringliches.
Die Autorin beschreibt die Depression als Zustand zwischen bleierner Gelähmtheit, einer sich über das Haupt senkenden Glasglocke gleich, und Phasen manischer Selbstabwertung. Letztere ist auch eine Reaktion auf die Gesellschaft der 1950er-Jahre, die für Frauen lediglich eine einzige Rolle vorgesehen hatte: die der Hausfrau und Mutter. Einen Ausbruch erlebt Plath zeitlebens als kaum möglich, auch Esther Greenwood schafft ihn nicht. Die Abwertung der sich nicht fügenden Frau als neurotisch und selbstsüchtig kannte Plath aus eigener Anschauung. In ihrem Roman sind es dann die Frauen, die Perspektiven eröffnen, etwa die Psychiaterin, die der Protagonistin erstmals ein bisschen Frischluft unter die Glasglocke zu fächeln vermag. (Lisa Mayr)
Sylvia Plath: "Die Glasglocke". Deutsch von Reinhard Kaiser, Suhrkamp-Verlag 2013, 262 Seiten, 22,95 Euro
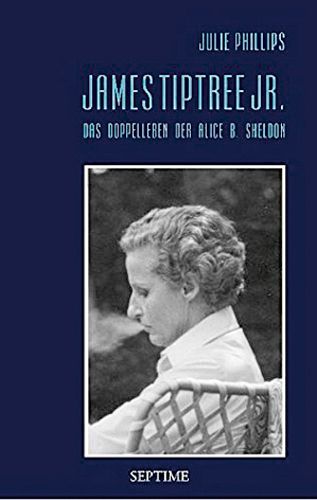
In Richtung Auslöschung
Schwermut und Todessehnsucht zogen sich durch die vielen Leben, die Alice B. Sheldon führte: Sie war Malerin und Psychologin gewesen, Jägerin und CIA-Mitarbeiterin. Doch als sie Ende der 1960er-Jahre begann, unter dem Pseudonym "James Tiptree Jr." Science-Fiction-Erzählungen zu veröffentlichen, fand sie für ihre inneren Dämonen ein ungewöhnliches Ventil: Sie löschte die Menschheit aus – immer wieder. Und stand am Ende einer Geschichte nicht der Tod der Zivilisation, dann doch sehr oft jener der Hauptfigur. Sheldon nutzte das Repertoire der Science-Fiction als Metapher. Sie machte ihre Figuren zu Gefangenen von Zeitschleifen und dystopischen Gesellschaftsentwürfen, transzendenten kosmischen Ereignissen oder schlicht ihres eigenen Wahnsinns. Kurz: Sie versetzte sie in ausweglose Lagen, gegen die sie ebenso leidenschaftlich wie letztlich vergebens ankämpften, ehe sie sich ergaben: ein Spiegel von Sheldons eigenem Leben, das zwischen Phasen manischer Aktivität und Tagen wechselte, an denen sie mit einem kühlen Lappen über der Stirn im Bett lag und das Haus nicht verlassen konnte. Julie Phillips erzählt in "James Tiptree Jr. Das Doppelleben der Alice B. Sheldon" diese außergewöhnliche Vita nach, die Sheldon selbst 1985, zwei Jahre vor ihrem Suizid, so zusammengefasst hatte: "Doch – das Leben ist da, um gelebt zu werden. Nur wie? Wie? Wie? Wie?" (Jürgen Doppler)
Julie Phillips: "James Tiptree Jr. Das Doppelleben der Alice B. Sheldon". Septime-Verlag 2013, 800 Seiten, 29,80 Euro

Auf der Suche nach der richtigen Frage
Anscheinend ist das möglich: Man kann depressiv sein und zugleich Symptome der Depression wegschreiben", notiert der niederländische Autor Gerbrand Bakker in seinen Aufzeichnungen, die 2016 unter dem Titel "Jasper und sein Knecht" erschienen sind. Von der beschriebenen Möglichkeit macht er darin reichlich Gebrauch, berichtet auf 445 Seiten von seinen alltäglich(s)ten Verrichtungen, ausgedehnten Spaziergängen mit seinem Hund Jasper, geht intensiv der Gartenarbeit und der Frage nach, wie es kommen konnte, dass er – Jahre nachdem er mit dem Roman "Oben ist es still" literarischen Weltruhm erlangt hatte – in eine Lebenskrise geraten war, deren Benennung als klinische Depression ihm nur mithilfe eines Therapeuten gelang: "Nicht dass ich damit schon aus allem heraus gewesen wäre, eine Depression wird man nicht von einem auf den anderen Augenblick los. Sie muss sich gewissermaßen abnutzen. Man muss über sie sprechen. Aber auch still sein. Gut für sich sorgen, möglichst lieb zu sich sein." Von diesem mühsamen Weg erzählt dieses Buch, das sich dezidiert nicht als Roman ausweist, und es erzählt davon, dass die Linderung der Symptome mitnichten als Folge der richtigen Selbstbefragung geltend gemacht werden kann: "Vielleicht müsste man aber eine andere Frage stellen: (...) Liegt es einfach am Citalopram? Ist es so simpel?" Vielleicht. (Josef Bichler)
Gerbrand Bakker: "Jasper und sein Knecht". Deutsch von Andreas Ecke, Suhrkamp 2016, 445 Seiten, 24,70 Euro

Immer diese Frauenleiden
In den 50er-, 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts war es gang und gäbe, Menschen mit Soma und Psyche nicht eindeutig zuordenbaren Beschwerden die Diagnose "vegetative Dystopie" zu verordnen. Das war alles und nichts, hörte sich aber eindeutig besser an als die aus der Mode gekommene "Hysterie". Ingeborg Bachmann sah sich ebenfalls mit dieser Diagnose konfrontiert. Und mit einer ebenfalls für die damalige Zeit üblichen Selbstherrlichkeit pflegte die männliche Ärzteschaft das Leiden von Frauen als "Frauenleiden" abzutun. Ihre Krankheit dokumentierte Bachmann in Briefen, Traumprotokollen und Entwürfen, nachlesbar sind die Texte erstmals in dem eben erschienenen Band "Male oscuro", herausgegeben von Isolde Schiffermüller und Gabriela Pelloni als Teil der Salzburger Bachmann Edition. Schonungslos, direkt und intensiv schreibt die Schriftstellerin darin über ihre Krankheit in den Jahren zwischen 1962 und 1966 und das Unvermögen, sich daraus zu befreien. Dass jahrelange Fehlbehandlung körperliches und seelisches Leiden verstärkte, dessen wurde sie sich schließlich bewusst. Bachmanns Befund über den Zynismus und die Gleichgültigkeit der Mediziner gegenüber dem Patienten gipfelt in einer zornigen Anklageschrift ("Sehr geehrte Herren"). So viel dazu: Nicht an allem Unglück dieser Welt ist man selbst schuld. (Doris Priesching)
Ingeborg Bachmann: "Male oscuro". Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit, Piper Suhrkamp 2017, 260 Seiten, 34,00 Euro

Die ewige Zerstreutheit
Depressionen haben viele Gesichter. Eines davon: es nicht aus dem Bett schaffen, die besten Vorsätze haben, aber sie nicht umsetzen; keinen klaren Gedanken fassen können und ins Grübeln verfallen. In der russischen Literatur gibt es für diesen Typ Mensch ein literarisches Vorbild, das Iwan Gontscharow Mitte des 19. Jahrhunderts in der Person des Ilja Iljitsch Oblomow verewigt hat. Selbstverständlich ist es keine Krankengeschichte, vielmehr die Lebensschilderung eines ehemals reichen Aristokratensohns, der den Anschluss verliert. Gontscharows Kunstgriff: Oblomow ist keineswegs unsympathisch, sondern im Gegenteil mit viel Liebe und Feingefühl gezeichnet.
Spätestens nach 100 Seiten ist einem diese Figur vollkommen vertraut, vielleicht gerade deshalb, weil jeder mehr oder weniger Anteile von Melancholie in sich trägt. Sie werden – so wie in diesem Roman – auch durch die äußeren Lebensumstände getriggert, etwa schwierige wirtschaftliche Zeiten: Da verkriecht sich Oblomow lieber in sich selbst – diesen "sozialen Rückzug" würden heutige Psychiater als Symptom von Depression definieren. Als Leser will man ihm ständig zurufen: "Komm, reiß dich zusammen, mach endlich" – und begreift Seite um Seite, dass genau das nicht passieren wird. Trotzdem mag man Oblomow, den ewig zögerlichen Meister der Prokrastination, den man nie wieder vergessen wird. (Karin Pollack)
Iwan Gontscharow: "Oblomow". Neu übersetzt von Vera Bischitzky, dtv Taschenbuch 2015, 746 Seiten, 17,40 Euro

Gefangen im Orkan der Düsternis
Es ist kein Zufall, dass der amerikanische Pulitzerpreisträger William Styron (1925-2006) gegen Ende seines schmalen Bandes "Sturz in die Nacht" den Höllenzyklus aus Dantes "Göttlicher Komödie" herbeizitiert: "Auf halbem Weg des Menschenlebens fand / ich mich in einen finstern Wald verschlagen." Den Abstieg in die Welt des Jenseitigen machte Styron in Form einer klinischen Depression durch, die den erfolgreichen Autor, dessen Roman "Sophies Entscheidung" mit Meryl Streep verfilmt wurde, kurz nach seinem sechzigsten Lebensjahr erfasste. Präzis und selbstmitleidslos schildert der Autor seine Zeit im "Orkan der Düsternis" sowie Symptome wie völlige Verzweiflung, Lähmung, Selbstekel, Verstörung, Konzentrationsschwäche, Gedächtnis- und Schlafverlust. Es ist nicht das geringste Verdienst dieses gelehrten, aber gut lesbaren und mit vielen Verweisen auf andere depressive Künstler angereicherten Bandes, dass Styron, der nur knapp dem Freitod entging, weniger die Entstehung von Depressionen, sondern deren Überwindung interessiert. Er rät unter anderem zu Geduld, Vertrauen in Freundschaft und der Bereitschaft, (medizinische) Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Buch endet mit dem Wiederaufstieg ins Licht und einem Zitat aus der Göttlichen Komödie: "E quindi uscimmo a riveder le stelle." Wir traten hinaus und sahen wieder die Sterne. (Stefan Gmünder)
William Styron: "Sturz in die Nacht. Die Geschichte einer Depression". Deutsch von Willi Winkler, Ullstein 2010, 125 Seiten, 14,40 Euro

An der Liebe verzweifelt
Der Mann, der in Dante Andrea Franzettis längerer Erzählung "Passion. Journal für Liliane" einmal noch versucht, bei einem gemeinsamen Aufenthalt in einem norditalienischen Hotel seine Frau zurückzugewinnen, hat zur Sicherheit "alles dabei": Xanax, Temesta, Somnium. Zuvor war er – getrennt von Gattin und den beiden Söhnen – durch Wochen, Monate "nie endender Trübheit, quälender, brennender Verzweiflung" getaumelt. "Er lebte wie ein Automat, (...) versuchte es mit Lektüren, die er nur wenige Seiten aushielt. Es war, als wäre er aus der Welt gefallen." Passion erzählt aber nicht nur die Geschichte eines Mannes, Nerbal sein Name, er ist Schriftsteller, der in seinen vermeintlich besten Jahren an der Liebe verzweifelt und in die Depression stürzt. Vielmehr ist das Buch neben einem Abgesang auf eine (oder die?) große Liebe auch eine poetische Vermisstenanzeige. Und es ist eine Etüde im Loslassen, die Dante Andrea Franzetti, der 2015 mit 55 Jahren verstarb, trotz des schweren Themas mit der ihm eigenen Leichtigkeit erzählt. Zu wenige Menschen ergeben eine falsche Welt, zu viele gar keine, schrieb Canetti. Um Nerbal herum sind – oder waren – definitiv zu wenige Menschen, besser gesagt nur einer: seine Frau Liliane, die ihm alles bedeutet. "Es ist ein Irrtum, abschließen zu wollen", heißt es in Passion. Es gibt Geschichten, davon spricht diese Prosa, die nie enden. (Stefan Gmünder)
Dante Andrea Franzetti: "Passion. Journal für Liliane". Haymon-Verlag 2006, 120 Seiten, 19,90 Euro
(CURE, 14.4.2017)