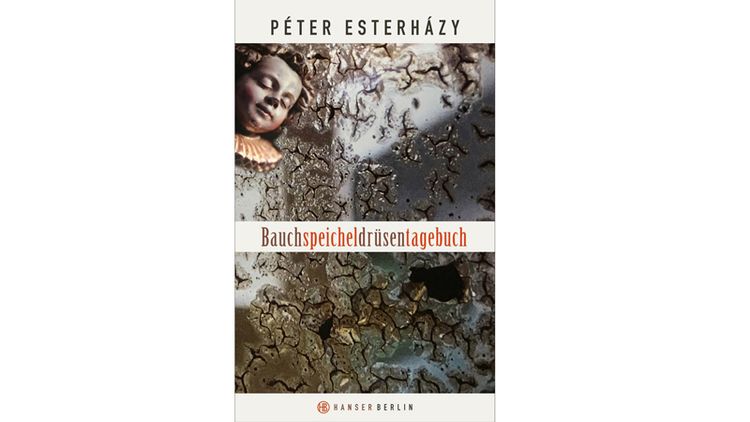Es sind immer die Daten, die einen Zusammenhang herstellen. Am 14. April, zum Beispiel, wäre Péter Esterházy 67 Jahre alt geworden. Den Tag seiner Geburt im Jahr 1950 verarbeitet er literarisch in "A Hard Day’s Night", das Ende seines Lebens hat er ebenfalls als Stoff für ein Buch genutzt. Sein Bauchspeicheldrüsentagebuch beschreibt die letzten 14 Monate seines Lebens, das am 14. Juli 2016 endete.
Wahrscheinlich wäre Esterházy, seiner Ausbildung nach Mathematiker, die Häufung der Zahl 14 aufgefallen. Dieser reine Zufall hätte ihm vielleicht gefallen. Er, der stets Fragmente montierte, die Zeit mit diesem Stilmittel außer Kraft zu setzen verstand, musste sich in seinem letzten Werk an eine Chronologie halten. Die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs trifft ihn wie aus heiterem Himmel.
Am 24. Mai 2015 beginnt er sein Tagebuch als Versuch, eine unfassbare Situation durch Worte zu begreifen, sich einer verborgenen Realität zu nähern und über das Mittel der Sprache eine Art Vertrautheit zurückzugewinnen. Seine Themen: Krebs, Krankheit und Sterben und die damit verbundenen Tabus. Diesen Zugang zur Welt, der im Auf- und Entdecken von Unbekanntem bestand, beherrschte Esterházy meisterhaft. Er redet vom ersten Eintrag an nicht um die Dinge herum.
Tabus brechen
"Krebs, das ist das richtige Anfangswort, wenngleich es nicht sofort fiel, gar nicht bald, wobei ich nicht denke, die Ärzte hätten das Wort gemieden. Ich war es ja sogar, der heiter danach fragte", so eröffnet er sein Tagebuch, dessen Ende der informierte Leser bereits kennt. Warum dieses Buch also lesen? Die Antwort: Weil es so schonungslos offen und unvoreingenommen mit der Thematik umspringt, weil es zeigt, dass Mut, Fantasie und Selbstironie bis zum letzten Atemzug zählen, und weil die Art zu sterben auch zeigt, wie jemand gelebt hat.
Vorerst führt Esterházy die vielen neuen Begriffe aus der Welt der Medizin spazieren. Er dekliniert und konjugiert, verkleinert, hinterfragt, macht sich lächerlich. Irgendwann beschließt er, sich mit jenem Organ zu befassen, das ihm das Leben schwermacht. Wie sieht diese Bauchspeicheldrüse aus, die als unbekannten Schlange unterhalb seiner Rippen sticht.
Obszöne Vergleiche drängen sich auf. Schließlich beschließt er, sich die Drüse als seine komplizierte Geliebte vorzustellen. "Mutzi" und "Bauchspeichelchen" nennt er sie, hasst sie, beschimpft sie, versucht sich mit ihr auszusöhnen. Esterházy, Meister des Anekdotischen, der wilden Assoziationen und unanständigen Vergleiche erschafft auf diese Weise ein durchaus authentisches Bild von seinem Hadern mit der Erkrankung.
Selbstbild versus Fremdbild
Die Tatsache, dass ihn seine Mitmenschen plötzlich nur mehr als Kranken wahrnehmen, ärgert ihn. Seinem Selbstverständnis nach ist er der, der er immer war. Wenn ihn die junge Ärztin nur noch als Patienten betrachtet, kränkt ihn das. Er erzählt es mit der ihm eigenen, wunderbaren Selbstironie.
Mut, auch diese Eigenschaft zeichnet Péter Esterházys aus. Er sieht der Gefahr ins Gesicht, sucht literarische Vorgänger im Krebstagebuchschreiben – etwa Wolfgang Herrndorf in Arbeit und Struktur oder Harold Brodkey, der sich ebenfalls mit seinem Pankreastumor auseinanderzusetzen hatte.
"Krebs ist ein großes Wort, die Krebsbehandlung aber eine Bagatelle. Brodkey sagt es gerade umgekehrt, ich glaube ihn zu verstehen", lautet eine Passage seiner fiktiven Auseinandersetzung. Seine Bezugnahme auf andere Autoren, sein Sich-in-Kontext-Setzen, um daraus neue Einsichten zu gewinnen, ist typisch für Esterházys Stil. Daraus ergeben sich die schönsten Gedanken, man liest sein Tagebuch langsam, genießt jeden Eintrag und wünschte, dass der Autor niemals zu denken und fantasieren aufhört.
Resümee ziehen
Esterházy lässt sein Leben und die Geschichte Ungarns Revue passieren, er verortet sich in dieser Welt als Intellektueller, als Freund, als Familienvater. Und er lässt seine Leser an vielen Projekten teilhaben, die es abzuschließen gilt. Seine Arbeit, auch das dokumentiert er auf anekdotisch- fragmentarische Weise, lässt ihn weitermachen und die unangenehmen Folgen der Chemotherapie immer wieder vergessen. Auf diese Weise entsteht ein Kaleidoskop verschiedener Eindrücke, das in seiner Gesamtheit betrachtet zu etwas vollkommen Eigenständigem wird.
Doch vieles an diesem Buch ist auch sehr handfest. Das Essen zum Beispiel. Es wird zum Barometer der Befindlichkeit. Mit ganzer Kraft verteidigt er seine von "ontologischer Heiterkeit" geprägte Lebensfreude. Eingespannt im Korsett der Chemotherapien gelingt ihm das immer nur phasenweise. Als Leser lernt man schnell, dass es nach den Krankenhausaufenthalten immer ein paar Tage dauert, bis ihm das Wiener Schnitzel, das Pilzpaprikasch oder die Speckbrote wieder schmecken werden. Auf diese Weise erfährt man unmittelbar, wie sich so eine Chemo anfühlt.
Fest im Griff
Doch die Phasen der Zuversicht werden gegen Ende des Buches rarer. "Ginge es nach mir, würde ich toben, doch bin ich bauchspeicheldrüsig diszipliniert", formuliert er seine schwindende Kraft. Authentisch ist, wie er darauf reagiert. Er wird phasenweise unleidlich ("Kinder, würde ich zusammenfassen, haut ab in Richtung Pfeffer"), erträgt die unterschiedlichen Reaktionen der Menschen auf sein verändertes Aussehen immer schlechter, verkriecht sich ("Ich bin auch früher schon öfter abgehauen.") und findet im Schlaf den für sich besten Zustand.
So ist es wahrscheinlich auch seine Müdigkeit, die ihn am 2. März 2016 verstummen lässt. Sein letzter Eintrag: "Ich möchte gern glauben, wenn die Sonne scheint, gebe es keine Probleme. Das geht nicht. Schade dass das Unsinn ist. (...) Bauchspeichelchen wird immer mit mir sein. Ich verbessere das Immer in Ewig." Péter Esterházy ist weg, sein Blick auf die Welt bleibt ein starkes Vermächtnis. (Karin Pollack, 15.4.2017)