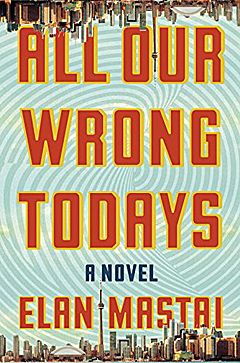
Elan Mastai: "All Our Wrong Todays"
Gebundene Ausgabe, 577 Seiten, Thorndike Press 2017
Es ist so weit: Das "Dude, where's my flying car?"-Mem hat seinen Roman, war auch Zeit. Wer davon noch nie gehört hat: Es handelt sich dabei um die Verdichtung all der technologiebasierten Vorstellungen, die man Mitte des 20. Jahrhunderts von der Zukunft hatte und in denen die Grenzen des Machbaren an Größe und Geschwindigkeit festgemacht wurden anstatt an möglichst hoher Datendichte. Es ist die Zukunft, die uns einst versprochen, aber irgendwann zugunsten von Smartphones und Social Media unterschlagen wurde.
Tom Barren, der Protagonist von Elan Mastais großartigem Roman "All Our Wrong Todays", beschreibt es so: Flying cars, robot maids, food pills, teleportation, jet packs, moving sidewalks, ray guns, hover boards, space vacations, and moon bases. All that dazzling, transformative technology our grandparents were certain was right around the corner. The stuff of world's fairs und pulp science-fiction magazines with titles like "Fantastic Future Tales" and "The Amazing World of Tomorrow". Can you picture it? Well, it happened. Tom kennt diese gestohlene Zukunft sehr genau, denn er war selbst der Dieb.
Temporaler Super-GAU
Genau genommen stammt Tom aus dem fernen Jahr ... 2016. Aber dieses 2016 ist ein globales Utopia; friedlich, freizeitvergnügt und bis ins Mark durchtechnisiert. Möglich wurde es, weil in diesem Lauf der Geschichte der Wissenschafter Lionel Goettreider 1965 per Zufall eine unbegrenzte Energiequelle entwickelt hatte. Ab da war alles machbar. Was zu Toms Lebzeiten dann leider auch bedeutet: Zeitreisen. Sein Vater, ein überaus ehrgeiziger Forscher, baut eine Zeitmaschine und bringt Tom im Chrononautenteam unter. Ziel ist das entscheidende Jahr 1965. Wir ahnen schon: Das wird den Lauf der Geschichte ändern.
Genauer gesagt wissen wir das bereits, denn der Roman setzt mit einem typischen Tagesbeginn in Toms neuem Leben ein – es ist wieder 2016, nur eben ganz anders. Schon das Erwachen in dieser unserer Welt ist eine Mühsal: Anstatt von schlafunterstützenden Gehirnwellen massiert zu werden, musste Tom auf einem Lager aus Pflanzenfasern liegen. In die man Federn gestopft hat, die wirklich echten Vögeln ausgerupft wurden, man stelle sich vor! Über die Diskrepanzen zwischen dem komfortablen Damals und dem barbarischen Jetzt wird Tom zu unserem Vergnügen immer wieder klagen.
Und bereits jetzt drängen sich zwei Fragen für den weiteren Verlauf des Romans auf: Wie genau kam es zur Veränderung der Historie? Und wird es Tom gelingen, alles wieder gradezubiegen und unsere elende Welt auszulöschen? R. A. Laffertys "So frustrieren wir Karl den Großen" lässt grüßen. Doch dabei soll es nicht belassen bleiben, denn "All Our Wrong Todays" wird noch einige unerwartete Wendungen nehmen.
Herrliche Hauptfigur
Tom ist 32, wirkt aber jünger, weil er erstens kaum etwas vorzuweisen hat und sich selbst immer wieder als Versager runtermacht – und zweitens noch ziemlich hormongesteuert ist. Als seine Mutter bei einem Unfall stirbt, schläft er im Anschluss an das Begräbnis der Reihe nach mit drei Exen und einer neuen Flamme, was sich so liest: "I don't know if this is a good idea," they'd say. "It's the only idea I have," I'd say. Sympathischer Schelm, der er ist, verzeiht man ihm aber alles (selbst die Zerstörung der Zukunft).
Tom geht ein bisschen in Richtung unzuverlässiger Erzähler – bei weitem nicht so sehr wie die Figuren von K. J. Parker, aber man sollte auf seine Taten und Worte ein Auge haben. Er gibt zu, dass er nicht alles weiß (Andererseits: Wer von uns könnte aus dem Stand ein iPhone nachbauen?) und dass er geradezu narzisstisch selbstbezogen ist. Was für die Handlung durchaus Bedeutung hat: "All Our Wrong Todays" ist ganz wesentlich auch eine Familien- und Liebesgeschichte, und das Private wird für Toms Entscheidung, die Zeitlinie noch einmal zu ändern, eine wichtige Rolle spielen. Denn unsere Welt ist zwar scheiße, aber mit seinen Eltern läuft's für ihn hier viel besser. Und da ist auch noch Chrononautenkollegin Penelope Weschler: In seiner Welt war sie ein unnahbarer Star, auch wenn ihre beiden Karrieren jeweils in grausamer Ironie endeten (Mastai charakterisiert sie wunderbar: "Sie besteht nur aus Entschlossenheit und der Angst, dass Entschlossenheit nicht ausreichen könnte."). Doch nun ist Penny plötzlich verfügbar.
Auch formal ist Toms Selbstbezogenheit prägend. Anfangs versucht er's kurz mit einer Erzählung in dritter Person – stellt aber rasch fest, dass das distanziert und feige klingt. Das Ergebnis des Wechsels zur Ich-Form ist eine Erzählung mit natürlicher Stimme, inklusive Gedankensprüngen, Momenten des Kontrollverlusts und Abschweifungen vom großen Gesamtbild zu vermeintlich unwichtigen Details. Ein ganzes Kapitel besteht ausschließlich aus einer Aneinanderreihung der Wörter "Fuck" und "Shit": eine absolut angemessene Reaktion auf den wichtigsten Moment der Menschheitsgeschichte.
Frischer Wind
Elan Mastai, der wie seine Hauptfigur aus Kanada stammt, ist ein Quereinsteiger in der Science Fiction, hauptberuflich arbeitet er als Drehbuchautor ("The F Word"). Und er bringt mit seiner munteren Schreibe höchst willkommenen frischen Wind ins Genre. Nichtsdestotrotz nimmt er das gewählte Thema ernst. In Sachen Zeitreisetechnologie und -zubehör beispielsweise hat er sich mehr Gedanken gemacht als viele g'standene Genre-AutorInnen, die lästige Details lieber stillschweigend überspringen. Auch das Problem, dass man wegen der Eigenbewegung der Erde mit der Zeit zwangsläufig auch den Ort wechselt, bleibt nicht ausgespart.
Mitten im quirligen Geschehen fallen zudem immer wieder Sätze, die einen kurz innehalten lassen. Zum Beispiel der vom Philosophen Paul Virilio entliehene Gedankengang, dass man mit jeder Erfindung "deren" höchsteigenen Unfall gleich miterfindet: Der Vater des Flugzeugs ist also auch der Vater des Absturzes. Das verheißt für die quasi-allmächtige Goettreider engine nichts Gutes ...
Darum
Auch Toms heimatliches Utopia bleibt nicht unreflektiert. In einer Welt, in der alles von Maschinen erledigt wird, leisten hundert Prozent der Menschheit ihr bisschen Arbeit in Laboren, die ausschließlich neue Entertainment-Möglichkeiten kreieren. Gesellschaftliche Institutionen mit Verantwortung für die Allgemeinheit spielen keine Rolle mehr – alles liegt, wie es so schön heißt, in den Händen aufmerksamer Firmen mit exzellentem Kundenservice. Und niemand rebelliert oder stellt je die Frage "Warum?". Es ist nicht nötig, weil die Antwort in der allgegenwärtigen Perfektion ringsumher offensichtlich ist. Das Glück hat also durchaus totalitäre Züge.
Mastai nutzt seinen Roman, um das Wesen der Science Fiction, unsere Gesellschaft und deren Vorstellungen von einer wünschenswerten Zukunft zu hinterfragen. Und sich selbst als Erzählung gleich mit: Immerhin verschmelzen in Toms Geist die Erinnerungen an zwei Zeitläufe. Er beginnt sich im Kopf des Pendants, das in unserer Welt aufgewachsen ist, wie ein "Virus" zu fühlen und muss sich sogar mit der Frage auseinandersetzen, ob die ganze Zeitreisekiste nicht bloß eine Wahnvorstellung ist. Das alles gelingt der Erzählung aber, ohne auch nur im allermindesten kopfig zu wirken. Stattdessen ist "All Our Wrong Todays" extrem unterhaltsam und eine der Empfehlungen des Jahres.

Matthias Oden: "Junktown"
Klappenbroschur, 400 Seiten, € 13,40, Heyne 2017
Also so aus dem Stand umgeblasen hat mich seit Dietmar Daths "Pulsarnacht" kein deutschsprachiger SF-Roman mehr. Mit der Synthese von Technologie, Biologie, Pharmazeutik und totalitärer Politik macht der aus Werbung und Journalismus kommende deutsche Autor Matthias Oden sein dystopisches Gesellschaftspanorama "Junktown" zu einem einzigartigen Mix. Und zu einem Hammer-Debüt – genauer gesagt ist es ein Vorschlaghammer.
Oden, der Wortgenerator
Neue AutorInnen machen oft den Fehler, kühne Ideen und bombastische Formulierungen rauszuhauen und sie dann mit konventionelleren Elementen "auszugleichen". Ganz falsch. Oden hingegen tut das einzig Richtige: nämlich das Übertriebene/Plakative/Knallige nicht in der Luft hängen, sondern in einer Lawine aus genauso oder noch mehr Übertriebenem/Plakativem/Knalligem mitrollen lassen. Das schafft eine neue, in sich stimmige Wirklichkeit – angesiedelt gewissermaßen auf einer höheren Ebene des Grellen. China Miéville hat diese Taktik zu einer Kunstform erhoben.
Beispiel Wording: Odens Welt ist in einer alternativen Zeitlinie oder nahen Zukunft nach der Konsumistischen Revolution angesiedelt: Der Konsum harter Drogen wurde damals legalisiert, und ist – weil sich die postrevolutionäre Gesellschaft seitdem zu einer faschistoiden Diktatur entwickelt hat – mittlerweile verpflichtend. Mehr als einmal wird man unwillkürlich "kommunistische" statt "konsumistische" Partei (Kürzel natürlich: KP) lesen. Und bliebe das das einzige Beispiel, wäre es nur ein kalauerndes Wortspiel. Doch da sind auch noch antikonsumistische Umtriebe. Politlabor. Konsumkraftzersetzung. Kraft durch Konsum. Rauschparteitag. Gemapo (die Geheime Maschinenpolizei). Und und und. Ohne Unterlass prasselt hier eine Lawine aus verballhorntem Nazi-und Sowjetsprech auf uns ein, man kommt aus dem Staunen kaum raus.
Meinen allerersten Leseeindruck – ich fühlte mich kurz an Warren Ellis erinnert – habe ich rasch verworfen, Oden ist um einiges sprach- und bildmächtiger. So etwa liest sich die Beschreibung einer staatlichen Aufsichtsbehörde: Sie beobachteten, kontrollierten, straften. Sie waren die Polymerasen, die unablässig den Genstrang der Gesellschaft nach Fehlern absuchten, die Killerzellen, die im Volkskörper ausmerzten, was krankhaft war und gefährlich. Ausgestattet mit den weitestreichenden Befugnissen, die die KP an ihre Staatsdiener vergab, gingen sie dabei ähnlich effektiv vor wie ein Immunsystem auf Vitaminspeed. – Zugegeben, man kann eine Metapher auch zu Tode reiten. Aber wenn man sie nur oft genug tritt, steht sie wieder auf und läuft weiter.
Was eigentlich passiert
Blenden wir vom alles erschlagenden Setting mal kurz zur Handlung, die ist rasch erzählt. Es gibt nur eine Handvoll Methoden, ein dystopisches System von innen zu beschreiben. Oden hat sich für die Variante vom ehrenwerten Polizisten entschieden, der ein Verbrechen aufklären will, erkennen muss, dass die Tat einen politischen Kontext hat, und dadurch selbst in Gefahr gerät. "Junktown" ist letztlich ein Noir-Krimi, ganz simpel eigentlich. Und doch so originell!
Besagter Polizist, ein altgedienter Revolutionsheld in seinen 50ern, heißt übrigens Solomon Cain. Ein Homophon zu Robert E. Howards Pulp-Held Solomon Kane. Da "Junktown" (eigentlicher Name: Jaxton) eine Hommage an Jeffrey Thomas' "Punktown" (Paxton) ist, scheint es mir unwahrscheinlich, dass die Ähnlichkeit zufällig ist. Zwingende Parallelen zwischen Howards Puritaner und Odens Hardboiled-Detektiv fallen mir zwar keine auf. Die durchgängig anglo-jiddischen Namen der BewohnerInnen Junktowns tragen aber auf jeden Fall dazu bei, die Romanwelt seltsam zeit- und ortlos wirken zu lassen.
Und das Mordopfer, für das Solomon zu einer faszinierend bizarren "Leichenbeschau" gerufen wird, war kein Mensch, sondern eine denkende und fühlende Maschine – genauer gesagt eine Brutmutter, die Menschen züchtet. Ist jemand überrascht, dass sie einen menschlichen Liebhaber hatte? Nun, spätestens dann, wenn man dazusagt, dass die Brutmutter keine anthropomorphe Konstruktion war, sondern ein mehrstöckiger Fabrikkomplex aus Metall (aber immerhin mit einem Beischlafstutzen versehen, im Volksmund auch Muschibüchse genannt).
Bizarrer als "Brazil"
Und schon sind wir wieder mitten in der Grandezza des Settings. Da werden Embryos je nach Bedarf in Richtung verschiedener Humanklassen gezüchtet. Wer will oder Geld braucht, kann seinen Körper auch nachträglich modifizieren lassen – ein Mann, den Solomon im Wartezimmer eines Arztes sieht, hat sich beispielsweise zum Gynäkomastiden machen lassen und gibt aus seinen zehn Brüsten Designer-Milch. Auf den Straßen lauschen laternenpfahlhohe Zerebralscanner (kurz Zebras) auf die Biosignale gesuchter Verbrecher, Stimmungsorgeln produzieren Gefühle nach Wunsch, Terroristen versuchen die Geschäfte börsengelisteter Gebärkonzerne (noch so ein schöner Ausdruck) zu stören, und es fallen die Namen von mehr Drogen, als ich je in meinem Leben gehört habe.
"Junktown" erinnert an den Biopunk der 90er und an die New-Weird-Strömung der Jahrtausendwende. Es fallen einem Autorennamen wie Paul di Filippo, China Miéville, Frank Hebben, Jeffrey Thomas oder John Meaney ein. Und auf der anderen Seite, wenn es um die brachialen Polit-Aspekte geht, die ganz klassischen Gesellschaftsdystopien à la "1984", "Brave New World" oder "Uhrwerk Orange", aus denen sich hier auch einige Zitate wiederfinden – im Sinne einer Verbeugung, nicht eines Plagiats.
MegaMechaXXL
Satirische Elemente reichen von den Pinkeltests, bei denen man im Gegensatz zu früher nachweisen muss, dass man tatsächlich Drogen nimmt, bis zur Tatsache, dass Müll nun als Statussymbol gilt. Da die Bevölkerung fast die ganze Zeit über zugedröhnt zuhause hockt und nur noch Maschinen das Funktionieren des Staates notdürftig aufrechterhalten, wird ja fast nichts mehr produziert. Der begehrte Müll, der wohlgefälligen Konsum vorgaukeln soll, wird daher auf Deponien aus der vorrevolutionären Zeit ausgebuddelt und nach Hause geliefert. Dafür gibt es logischerweise eine Müllanfuhr.
Worauf genau die Satire abzielt, ist hingegen gar nicht so leicht zu sagen. Auf diktatorische Systeme? Scheint mir zu einfach zu sein. Auf die Konsumgesellschaft? Immer noch zu platt. Vielleicht geht es ja um die generelle Neigung menschlicher Gesellschaften, egal welcher Art, mit der Zeit zur jeweils schlimmsten Ausformung ihrer selbst zu werden. Das wäre zumindest ein ernüchternder Befund, der zum gleichermaßen düsteren Inhalt des Romans passen würde. Aber bevor wir jetzt deprimiert nach Hause torkeln, lassen wir uns noch einmal von Odens sprachlichem Flow mitreißen und besuchen mit ihm das Rotlichtviertel von Junktown:
Nicht jede der ausgebrannten Glühbirnen in den leuchtenden Eingangsbaldachinen der Beischlafkabinenhotels wurde mehr ersetzt, manche der Koitomatenhallen standen halb leer und trist da, und zwischen modernisierten Wichsarenen und Cunnilinguslounges fand sich auch immer mal eine völlig durchgerostete Entsaftungsanlage oder eine Rubbelstation, deren poröses Polyurethan-Innenleben entweder von unbefriedigten Kunden oder einfach nur zugedröhnten Flaneuren herausgerissen worden war. Neue, strahlende Neonreklamen wechselten sich ab mit welken Plakaten; von MASTERbation bis MegaMechaXXL versprachen sie Abhilfe für so ziemlich jedes sexuelle Bedürfnis. "Hier bin ich groß geworden. Wir fahren gerade auf meinem Schulweg", sagte sie.
Also meine Nominierung für den Kurd-Laßwitz-Preis 2018 steht fest.
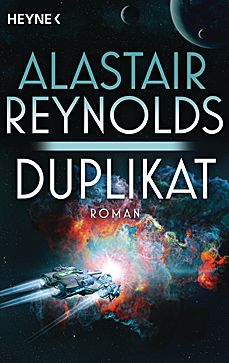
Alastair Reynolds: "Duplikat"
Broschiert, 766 Seiten, € 11,30, Heyne 2017 (Original: "On the Steel Breeze", 2013)
Ein Jahr ist in unserer Welt zwischen dem Erscheinen des ersten Bands von Alastair Reynolds' "Poseidon's Children"-Trilogie, "Okular", und dem Nachfolger "Duplikat" vergangen. (An dieser Stelle legen wir kurz eine Schweigeminute für die beiden Originaltitel "Blue Remembered Earth" und "On the Steel Breeze" ein ...) In Romanzeit waren es zwei Jahrhunderte. Was in einer Zukunft, die Methoden zur Lebensverlängerung auf 300 Jahre oder mehr kennt, einem nahtlosen Anschluss dennoch nicht im Wege steht.
Ein Gutteil der wichtigsten ProtagonistInnen aus Band 1 ist sogar noch am Leben, findet sich nun aber – wir schreiben mittlerweile das Jahr 2365 – nur noch in Nebenrollen wieder. Das Zepter der Hauptfigur geht an Chiku Akinya weiter und bleibt damit in der Familie: Denn die Trilogie ist zwar Space Opera und Future History einerseits – aber eben auch eine große Familiensaga. Die Akinyas haben auf dem Weg der Menschheit ins All eine zentrale Rolle gespielt und bleiben auch weiterhin am Ball. "Die Vergangenheit deiner Familie hat die aufreizende Angewohnheit, sich in die Gegenwart zu drängen", wird jemand Chiku sagen. Und wie er damit Recht behalten wird!
Die dreifache Chiku
Allerdings bekommen wir mit Chiku drei zum Preis von einer: Die Tochter von Sunday Akinya aus dem ersten Band wurde nämlich zweimal geklont. Anschließend verwischte man alle epigenetischen Spuren so gründlich, dass sich Original von Kopie nicht mehr unterscheiden ließ, und übertrug die Matrix von Chikus Bewusstsein auf die beiden anderen. Implantate ermöglichen zudem eine fortlaufende Gedächtnissynchronisation der drei Frauen, von denen sich jede als "die" Chiku begreift – nicht ganz eine telepathische Brücke, aber fast.
Eine der drei – "Chiku gelb" – bleibt auf der Erde, die anderen beiden treten Missionen im All an. Der Roman bleibt dabei stets für längere Zeit und über mehrere Kapitel hinweg bei einer. Kommt es dann zu einem Wechsel, geschieht dies in Form eines ganz normalen Kapitelbeginns, stärker wird nicht getrennt. Das führt manchmal zu einem Moment der Desorientierung, den der Autor aber durchaus beabsichtigt haben dürfte: Immerhin muss auch jede Chiku erst mal ihre "Gedächtnisse" sortieren, wenn wieder mal ein Datenpaket von einer Schwester eingetroffen ist.
Flug zum Exoplaneten
Während "Chiku rot" fürs erste buchstäblich auf Eis liegt (sie ist bei ihrer Mission in eine Art Koma gefallen), befindet sich "Chiku grün" an Bord eines Holoschiffs. Diese umgebauten Asteroiden sind zu Hunderten ausgeschwärmt und rasen mit 13 Prozent Lichtgeschwindigkeit auf vielversprechende Sternsysteme zu. Jedes für sich ist ein gewaltiges Habitat, das Millionen Menschen und zahllosen Tieren Platz bietet; aus Nostalgie für ihre alte afrikanische Heimat haben die Akinyas sogar Elefanten mitgenommen.
Vor Kurzem war Chiku auf der "Malabar" gewesen, diesmal war "New Tiamaat" das Ziel. Von außen glich auch dieses Holoschiff allen anderen. Es hatte die gleiche felsige Hülle, auf der sich die Industrien der Menschen wie ein Muschelbesatz angesiedelt hatten; die Oberfläche war mit den gleichen Andockstationen gespickt, mit breiteren Öffnungen an den vorderen und hinteren Polen. Schiffe und Transportfahrzeuge umschwirrten es wie fette Hummeln. Dazwischen flitzten wie winzige Goldfünkchen Schwärme von Drohnen und Menschen in Raumanzügen umher.
Unter dieser Geschäftigkeit schlummert allerdings ein Problem: Die Schiffskarawane, mit der Chiku unterwegs ist, hat anfangs zu stark beschleunigt. Dass man am Zielplaneten vorbeirasen könnte, ist allerdings ein Wissen, das die Verwaltung geheimhalten möchte. Und das ist noch nicht alles: Der Zielplanet Crucible wurde ausgewählt, weil Teleskope auf ihm eine gigantische künstliche Struktur erspäht hatten. Maschinen wurden der Karawane vorausgeschickt, um ihn für menschliche Besiedlung vorzubereiten. Doch auf Umwegen erfährt Chiku, dass das alles eine große Lüge sein könnte.
Meanwhile on Earth
Derweil bewegen wir uns mit "Chiku gelb" auf der Erde durch edle Locations. Zu Erinnerung: Diese Zukunft ist ein wahr gewordenes Techno-Utopia klassischer Anmutung – es hat sich lediglich der Schwerpunkt des Fortschritts von Europa und Amerika Richtung Afrika und die neubesiedelten Ozeane verschoben. Und wie in einer Utopie alter Prägung ist auch hier ein Schuss Totalitarismus im Spiel: Der auf nanotechnologischer Totalvernetzung beruhende Mechanismus verhindert jede Gewaltanwendung. Kein Wunder, dass die ProtagonistInnen leises Grauen beschleicht, als sie feststellen müssen, dass es jemanden gibt, der Überwachung und Kontrolle manipulieren kann: Die Künstliche Intelligenz Arachne ist in den Mechanismus eingesickert und niemand weiß, was ihre Pläne sind.
Weitere ungewöhnliche Akteure im Roman sind die Tantoren (intelligenzgesteigerte Cyborg-Elefanten), diverse Artilekte (künstliche Rekonstruktionen von Menschen, die individuell handlungsfähig sind) und der manische Wissenschafter/die manische Wissenschafterin Travertine, der/die uns einen neuen Satz Pronomina für ein drittes Geschlecht beschert. "Dier", "xier", "xien" usw. hatten wir glaub ich noch nicht.
Und wie schon im ersten Band spielen auch die Meerleute wieder eine wichtige Rolle: Menschen, die sich körperlich an ein Leben im Ozean anpassen ließen, avantgardistische Forschung betreiben (etwa im Rahmen der Panspermischen Initiative), den Blick hinaus in den Kosmos richten und von der sonnensystemumspannenden Überwachung wenig halten. Hier ergibt sich übrigens eine interessante Parallele zu Frank Herberts "Dune": Der Goldene Pfad von Leto II. Atreides beinhaltete ja auch das Verstreuen der Menschheit über das Universum und die Unsichtbarkeit gegenüber seherischen Kräften. Bleiben wir bei dem Vergleich, dann ist Chikus Großmutter Eunice, die schon im ersten Band an allen Fäden zog, die Bene Gesserit in Personalunion. Mittlerweile ist sie zwar längst tot, aber ein Artilekt von ihr mischt immer noch im Geschehen mit. Wie zuvor gesagt: Die Akinyas und ihre zukunftssteuernde Vergangenheit ...
Über- und Vorausblick
"Duplikat" ist ein beeindruckendes Hard-SF-Panorama, wenn auch ein eher gemächliches. Die ersten zwei Drittel des Romans dienen im Wesentlichen der Vorbereitung auf das, was im dritten geschieht – da ist ein bisschen Geduld gefragt. Im Verhältnis von Breite zu Tempo (eindeutig keine 13 Prozent Lichtgeschwindigkeit) und Thriller-Elementen erinnert es mich eher an die neueren Romane von Paul McAuley als an "Chasm City" und die anderen "Revelation Space"-Titel, mit denen Reynolds bekannt geworden ist.
In seinem neusten Roman dürfte der Autor wieder stärker auf Action gesetzt haben: "Revenger" soll sich um Piraterie und Plünderung in einer Galaxis voller uralter Artefakte drehen; es erscheint am 18. Mai auf Englisch. Auf Deutsch kommt vorher aber noch der Abschluss der Trilogie um die Akinyas heraus. "Poseidon's Wake" soll noch diesen August erscheinen, erneut NDW-mäßig verknappt zu "Enigma". Momentan lesen sich die Heyne'schen SF-Titel wie die Tracklist eines Albums von Ideal – mal sehen, wie lange dieser Trend noch anhält.
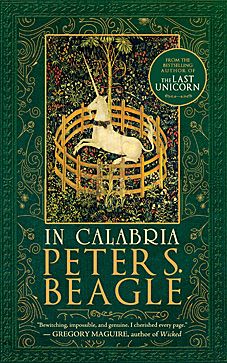
Peter S. Beagle: "In Calabria"
Gebundene Ausgabe, 176 Seiten, Tachyon Publications 2017
Mit "Das letzte Einhorn" hat sich Peter S. Beagle 1968 für immer in die Annalen der Fantasy eingeschrieben. In jüngerer Vergangenheit hatte der heute 78-jährige US-Autor die Magie auch in unsere Welt geholt und Fantasy mit zeitgenössischen oder zeithistorischen Settings verknüpft. Zu "seinen" Einhörnern ist er im Lauf seiner Karriere aber immer wieder zurückgekehrt. Das wunderbare "In Calabria" ist das jüngste Beispiel dafür.
Sympathischer Brummbär
Hauptfigur ist Claudio Bianchi, ein 47-jähriger Bauer im Süden Italiens. Er lebt auf einem abgelegenen Hof mit seinem "theoretischen Wachhund" Garibaldi, Ziegenbock Cherubino (dem De-facto-Wachhund), der dreibeinigen Katze Sophia und ein paar Kühen, denen er mitunter Gedichte vorliest ... allerdings niemals selbstgeschriebene: "They have been raised to have taste."
Obwohl ein herzensguter Mensch mit der Seele eines Poeten, hat ihn das lange Alleinsein erwartbar brummig gemacht. Bianchi – nicht "Claudio", der Autor wahrt stets höfliche Distanz – hat sich in seinem Leben eingerichtet und wünscht keine Störungen. Beagle bringt es perfekt auf den Punkt: Bianchi lernte Sorgen kennen und erinnert sich an Freude – und hofft, keiner dieser zwei alten Belästigungen noch einmal zu begegnen. "Sono contento."
Der Katalysator
Das alles ändert sich, als Bianchi eines Herbsttages in seinem Weingarten ein Einhorn sieht. Zunächst ist er vollkommen ratlos; erst recht, als er feststellen muss, dass sich das Einhorn seinen Hof ausgesucht hat, um ein Junges zur Welt zu bringen. Geradezu rührend, wie Bianchi das magische Geschöpf verzweifelt zu überzeugen versucht, sich dafür einen passenderen Ort – irgendwo, wo es Kultur gebe und man es zu würdigen wisse – auszusuchen. Doch "La Signora", wie er das Einhorn bald nennt, bleibt. Und so macht sich Bianchi schließlich zu dessen Beschützer.
Bald bröckelt seine Routine an allen Ecken und Enden. Da ist zum Beispiel Giovanna, die quirlige junge Schwester seines Briefträgers, die ihn zu besuchen beginnt. Es bahnt sich eine Romanze an. Doch auch andere bekommen Wind vom Einhorn: Reporter, Tierrechtsaktivisten, Hobbyjäger und religiöse Spinner finden sich in Schwärmen ein. Und während Helikopter voller TV-Teams über seinem Hof kreisen (und es trotzdem nicht schaffen, einen Blick auf seinen Gast zu erhaschen), konstatiert Bianchi hilflos, dass das 21. Jahrhundert in sein 19.-Jahrhundert-Leben eingedrungen ist.
Noch einmal leben
Die Stimmung kippt ins Bedrohliche, als sich ein weiterer Besucher einstellt: ein Abgesandter der ’Ndrangheta (der regionalen Mafia-Entsprechung), die ebenfalls ein Auge auf den Hof geworfen hat. Stur, wie er ist, widersetzt sich Bianchi dessen Forderungen – sehr zur Sorge Giovannas und der übrigen Dorfbewohner, die nun der Reihe nach zu seinem einstmals einsamen Hof pilgern. Zu seiner maßlosen Verblüffung stellt Bianchi fest, dass man sich um ihn kümmert. Und dass er plötzlich auch wieder etwas zu verlieren hat.
Phantastik-Abholde hätten kein Problem damit, "In Calabria" rein metaphorisch zu lesen. Giovanna und unerwartete Freunde einerseits, die Gangster andererseits: Das verschmähte Paar Freude und Sorge ist in Bianchis Leben zurückgekehrt. Das Einhorn steht dabei für den Zufall, das Unerwartete und Unbegreifliche (wie die Klimax der Erzählung eindrücklich zeigen wird), das die Veränderung ausgelöst hat. Denn wie wir wissen, findet das Leben immer einen Weg. Und "In Calabria" ist die wunderschöne Geschichte von einem, der noch einmal eine – ebenso unerwartete wie ungebetene – Chance erhält, es zu leben.
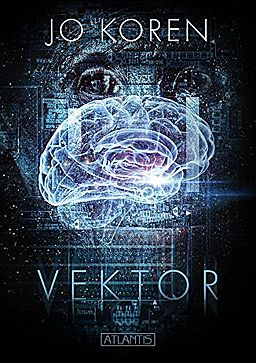
Jo Koren: "Vektor"
Broschiert, 190 Seiten, € 13,30, Atlantis 2016
Wenn gleich auf der ersten Seite eines Romans ein Ausdruck wie "ungeduschte Primaten" vorkommt, bin ich mir relativ sicher, dass die Lektüre Spaß machen wird. Und "Vektor" hat mich diesbezüglich auch nicht enttäuscht. Vorab sei übrigens gleich klargestellt, dass mit besagten Primaten nicht nur Menschen gemeint sind. In dieser Welt des Jahres 2069 sind Menschenaffen dank Hirnimplantaten und Talker-Modulen in die menschliche Gesellschaft integriert worden; was nicht zuletzt bedeutet: in die Arbeitswelt. "Vektor" hat damit eine ähnliche Ausgangslage wie David Brins "Uplift"-Romane oder mehr noch wie Tim Eldreds "Grease Monkey"-Comics.
Korens Fallbeispiel heißt Kit Caramel und ist ein Bonobo, der als Sprechstundenhilfe für die eigentliche Hauptfigur und Ich-Erzählerin des Romans arbeitet: Alpha Novak leitet eine Ambulanz an Bord einer Raumstation im Mars-Orbit. Als "Ärztin für invasive Kybernetik" kümmert sie sich um die in dieser Ära ubiquitären Hirnimplantate, mit denen man seine Leistungsfähigkeit modifizieren kann. Glamourös ist der Job nicht gerade – in Rückblenden wird erzählt, wie und warum Alpha und Kit in einer Blechdose am Rande des Sonnensystems gelandet sind. Dieser Nebenstrang wird im Lauf des Romans annähernd gleich wichtig wie die Haupthandlung werden.
Aus dem Leben einer Medizinerin
Jo Koren ist ein Pseudonym, das nicht allzuschwer aufzulösen ist, da die Autorin auf ihrer hauptberuflichen Homepage auf ihre Schreibtätigkeit eingeht. Wie es die Beschreibung von Alphas Arbeitsalltag erwarten ließ, ist "Koren" selbst im Bereich Medizin und Medizintechnik tätig. Denn "Vektor" liest sich nach jemandem, der entsprechende Erfahrungen gemacht und sich nicht bloß am Schreibtisch überlegt hat, welchen Beruf man der Hauptfigur denn diesmal verpassen könnte.
Das gilt nicht nur für so offensichtliche Passagen wie eine sehr ausführlich beschriebene Obduktion und andere Prozeduren. Es betrifft den ganzen Ton: Wie Alpha mit ihren Patienten umgeht und wie sie ihre Arbeit mit einer Mischung aus trockenem Humor und gebotener Sorgfalt angeht – das wirkt ganz einfach authentisch. Wie sich überhaupt die Beschreibungen dieser Zukunftswelt auf unaufgeregte Weise schlüssig lesen.
Die Invasion der Woche
Zur Haupthandlung: Eines Tages landet ein Minenarbeiter aus dem Asteroidengürtel in Alphas Behandlungszimmer. Sein Herzschrittmacher funktioniert nicht korrekt, doch Alpha identifiziert bald sein Hirnimplantat als das gravierendere Problem. Das scheint sich nämlich ein Computervirus eingefangen zu haben, und ab dieser Erkenntnis geht es recht schnell: Menschen haben kurze Aussetzer, in denen sie gewalttätig werden. Es kommt zu einem Mord, und zu allem Überfluss beginnt auch noch die Raumstation aus unbekannten Gründen schneller zu rotieren.
Dieser Plot könnte eine typische "Star Trek"-Folge abgeben (Typus "das Problem/der Gegner/die Invasion der Woche"). Ein umfassendes Zukunftspanorama ist "Vektor" nicht, dafür aber eine erfrischend eigenständige Geschichte aus der Arbeitswelt der Zukunft. Weitere Romane aus der Welt von Alpha Novak können gerne folgen!
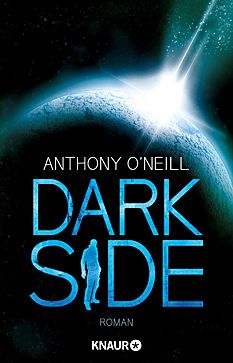
Anthony O'Neill: "Dark Side"
Klappenbroschur, 412 Seiten, € 15,50, Knaur 2017 (Original: "The Dark Side", 2016)
"Stolz und Armut ist Armut": Unter allen Ferengi-Erwerbsregeln war das immer meine liebste. Das erwähne ich hier deshalb, weil Anthony O'Neills ausgesprochen unterhaltsamer Weltraumthriller "Dark Side" in Form des Brass-Kodex mit einem durchaus ähnlichen Leitfaden fürs Leben aufwarten kann. Ein paar Auszüge: "Die Liebe zum Geld ist der Ursprung aller Dinge." Oder: "Lüge. Lüge. Lüge. Aber merk es dir." Oder: "Der Neid der anderen ist ein ewiges Fest." Diese dem Text vorangestellten Lehrsätze stimmen auf den zynischen Inhalt des Romans ein. Und weil von einem der beiden Handlungsfäden das Blut nur so tropft, kommt einem Satz besondere Bedeutung zu: "Wenn du deine Spuren nicht beseitigen kannst, beseitige jene, die sie sehen."
Zur Handlung: In einer nicht allzu fernen Zukunft hat die Erde versuchsweise Langzeithäftlinge auf den Mond geschossen. Dort hocken die Deportierten nun in Ein-Personen-Iglus ohne Kontakt zur Außenwelt. Etwas später hat sich zudem der Milliardär/Wirtschaftsverbrecher Fletcher Brass in einem Gebiet auf der Rückseite des Mondes eingekauft und sich dort sein eigenes Königreich namens Purgatory aufgebaut. Bevölkert hat er es mit Menschen, die auf der Erde in Ungnade gefallen sind. Dass eine Kolonie von Kriminellen einem Autor einfällt, der aus Australien stammt, klingt auf den ersten Blick einleuchtend. Allerdings wollen wir nicht vergessen, dass – Ehre, wem Ehre gebührt – Robert A. Heinlein mit "The Moon is a Harsh Mistress" seinerzeit die gleiche Idee hatte.
"Justice! Justice!"
Purgatory mit seiner Hauptstadt Sin ist zwar kein völlig gesetzloser Ort – aber immer noch der richtige Platz, um alle möglichen illegalen Geschäfte abzuwickeln. Da fehlt eigentlich nur noch ein aufrechter Polizist, der in diese Eiterbeule der Zivilisation versetzt wird. Und schon betritt Lieutenant Damien Justus die Szene. Sein Nachname mag fast schon zu viel des Guten sein ... aber erstens schätzt O'Neill offenbar kalauernde Wortspiele (ein Reporter heißt Nat U. Rally, ein Bordell "Cherry Poppins"). Und zweitens lässt sich dieser Name leicht zu "Justice" verballhornen – genau das wird die Menge skandieren, wenn Justus seine erste spektakuläre Verfolgungsjagd im Stil von Batman hinlegt.
O'Neill hatte zuvor Krimis und Romane mit historischen Settings geschrieben. Für sein SF-Debüt greift er auf beides zurück und gestaltet "Dark Side" als Noir-Thriller. Wozu auch undurchsichtige Machtspiele gehören, in die der Romanheld geraten muss: In diesem Fall ist es der Konkurrenzkampf zwischen Quasi-König Fletcher Brass und dessen nicht minder ambitionierter Tochter QT. Da Fletcher als Nächstes höchstpersönlich den Mars kolonisieren will, entbrennt ein Kampf um seine Nachfolge – und die ersten Leichen, die Justus findet, werden nicht die letzten bleiben.
Parallel dazu verläuft ein Handlungsstrang mit (zwangsweise) wechselnden ProtagonistInnen und einer personellen Konstante: einem Androiden, der Richtung Purgatory über die Mondoberfläche zieht und so gut wie jeden umbringt, der ihm über den Weg läuft. Wozu er die Weisheiten des Brass-Kodex zitiert. Hier ist der Gore-Faktor für einen SF-Roman hoch – noch gruseliger aber ist, wie ansatzlos der stets lächelnde Androide von höflicher Konversation zu vulgären Untergriffen umschwenken kann. Und wenn sein Gegenüber das Gleichgewicht wiedergefunden hat, ist es meistens schon zu spät.
Bilder vom Mond
20th Century Fox hat schon vorab die Rechte auf eine Verfilmung von "Dark Side" erworben. Und O'Neill hätte dafür auch jede Menge wirksamer Bilder zu bieten: Von Brass' architektonischen Vorlieben, die Sin wie einen babylonischen Themenpark wirken lassen ("das alte Mesopotamien als eine Art vorrevolutionäres Havanna") bis zu einer Ausstattung mit Holzschreibtischen und Bakelit-Telefonen ("So ist das hier in Purgatory – alles ziemlich retro."), die unwillkürlich an "Blade Runner"-Art déco denken lässt.
Noir eben, aber unter lunaren Umständen, also mit geringer Schwerkraft. Was nach einem Mordanschlag in einer Landwirtschaftskuppel zu einer herrlich absurden Tatortbegehung führt: In diesem seltsamen Raum. Mit den gepolsterten Decken und den UV-Lampen. Und dem Gras unter seinen Füßen. Mit den Gebirgsblumen. Den Hummeln. Und himmelblauen Wänden mit aufgemalten Wolken, wie auf einem altmodischen Filmset. Ganz zu schweigen von den Ziegen selbst, die durch die ganze Aktivität unruhig geworden sind, vierzig Meter hoch in die Luft springen, regelrecht gegen die Decke krachen – wahrscheinlich ist sie deshalb gepolstert – und anmutig wieder herunterfallen. Abgesehen von all dem Blut sieht es aus wie in einem Zeichentrickfilm für Kinder aus dem Samstagvormittagsprogramm.
Die eindrucksvollsten Bilder dürfte aber der mörderische Androide selbst abgeben, wenn er im schwarzen Anzug (kein Weltraumanzug) durchs Vakuum auf seine Ziele zustapft. Und als wäre er nicht schon verstörend genug, finden ihn seine Opfer in spe auch noch irritierend sexy. Was ihn zugleich zum formalen Widerpart von Justus macht, dem bei einer Säureattacke das Gesicht verätzt wurde.
Empfehlung!
Das soll jetzt aber nicht heißen, dass man am besten auf die Verfilmung (so es denn eine geben wird) wartet. "Dark Side" liest sich nämlich ebenso spannend wie vergnüglich. Selbst die anfänglichen Infodumps sind kurzweilig geschrieben, und in den Dialogen benutzt O'Neill nicht diese leicht sterile SF-Sachlichkeit, in die auch große AutorInnen des Genres gerne verfallen. Stattdessen sprechen seine Figuren – ob nun der herrlich lakonische Justus oder sein obszöner Vorgesetzter Buchanan – individuell und ganz natürlich. Und auch wenn der Zusammenhang zwischen den einzelnen Plot-Elementen am Ende niemanden groß überraschen dürfte, bringt der Roman doch eine angenehm frische Brise ins Genre. Möge es nicht der letzte Ausflug Anthony O'Neills in die Science Fiction gewesen sein.

Charlie Jane Anders: "Alle Vögel unter dem Himmel"
Klappenbroschur, 414 Seiten, € 15,10, Fischer Tor 2017 (Original: "All the Birds in the Sky", 2016)
An Science Fiction hat US-Autorin Charlie Jane Anders bislang zwar nur einige kürzere Erzählungen veröffentlicht (darunter "The Fermi Paradox Is Our Business Model" mit einer wirklich originellen Ausgangsidee). Zumindest indirekt dürfte sie den meisten SF-Fans aber längst bekannt sein: nämlich als Mitbegründerin des Blogs io9, eines unerschöpflichen popkulturellen Reservoirs mit Genrebezug. Nun hat Anders ihren ersten waschechten Phantastik-Roman vorgelegt und vermählt darin Magie und Wissenschaft. Oder zumindest lässt sie sie Koitus haben, wie Sheldon Cooper es ausdrücken würde.
Die Hexe und der Technozauberer
Und das "Big Bang Theory"-Genie findet in "Alle Vögel unter dem Himmel" auch ein würdiges Pendant: Immerhin bastelt sich Laurence Armstead schon im zarten Kindesalter nach einer Online-Vorlage eine Zeitmaschine, die ihn zwei Sekunden in die Zukunft versetzen kann (immerhin genug, um einem Schlag auszuweichen). Später büxt er von zuhause aus, um einen Raketenstart mitzuverfolgen, und macht sich daran, aus Schrottteilen einen Supercomputer zu bauen. Davon konnte Sheldon nur träumen.
Laurences Gegenstück im Roman – in jeder Beziehung – ist Patricia Delfine, die bei der Rettung eines Spatzes feststellt, dass sie die Sprache von Tieren versteht. Offenbar ist sie eine Hexe. Zu ihrem Leidwesen muss sie allerdings sehr lange warten, bis sich ihre Zauberkräfte ein zweites Mal zeigen. Diese Wartezeit zieht sich durch eine lange Kinder- und Jugendzeit, in der die beiden AußenseiterInnen an ihrer Schule von allen gemobbt werden.
Es wird erwachsener
Interessant wird es im – glücklicherweise längsten – Teil des Romans, in dem wir Patricia und Laurence als Erwachsene erleben und in dem endlich die Dinge ins Rollen kommen, die bereits im Klappentext erwähnt werden. Patricia zieht mittlerweile als heimliche Hexensuperheldin durchs nächtliche San Francisco, um Menschen von deren Problemen zu heilen. Laurence hingegen bewegt sich in Hipsterkreisen und arbeitet für einen Elon-Musk-artigen Milliardär, der die Menschheit ins All führen will. Denn im Hintergrund dräuen immer gravierender werdende ökologische und politische Probleme, die die Erde unbewohnbar zu machen drohen.
Fatal nur, dass die beiden Gruppen, die diese Probleme lösen wollen – Patricias Hexenzirkel und Laurences Wissenschafterkreise – völlig unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie das gehen soll. Es bahnt sich ein gewalttätiger Konflikt an, der die beiden ehemaligen SchulfreundInnen vor eine harte Bewährungsprobe stellt. Dabei wissen sie ohnehin nicht, wie sie mit ihrer On-Off-Beziehung und ihren jeweiligen Unsicherheiten umgehen sollen. Dieses Wechselspiel von Annäherung und Distanzierung zwischen den beiden ist zugleich das einzige dreidimensionale menschliche Element des Romans. Die restlichen Figuren bleiben reine Funktionen der Handlung.
Nachdem ich den Roman im Jugendabschnitt beinahe schon abgeschrieben hätte, fängt er sich hier wieder, wird dichter und komplexer und mündet in ein Urban Fantasy/Cyberpunk-Gemisch im Zeichen der Social-Media-Ära. Lauren Beukes' "Zoo City" und William Gibsons Alterswerke standen Pate bei einer Welt, in der Technik und Magie auf verschiedenste Weise miteinander verschmelzen – siehe etwa das sogenannte Caddy, eine Art iPad, das wie ein Glücksamulett zu funktionieren scheint. Auf ein konkretes Subgenre lässt sich der Roman so wenig festlegen wie die Werke von Nick Harkaway ("Der goldene Schwarm").
Die Rezeption
"Alle Vögel unter dem Himmel" ist heuer sowohl für Hugo als auch Nebula nominiert und hat eine kleinere Auszeichnung bereits gewonnen. Das "Time"-Magazin reihte es unter die zehn besten Romane 2016 und das Kritikerecho fiel durch die Bank lobpreisend aus. Die Reaktionen der LeserInnen waren naturgemäß – ihre Zahl ist schließlich viel größer – etwas gemischter. Und auch meine Bilanz fällt durchwachsen aus. Zu diesem Resümee kann man aber offenbar aus entgegengesetzten Richtungen kommen: So störten sich manche daran, dass die schöne Coming-of-Age-Geschichte der ersten beiden Romanteile in eine apokalyptische Haupthandlung mündet – bemängelten also just das, was für mich den Roman noch gerettet hat.
Mit den Jugenderinnerungen kann wiederum ich nichts anfangen. Die Mobbing-Darstellungen sind die plattesten seit "Spiderman 1": ein jahrelanges Sperrfeuer, an dem sich alle beteiligen (selbst Patricias eigene Schwester) und gegen das anscheinend niemand einschreiten will. Auch die Eltern der beiden Hauptfiguren sind Non-Entitäten wie in den "Peanuts"-Comics. Nachdem diese Kapitel darauf getrimmt sind, Sympathie für die Hauptfiguren zu generieren, sollten sich deren Probleme auch echt anfühlen – auf mich wirken sie aber leider aufgesetzt. Insgesamt hätte ich es besser gefunden, diese Kapitel in Rückblendenform über das Buch zu verteilen.
Stimmig?
Was mich ebenfalls nicht überzeugt, ist der Wechsel im Ton. Der Hauptteil passt – Anders wollte sich aber offenbar sprachlich an das jeweilige Alter ihrer ProtagonistInnen anpassen. Was in den ersten beiden Romanteilen auf ein "Dumbing down" hinausläuft, und sowas kriegt selten ein Autor hin. Meistens liest es sich so wie hier: nach jemandem, der erkennbar intelligent, gebildet und sprachgewandt ist und sich entschließt, auf albern zu machen. Inklusive einiger Gags, die eher an Douglas Adams erinnern als an all die AutorInnen, mit denen Anders hier und anderswo schon verglichen worden ist. Wer das Buch liest, kann mir hinterher gerne erklären, was vom eiscremeverliebten, selbsthassenden Assassinen Theodolphus Rose zu halten ist. Und vom "Twist", mit dem er seinen ersten Auftritt hat.
Unterm Strich bleibt "Alle Vögel unter dem Himmel" ein unterhaltsames Buch mit guten Teilen – und solchen, auf die man auch verzichten könnte (die Zuordnung kann komplementär sein, wie wir gesehen haben). Die Handlung ist originell, wenn auch nicht einzigartig: Was den hier gezeigten Mix anbelangt – Science Fiction trifft Hexerei trifft Humor trifft gravierende Probleme der Zukunft trifft Coming-of-Age-Geschichte –, krame ich mal kurz in den Rundschau-Annalen und würde eher Keith Hartmans "The Gumshoe, the Witch & the Virtual Corpse" empfehlen.
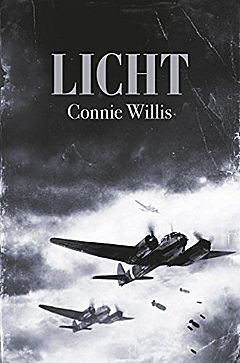
Connie Willis: "Licht"
Klappenbroschur, 850 Seiten, € 24,70, Cross Cult 2017 (Original: "All Clear", 2010)
Na, die Meinungen zum ersten Teil von Connie Willis' Zeitreise-Duologie gingen ja offenbar ordentlich auseinander! (Siehe das Forum der vergangenen Rundschau.) Das kann ich jetzt nicht unkommentiert lassen.
Eine Diskrepanz und ihre mögliche Erklärung
Nachdem der monstermäßig fette Doppelroman reihenweise Preise eingeheimst und "Blackout" auch mir ganz ehrlich ausgezeichnet gefallen hat, liegt hier möglicherweise ein Beispiel für einen wohl unvermeidbaren Effekt vor, der nicht einmal von unseren alten "Wie man eine SF-Rezension liest"-Regeln ausgeglichen wird. Nämlich die Sache mit der Abwechslung. Als beruflich bedingter Sehr-viel-Leser ist man einfach unendlich dankbar für alles, was von formelhaften Erzählweisen abweicht. Das tut Willis hier, indem sie eher auf Soap-artige Handlungsabläufe (inklusive Humor) setzt, anstatt auf das Abenteuer Zeitreise zu fokussieren. Wie schon bei Teil 1 gesagt, würde die Duologie eine hervorragende Grundlage für eine Historien-Serie abgeben.
Andererseits befinden wir uns mit der Science Fiction in der Genreliteratur, in der ein gewisser Grad an Formelhaftigkeit nicht nur unvermeidlich, sondern sogar unerlässlich ist. Das ist in der SF bei weitem nicht so extrem wie in anderen Genreliteraturen (die letzte Romance-Autorin, die zwecks Originalität eine Liebesgeschichte ohne HEA veröffentlicht hat, füttert heute vermutlich unter falschem Namen Pinguine in der Antarktis ...); aber so ein bisschen erwartbar sollte es für den größeren Teil der LeserInnen eben doch sein.
Beispiel Hauptfiguren: Einer der Hauptkritikpunkte an "Blackout" hier und andernorts war, wie inkompetent die ProtagonistInnen seien. So schlimm war's dann auch wieder nicht, finde ich. Und das geschilderte Ausmaß der Hilflosigkeit kommt mir nicht unplausibel vor: Sind die Figuren doch letztlich nichts anderes als wohlbehütete JungakademikerInnen, die plötzlich Kriegsberichterstattung machen. Und dass auch das beste Briefing nicht alle überlebensnotwendigen Informationen enthalten kann, zieht sich ja mit Absicht als roter Faden durch den ganzen Roman. Eigentlich ist das realistischer als die universalkompetenten SuperheldensoldatInnen, deren Abenteuer wir sonst meist lesen dürfen und an deren Skills wir uns offenbar als Standard gewöhnt haben.
Soweit meine Vermutung zur Diskrepanz in der Wahrnehmung von Willis' Roman(en). Lösung für das Problem: gibt es leider nicht.
Weiter geht's
Wer "Dunkelheit" nicht gelesen hat, braucht hier gar nicht erst einzusteigen versuchen. "Licht" schließt nahtlos an die Geschehnisse des ersten Bands an, es gibt weder eine inhaltliche Zusammenfassung von Teil 1 noch ein Namensverzeichnis oder Sonstiges, das als Orientierungshilfe dienen könnte. "Blackout/All Clear" ist in der Tat als ein einziger Roman (von über 1.500 Seiten) zu betrachten.
Unsere drei zeitreisenden HistorikerInnen Polly, Michael und Merope sind mittlerweile vereint – wenn auch nicht glücklich. Sie sitzen im von den Nazis dauerbombardierten London des Jahres 1940 fest, die Vorhänge genannten Portale in die Zukunft wollen sich weiterhin nicht öffnen. Das tun diese nicht, wenn Gefahr besteht, dass sie von Gegenwärtlern gesehen werden könnten. Doch immer mehr fragt sich unser Trio, ob nicht ein anderer Grund dahintersteckt. Da ihre Missionen zunehmend unplanmäßig verlaufen sind, fürchten sie, dass sie durch ihre Handlungen den Zeitablauf verändert haben und es niemanden mehr gibt, der sie in der Zukunft erwartet. (Wir wissen übrigens die ganze Zeit, dass das nicht der Fall ist.)
Polly & Co steigern sich in eine regelrechte Paranoia hinein und durchforsten Zeitungsberichte nach möglichen Diskrepanzen zwischen diesem Jahr 1940 und dem, das sie aus den Geschichtsbüchern kennen. Glauben sie allerdings auf eine gestoßen zu sein, versuchen sie diese auf Teufel komm raus wegzurationalisieren. Zugleich halten sie nach möglichen Rettungsteams Ausschau und richten in Annoncen kryptische Botschaften an mögliche LeserInnen in der Zukunft. Und natürlich läuft auch der Alltag weiter: Vom Einleben in die Etikette der 1940er Jahre über die Vorbereitungen für eine Theateraufführung in Bombenschutzräumen bis zur ständigen Qual mit dem miesen Essen der Pensionswirtin reicht die Palette, während ringsumher weiter die Bomben fallen.
Eine Staffel zu viel des Guten
Insgesamt muss man konstatieren, dass Band 1 um einiges abwechslungsreicher war. Dass sich alle drei Hauptfiguren jetzt die längste Zeit am gleichen Ort aufhalten, nimmt doch etwas Dynamik raus. Und wenn 800 Seiten lang Bomben hageln und Feuer lodern, nutzt sich das auch irgendwann ab. "Licht" erinnert an eine TV-Serie, bei der die Produzenten nach zwei erfolgreichen Staffeln beschlossen haben: Läuft doch prima, schieben wir eine Extrastaffel ein, bevor wir zum vorab konzipierten Schluss kommen. Die erste Hälfte von "Licht" könnte man im Grunde einsparen.
Wirklich spannend wird es dann wieder in der zweiten Hälfte, wenn Willis aus dem Rausch des Immerweiterschreibens erwacht und besagtem konzipierten Schluss entgegensteuert. Dann kommt alles zusammen: Das Rätsel der verschlossenen Portale, die Frage, was aus der Zukunft wurde – und nicht zuletzt auch die Klärung, um wen genau es sich handelt, der da in einigen zwischengeschobenen Kapiteln in den späten 1940er und 1990er Jahren agierte. Hier kommt wieder echtes Zeitreisefeeling auf – und der Eindruck von einem Kreis, der sich schließt.
Trotz (heftiger) Überdehnung in der Mitte bleibt die Duologie unterm Strich empfehlenswert und innerhalb der Phantastik eines der herausragenden Beispiele für die glaubhafte Beschreibung des Alltagslebens in Kriegszeiten. Mit einer der schönsten Widmungen, die ich seit langem gelesen habe: Für all die Krankenwagenfahrer, Brandwächter, Luftschutzkontrolleure, Krankenschwestern, Kantinenbediensteten, Flugzeugspäher, Rettungshelfer, Mathematiker, Vikare, Kirchendiener, Verkäuferinnen, Revuetänzerinnen, Bibliothekare, Debütantinnen, alten Jungfern, Fischer, pensionierten Matrosen, Diener, Evakuierten, Shakespeare-Schauspieler und Kriminalschriftstellerinnen, die den Krieg gewonnen haben.
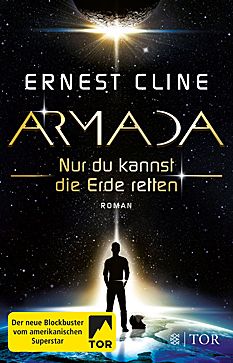
Ernest Cline: "Armada"
Klappenbroschur, 416 Seiten, € 15,50, Fischer Tor 2017 (Original: "Armada", 2015)
"Dein ganzes Leben wartest du schon darauf, dass so etwas passiert. Etwas Wichtiges. Etwas Bedeutungsvolles. Etwas, das dich zum Helden machen kann." Anfangs ist es mir gar nicht so sehr aufgefallen, aber mittlerweile lässt sich im Programm von Fischer Tor ein eindeutiger Young-Adult-Schwerpunkt feststellen. Die ProtagonistInnen der Romane sind entweder in erwachsenenkompatiblem Stil beschriebene Teenager ("Der Winterkaiser", "Apocalypse Now Now") oder sich teeniekompatibel verhaltende Erwachsene ("Die Leben des Tao"). Dazu passt der neue Roman von Ernest Cline wie der Topf auf den Deckel.
Mit "Ready Player One", das Science Fiction, Videospiel-Kultur und 80er-Nostalgie verknüpfte, hat der Autor aus Ohio 2011 einen Welterfolg gelandet, der derzeit von niemand Geringerem als Steven Spielberg verfilmt wird. Da lag für Cline offenbar der Gedanke nahe, noch einmal nach dem Erfolgsrezept aufzukochen.
Die Ausgangslage
Stell dir vor, du sitzt im Klassenzimmer und siehst draußen ein UFO vorbeifliegen. Aber nicht irgendeine anonyme Untertasse, sondern eines, das genauso aussieht wie die feindlichen Kampfschiffe in deinem Lieblingscomputerspiel. Genau das passiert Zack Lightman, einem kurz vor seinem Abschluss stehenden Highschool-Schüler aus Beaverton, Oregon. "Abgefahren", denkt Zack als Erstes, aber dann erinnert er sich an seinen Vater, der starb, als Zack noch ein Baby war. Xavier Ulysses Lightman soll ein Nerd vor dem Herrn gewesen sein, habe elaborierte Verschwörungstheorien über den militärisch-industriell-medialen Komplex entwickelt (wie das seinerzeit in der Killerspiel-Debatte so schön bezeichnet wurde) und habe am Ende seines Lebens nicht mehr zwischen Spiel und Realität unterscheiden können.
Aber natürlich hatte Lightman senior mit allem recht. Das wird Zack spätestens klar, als er von einem Shuttle der Earth Defense Alliance (EDA) abgeholt und zu einer Militärbasis gebracht wird. Ganz wie es sein Vater geahnt hatte, befindet sich die Menschheit seit Jahren in einem Krieg gegen Aliens. Über Computerspiele wie zuletzt das Multiplayer-Rollenspiel "Armada" züchtet sich die EDA Pilotennachwuchs für ihre Kampfdrohnen heran. Irgendetwas an diesem Szenario kommt Zack allerdings fischig vor – und seine Furcht wird zu unserer Hoffnung, dass sich in dem simpel gestrickten Plot doch noch eine weitere Ebene verbergen möge.
Zitate, Zitate, Zitate
"Ender's Game", "War Games" und "Starfight" lassen also grüßen. Immerhin, das muss man Cline lassen, werden diese Vorlagen nicht einfach kopiert, sondern als Bestandteile einer umfassenden Verschwörungstheorie auch explizit genannt – zusammen mit anderen Titeln, die sich um die Vermischung von Realität und Fiktion drehen ("Men in Black", "Galaxy Quest" usw.). Die halbe Popkultur soll sich hier um die Vorbereitung der Menschheit auf den Kontakt mit Außerirdischen gedreht haben.
Und natürlich ist "Armada" wie schon seinerzeit "Ready Player One" eine einzige Verweisschlacht: Ob "Time Bandits" oder "Dune", das Arcade-Spiel "Polybius" oder das "The cake is a lie"-Mem – hier fließt so ziemlich alles, was je an Geekigem produziert worden ist, in direkter oder versteckter Zitatform in die Dialoge der Hauptfiguren ein. Vor einer der obligatorischen Kampfszenen kann das dann so klingen: "Ta ma de!", hörte ich Diehl über das Comm rufen. "Meine verfrakkten Schilde sind weg, weil ich keine Energie mehr hab!" "Alter", sagte Cruz. "Du kannst doch nicht Flüche aus verschiedenen Universen zusammenschmeißen." "Sagt wer?", gab Diehl zurück. "Und was, wenn Battlestar Galactica und Firefly im selben Universum spielen? Hm? Schon mal drüber nachgedacht?"
Geht alles nicht so recht zusammen
Mein Eindruck von "Ready Player One" lautete seinerzeit: Unterhaltungsfaktor hoch, Plausibilitätsfaktor gegen null. Letzteres ist hier nicht anders. Nehmen wir beispielsweise die EDA, in der sich alle eher wie auf einer Gamer-Convention benehmen als wie in einem Vernichtungskrieg. Keine militärische Organisation der Welt könnte auf eine so unernste Weise funktionieren. Als Zack die EDA-Basis betritt, bittet ihn einer seiner Mitkämpfer in spe zum Einstand sogar um ein Autogramm. Da werden Teenagerträume wahr!
Und wie in "Ready Player One" will auch hier die zeitliche Einordnung nicht so recht aufgehen. Immerhin hat sich Cline bemüht, für seine persönliche 80er-Manie diesmal ein glaubwürdigeres Konstrukt zu finden. Die Handlung ist nicht mehr in einer mittleren Zukunft angesiedelt, in der ein Teenager vollkommen willkürlich 60 Jahre alte Popkultur aufgesogen hat, sondern in der Gegenwart. Anders als seinerzeit Wade lebt Zack angeblich die Ära seines Vaters nach. Er bezeichnet sich selbst einmal als Klon seines Vaters und gesteht, dass er aus der Film- und Videospielsammlung vom Dachboden einen regelrechten Schrein in seinem Zimmer eingerichtet hat; Musik und Klamotten inklusive.
Mal ganz abgesehen davon, wie nachvollziehbar einem ein solches Verhalten vorkommt – war es bei näherer Betrachtung wirklich die Ära seines Vaters? Der starb laut Roman 1999 im Alter von 19 Jahren, verbrachte seine Teenagerzeit also in der zweiten Hälfte der 90er. Hätte ein Jugendlicher der ausgehenden Grunge-Ära wirklich Mixtapes (auf Kassette!) von Pudelrock-Bands der 80er aufgenommen? Von Kenny Loggins und Pat Benatar mal ganz zu schweigen ... Oder hätte das nicht eher zu jemandem gepasst, der wie Cline fast ein Jahrzehnt früher geboren wurde?
Das Echo
Andererseits: Derartige Diskrepanzen scheinen schon bei "Ready Player One" kaum jemanden gestört zu haben, sonst wäre der kürzlich bei Fischer Tor neuaufgelegte Roman nicht so ein Erfolg geworden. Also werden wohl auch bei "Armada" (für das ebenfalls bereits Filmrechte erworben wurden) die meisten darüber hinwegsehen.
Trotzdem ist "Armada" von den LeserInnen offenbar nicht ganz so begeistert aufgenommen worden wie sein Vorgänger. Vielleicht waren es die Logik-Löcher, vielleicht die holzschnittartigen Charaktere und Dialoge, vielleicht die klischeehaften Motive (herausragende Väter haben herausragende Söhne, Schwule dürfen sich für Heteros opfern usw.). Vielleicht fehlt dem Buch auch einfach nur der Neuigkeitswert von "Ready Player One". Oder der Charme. Obwohl "Armada" ein Ende hat, das Fortsetzungen ermöglicht, wird es daher niemanden groß überraschen, wenn der durchaus kalkulierend vorgehende Ernest Cline als Nächstes einen anderen Titel angekündigt hat: "Ready Player Two" ...
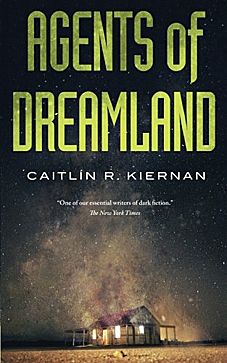
Caitlín R. Kiernan: "Agents of Dreamland"
Broschiert, 128 Seiten, Henry Holt & Co 2017
In der Anglosphäre ist Caitlín R. Kiernan spätestens seit ihrem 2012er Roman "The Drowning Girl" eine anerkannte Größe. Im deutschsprachigen Raum konnte die irisch-amerikanische SF- und Fantasyautorin (und nicht nur ausgebildete, sondern tatsächlich forschende Paläontologin) noch nicht so recht Fuß fassen. Im vergangenen Jahrzehnt brachte Rowohlt zwei Romane um Kiernans fiktive Berufskollegin Chance Matthews heraus ("Fossil" und "Kreatur"). Doch falls das Kalkül war, damit die LeserInnen von Wissenschaftsthrillern anzusprechen, dann ist es nicht aufgegangen: Da ist wohl Kiernans eigenwilliger Stil vor.
Denn Kiernan mag es rätselhaft. Sie streut großzügig geheimnisvolle Andeutungen aus, jongliert mit Motiven und Versatzstücken, widersetzt sich gerne "abgerundeten" Handlungsbögen und überlässt es der Fantasie der LeserInnen, Leerstellen selbst auszufüllen. Dazu kommt noch, dass sie oft auf Romanfiguren in geistigen Ausnahmezuständen setzt. Das ergibt insgesamt eine nebelhafte Atmosphäre, durch die sowohl Romanfiguren als auch RomanleserInnen tappen. Ihre jüngste Erzählung "Agents of Dreamland", die H. P. Lovecrafts Cthulhu-Mythos aufgreift, ist ein typisches Beispiel dafür – und wegen seiner Novellenkürze eine gute Möglichkeit, vorsichtig einen Zeh in den Kiernan'schen Ozean des Unterbewussten zu dippen.
Treffen in der Wüste
Wie um das oben Gesagte zu unterstreichen, beginnt "Agents of Dreamland" mit einem ebenso rätselhaften wie verheißungsvollen Gespräch: Im Diner irgendeines Kaffs in der Wüste von Arizona treffen sich anno 2015 zwei Angehörige zweier verschiedener Geheimdienste, Immacolata Sexton und der "Signalman". Und tauschen sich dort über parasitäre Pilze, die Pluto-Sonde "New Horizons", das Tarot und eine ganze Menge anderer in ihrer Bedeutung noch nicht einschätzbarer Dinge aus.
Später werden wir erkennen, dass der Signalman, der als Kind gerne Monsterfilmmarathons anschaute und sich mit 55 mittlerweile wie ein Dino vorkommt, nur eine Station auf Immacolatas Weg ist. Und dieser Weg erstreckt sich über mehr Jahrzehnte, als Immacolatas Alter eigentlich zulassen dürfte. Sie bezeichnet sich selbst als "Quantenschaumtouristin" und ist auch 1979 in Rhode Island zur Stelle, wo ein unbekanntes Objekt vom Himmel gestürzt ist. Oder 1927, wo man in Vermont eine tote Kreatur gefunden hat, deren Beschreibung Lovecraft-Fans bekannt vorkommen dürfte. Immacolata wird auch in der Zukunft des Jahres 2043 vor Ort sein – aber was sie dort sieht, sei hier nicht verraten.
Der Irrsinn verdichtet sich
Indes leidet der Signalman immer noch unter dem Anblick, der sich ihm kürzlich bei einem Einsatz bot: Als er mit seiner Einheit die Behausung eines irren Sektengurus stürmte, fanden sie dort die pilzüberwucherten Leichen eines Dutzends Teenager. Einblicke in die Vorgeschichte zu diesem Ereignis hat uns die nicht chronologisch erzählte Novelle schon zuvor in einem dritten Handlungsstrang gegeben, in dem Junkie Chloe als Ich-Erzählerin fungiert.
Chloe ist von besagtem Guru, Drew Standish, "auserwählt" und zusammen mit anderen in die Einöde entführt worden. Ihr ohnehin drogenwirrer Kopf wird von Drews fortwährenden Tiraden noch zusätzlich weichgespült. Die Erzählung gerät damit zu einem surrealen Gebräu aus Verschwörungstheorien und pseudoreligiösem Geschwafel:
"How much have you thought about what was really in back of that great digital switchover in 2013? The fact that it was mandatory, I mean. The forced cessation of analog transmissions, the goddamn Digital Television Transition and Public Safety Act of 2005? [...] In every cubic centimeter of the universe there are three hundred photons from the Big Bang. And SETI? That was just some hippie scientist boondoggle, and that's what's really going on here, see. You got these gatekeepers not wanting us to gaze into the oldest fossil in all Creation, the very face of God."
Die Erzählung als geschlossener Raum
Dann werfen wir noch einige Motive aus der Bibel (Jachin und Boas oder der Stern Wermut) und aus einem anderen Schmöker mit dunkler Geschichte (Nyarlathotep, Yuggoth usw.) in den Topf und würzen mit Verweisen auf einen fiktiven Gruselstreifen aus der Stummfilmära: Fertig ist eine hermetische Geschichte, die ein sich fortwährend steigerndes Gefühl der Bedrohung erzeugt, ohne typischen Mustern des Horror-Genres zu folgen. Und die sicher zu den ungewöhnlicheren, aber vor allem sprachmächtigsten Lovecraft-Bearbeitungen der jüngeren Vergangenheit zählt.
Kiernan hat ihren Stil einmal als "awe fiction" bezeichnet. Und auf dieses Staunen wird mehrfach auch Zurückblättern, Nochmallesen und Googeln folgen, um das Gelesene zu sortieren. Weshalb das beeindruckende "Agents of Dreamland" zwar eine für heutige Zeiten kurze, aber nicht notwendigerweise schnelle Lektüre ist.

Michael J. Awe, Andreas Fieberg & Joachim Pack (Hrsg.): "Gegen unendlich. Phantastische Geschichten"
Broschiert, 216 Seiten, € 9,90, p.machinery 2017
Vergangenen Monat hatte ich anlässlich des Kurzgeschichtenbands "Schrecken der Vergangenheit" noch erwähnt, dass ich im steten Strom von Anthologien, die der Verlag p.machinery herausgibt, immer wieder nach versteckten Juwelen suche. Und – täterätä! – hier sind sie schon. Dass die Qualität der Geschichten in diesem Band im Schnitt deutlich über der des anderen liegt, ist freilich kein Zufall. "Gegen unendlich" ist eine Art Best-of einer gleichnamigen Reihe von E-Book-Anthologien, die es seit 2013 auf zwölf Ausgaben gebracht hat. Und doppelte Selektion führt eben zu entsprechenden Ergebnissen.
Der Band enthält 20 Geschichten von ebenso vielen AutorInnen und deckt die volle Phantastik-Palette von Science Fiction über Horror bis zu nicht Einordenbarem ab. Fast alle Erzählungen stammen aus dem neuen Jahrtausend. Einzige Ausnahmen sind eine aus dem Jahr 1986 und eine vom Schauerliteratur-Altvorderen Ambrose Bierce aus dem Jahr 1907 ("Jenseits der Wand"). Die ist natürlich ganz im Stil ihrer Zeit gehalten, der mich allerdings noch nie so wirklich angesprochen hat. Kommen wir lieber zum Moderneren.
Schwarze Perlen
Einen sehr gelungenen Auftakt gibt "Maleks Versteck" von Uwe Durst ab, das auf explizite Phantastik-Elemente verzichtet und stattdessen auf psychologischen Grusel setzt. Malek, ein "Zwerg", entwirft einen ausgeklügelten Mordplan, um seine untreue Ehefrau zu beseitigen. Um ihr Weiterleben vorzutäuschen, schlüpft er in ihre Kleider und identifiziert sich bald so sehr mit der neuen Rolle, dass sein Plan auf faszinierende Weise zum Bumerang wird.
Beeindrucken – nicht zuletzt wegen der hier gezeigten Unbarmherzigkeit – kann einmal mehr auch Peter Nathschläger mit "Menschen im Fels": Eben solche werden eines Tages von den BewohnerInnen eines peruanischen Dorfs entdeckt. Als SF-Leser denkt man unwillkürlich an eine schiefgegangene Teleportation. Was genau über 100 Menschen zum Teil im Felsinneren stecken bleiben ließ, wird aber nie geklärt. Es spielt auch keine Rolle – anders als die leider nur allzu glaubhafte Wendung, die Nathschläger ("Wo die verlorenen Worte sind") seine Geschichte nehmen lässt.
Das Spitzentrio der ersten Hälfte komplettiert der leider vor einem Jahr verstorbene Malte S. Sembten. Seine Horror-Geschichte "languerous@barron.feu" hat eine geniale Prämisse: Eine Liebhaberin alter Bücher entdeckt in einem Band aus dem 19. Jahrhundert, der eine Séance beschreibt, dass der heraufbeschworene Geist als Botschaft eine E-Mail-Adresse hinterließ. Die Folgen sind spannend wie eine der frühen Kurzgeschichten von Stephen King.
Einmal quer durch den phantastischen Gemüsegarten
Soll aber nicht heißen, dass es zwischen diesen drei und den beiden herausragenden Beiträgen am Ende des Bands nichts Lesenswertes gäbe. Norbert Golluch lässt den Protagonisten von "Die virtuelle Familie" Ehefrau und Kinder in Hologrammform ordern – doch kommt die perfekte Familie zum Schluss, dass sie ohne ihn noch perfekter wäre. Nicht witzig, sondern düster ist dagegen "Ödland" von Joachim Pack, in dem Europa zur Wüste geworden ist. Hauptfigur ist ein kleiner Junge, der mit Mutter und Stiefvater auf einem abgelegenen Gehöft lebt, das eines Tages einen geheimnisvollen Besucher erhält. Und kalt-warm besorgt's uns Marc-Ivo Schubert in "Eingesicht trifft Zweigesicht", in dem der alte Ambrac erzählt, wie eines Tages ein Raumfahrer vom Himmel fiel. Die Pointe der (anscheinend im "Perry Rhodan"-Universum angesiedelten) Geschichte ist absehbar, aber dennoch gut.
Eine Brücke zwischen den Subgenres schlägt Ute Dietrich in "Wahnsinnsstern", in dem ein Raumfahrertrio mit seinem Schiff auf einen Stern zustürzt. Das Ergebnis der poetisch angelegten Erzählung ist eine Mischung aus Science Fiction und Geistergeschichte. Der Protagonist von Christian Weis' "Das Blockhaus" verfährt sich nach einer vermeintlichen Abkürzung, landet in einer Waldhütte, die ähnlich abgenutzt wirkt wie ihr wortkarger Bewohner – und ehe er sich's versieht, ist er in einem alten Märchenmotiv gelandet (nein, nicht von den Brüdern Grimm). Jörg Isenberg schließlich setzt als einziger auf Fantasy im engeren Sinn: "Adams Blut" dreht sich um einen Dämonenjäger und dessen Nemesis: klassisches Urban-Fantasy-Repertoire also, aber – trotz einer Prise Gruftie-Pathos – interessant erzählt.
Nicht einordnen lassen sich zwei andere erwähnenswerte Beiträge. Das gleichnishafte "Der Physiker und die magischen Steine" von Hubert Katzmarz hat einen fantastischen Einstieg ("Zu einer Zeit, als die Erde noch eine Kugel war und um die Sonne kreiste, und hieran könnt ihr erkennen, wie lange diese Zeit schon her ist, da lebte ein Physiker ..."), bleibt aber leider die erhoffte Schlusspointe schuldig. Dafür reichen Barbara Hundgeburt in "Spiegelbilder" ganze zwei Seiten, um zielsicher zu verdutzen. Diese Geschichte zu lesen ist ähnlich wie M. C. Eschers "Drawing Hands" zu betrachten.
Glanzstücke
Meine persönlichen Highlights sind die beiden Erzählungen am Ende des Bands. Und obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten, kann ich mich nicht entscheiden, welche mir besser gefällt. Da ist zum einen "Tank 142" von Silke Jahn-Awe: ein Blick in eine grausame Zukunft, in der Menschen durch körperliche Modifikationen zu Biomechanoiden wie autark agierenden Kriechsonden reduziert wurden, um Sternenschiffe zu warten. Ein düsteres Szenario mit einem kleinen Hoffnungsschimmer – schade, dass auf die erstmals 2013 veröffentlichte Erzählung kein Roman folgte. Von Jahn-Awe gibt es allerdings den Sammelband "142-1: Science-Fiction-Erzählungen und Maschinenlyrik", auf den sollte man vielleicht ein Auge werfen.
Vollkommen anders – anders zur Potenz – schließlich das kurze, aber großartige "Da ist ein Mann, der die Gewohnheit hat, mir mit einem Schirm auf den Kopf zu schlagen" von Fernando Sorrentino. Der Titel ist auch schon der Inhalt: Der Erzähler der Geschichte erhält eines Tages einen Stalker der besonderen Art, der ihm ohne jede Erklärung fortwährend sanfte Schläge verpasst und zu einem fixen Bestandteil seines Lebens wird. Ich erinnere mich noch daran, dass mich die Schläge anfangs am Einschlafen gehindert haben; inzwischen glaube ich, dass ich ohne sie gar nicht mehr schlafen könnte. Genial einfach, einfach genial: ein absurdes Kleinod.
Gesamtbilanz des Best-of-"Gegen unendlich": Eine Menge originelle Ideen, großteils – ein paar weniger gelungene Beiträge ausgenommen – ansprechend bis fantastisch umgesetzt. So sollten Anthologien sein.
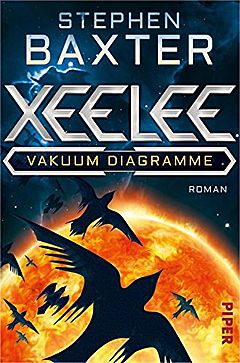
Stephen Baxter: "Xeelee: Vakuum-Diagramme"
Broschiert, 412 Seiten, € 15,50, Piper 2017 (Original: "Vacuum Diagrams", 1997)
Zum Abschluss noch eine Wiederveröffentlichung, die keinesfalls vergessen werden sollte: die "Vakuum-Diagramme" aus Stephen Baxters beliebtem Xeelee-Zyklus. Im Original 1997 veröffentlicht, auf Deutsch erstmals bei Heyne im Jahr 2001 erschienen und nun noch einmal bei Piper herausgekommen (die Übersetzung ist die gleiche).
Im deutschsprachigen Raum haben Kurzgeschichtensammlungen einen noch schwereren Stand als im englischsprachigen. Es gibt nur wenige Beispiele für Sammelbände, die so gut wie alle gelesen zu haben scheinen und ihnen im Bücherregal einen Ehrenplatz neben den großen Romanen einräumen. William Gibsons "Cyberspace" ("Burning Chrome") war so ein Fall in den 80ern. Ted Chiangs "Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes" von 2011 könnte drauf und dran sein, sich einen ähnlichen Status zu erwerben; die Zukunft wird es zeigen. Und zeitlich betrachtet ziemlich genau in der Mitte zwischen den beiden lagen die "Vakuum-Diagramme".
Einstieg ins Xeelee-Universum
Die knapp zwei Dutzend Erzählungen des Bands sind Episoden aus einer Milliarden Jahre umspannenden Future History, Tour-retour-Reise zum Urknall inklusive. Der millionenjährige Krieg, den die Menschheit gegen das technologisch turmhoch überlegene Volk der Xeelee führt, wirkt vor diesem Hintergrund nur wie ein Wimpernschlag. Und mehr ist er für die Xeelee auch nicht. Sie selbst stehen nämlich im Überlebenskampf gegen eine noch mächtigere und noch geheimnisvollere Spezies, die das Universum selbst zu zerstören droht.
"Vakuum-Diagramme" schildert Episoden aus diesem Krieg ebenso wie aus den Zeitaltern davor, als die noch junge Menschheit ihren Weg ins All nahm und in Konflikt mit anderen, weniger gottgleichen Spezies geriet. Einige dieser Erzählungen und der in ihnen vorgestellten Welten haben sich mir nach der ersten Lektüre für immer ins Gedächtnis gebrannt: Etwa "Schale", in dem die Rest-Menschheit von den Xeelee in ein hermetisch verschlossenes Taschenuniversum verbannt wurde. Oder der deprimierende Blick auf das unsagbar öde Ende des Universums in "Die baryonischen Lords".
Nicht zu vergessen auch Erzählungen aus wundersam fremdartigen Welten, an die sich Menschen mit gelinde gesagt extremen körperlichen Modifikationen angepasst haben: In "Blinder Passagier" ist es ein Universum, in dem die Gravitation eine Milliarde mal höher ist als in unserem. Und in "Held" das Innere eines Neutronensterns. Diese beiden Welten waren zudem die Schauplätze zweier populärer Xeelee-Romane aus den frühen 90ern: "Das Floß" und "Flux". "Vakuum-Diagramme" ist damit auch eine ideale Einstiegshilfe, ein Appetizer und Wegweiser in Baxters literarischen Kosmos.
The Good, the Bad and the Rundschau
Die schlechte Nachricht für langjährige Xeelee-Fans: Obwohl Verlage heutzutage "alte" Bücher offenbar als zu kurz empfinden und die Originale gerne um zusätzliche Erzählungen ergänzen, ist dies hier nicht geschehen. Stoff gäbe es reichlich: Weder die Storysammlung "Resplendent" von 2006 noch das hier schon besprochene "Endurance" von 2016 sind bisher ins Deutsche übersetzt worden. Beide sind proppevoll mit Geschichten aus dem Xeelee-Universum und mindestens eine weitere hat Baxter in der Zeit seit "Endurance" auch schon wieder rausgehauen. Die Neuausgabe der "Vakuum-Diagramme" enthält aber keine dieser neueren Erzählungen, sondern ist ident mit der 2001er Version. Wer die nicht zuhause hat, sollte hier aber unbedingt zuschlagen. Ein Klassiker!
Nun die gute Nachricht: Dafür gibt es einen neuen Xeelee-Roman; den ersten seit zwölf Jahren. "Vengeance" wird schon im Juni herauskommen und natürlich in einer der nächsten Rundschauen besprochen werden. Ein kurzer Ausblick auf den Inhalt: So ganz egal war die lästige Menschheit den Xeelee offenbar doch nicht, denn nach ihrer Flucht aus dem Universum sind ein paar von ihnen zurückgeblieben, um Rache zu nehmen. Sie wollen, wie sie es schon einmal getan haben, die Zeit zurückdrehen und den Lauf der Geschichte ändern. Ihr Zielobjekt ist jener Mann, der der Menschheit einst den Weg in die Zukunft geebnet hat und an einigen entscheidenden Punkten in der Geschichte des Universums zur Stelle gewesen ist: Michael Poole, Hauptfigur der zentralen Xeelee-Romane "Ring" und "Das Geflecht der Unendlichkeit". Team Xeelee, sammelt euch!
Zuletzt noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Rundschau: Im Rennen um das spannendste deutschsprachige SF-Programm hat diesen Frühling wieder Heyne die Nase vorn. Zu den hier schon vorgestellten Büchern kommen beim nächsten Mal unter anderem noch die neuen Romane von Sylvain Neuvel und Ian McDonald (beides Fortsetzungen vielversprechender Auftaktbände). Und auf Englisch sind unter anderem neue Titel von Cory Doctorow, Jeff VanderMeer und John Scalzi auf dem Markt. Die Qual der Wahl! (Josefson, 13. 5. 2017)