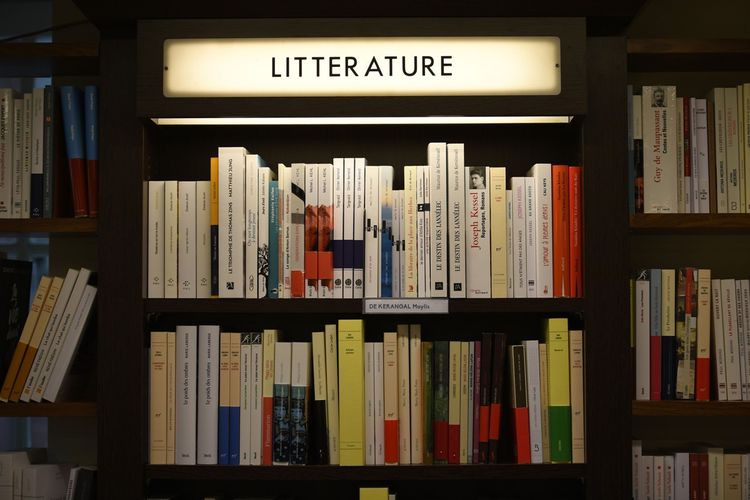Unschwer ließe sich argumentieren, dass eine Buchmesse in Frankfurt mit einem Ehrengast Frankreich nie so wertvoll war wie heute. Brexit, Migrationskrise und islamistischer Terror lasten schwer auf dem Alten Kontinent. Emmanuel Macron ruft zur Neugründung der EU auf und tritt vehement in die Pedale des deutsch-französischen Tandems. Einen geeigneteren Zeitpunkt, sich zu vergewissern, was Frankreich für Europa und die Welt bedeutet, gibt es kaum. Und wer wäre berufener, in einem Land mit einer solch ungeheuer reichen literarischen Tradition darüber Auskunft zu geben, als seine Schriftsteller?
Die auf der Website der Frankfurter Buchmesse aufgelisteten Kennzahlen des franko-germanischen Literaturverhältnisses ist imposant: Die Anzahl der zwischen Dezember 2016 und September 2017 ins Deutsche übersetzten Bücher hat die 500er-Schwelle durchstoßen, ein für die Buchmesse zusammengestelltes Booklet, in dem die betreffenden Werke mit jeweils ein paar Zeilen vorgestellt werden, umfasst 130 Seiten. In den vergangenen Wochen sind mitunter auch im ALBUM Rezensionen zu Übersetzungen neuer französischer Literatur ins Deutsche erschienen, um auf hervorstechende Neuerscheinungen hinzuweisen. Weil eine flächendeckende Auseinandersetzung mit dem Gebiet nicht zu leisten ist, bezweckt dieser Artikel hier nicht mehr, als mittels einiger rezenter, aber auch älterer Lektüreeindrücke dem einen Leser oder der anderen Leserin Lust darauf zu machen, sich in ein einschlägiges Buch zu vertiefen.
Zunehmend ahnungslos
Warum sich mit französischer Literatur beschäftigen? Um sich der Krankheit des "Europrovinzialismus" zu entziehen, zum Beispiel. In einer legendären Merkur-Artikelserie aus den 1990ern, welche sich mit den Erscheinungsformen des Provinzialismus beschäftigte, ortete Karl Heinz Bohrer speziell in Deutschland "eine trotz Tourismus und Informationszeitalter zunehmende Ahnungslosigkeit von den politischen, strukturellen, kulturellen und psychologischen Differenzen der europäischen 'Bruder'länder".
Diese Ahnungslosigkeit führte der stets kampflustige deutsche Literaturwissenschafter nicht zuletzt darauf zurück, dass "die Anzahl der des Französischen Mächtigen seit einer Epoche deutlich zurückgegangen ist". Und weiter: "Die Unkenntnis des Französischen impliziert vor allem die Unkenntnis einer besonders intellektuellen nationalen Zivilisation, so wie die bessere Kenntnis des Englischen heute keineswegs mehr ein tieferes Verständnis der angelsächsischen Kultur, sondern allenfalls gewisse technisch-ökonomische Kenntnisse bedeutet." Indizien, dass sich an Bohrers Befund ein Vierteljahrhundert später viel geändert hätte, gibt es kaum.
Des Französischen "mächtig" zu sein ist freilich kein Kinderspiel, wie der doch in einem Naheverhältnis zu ihm stehende Autor dieser Zeilen berichten kann. Eine meiner Töchter und meine Nichte sind mit Franzosen liiert; im Gegensatz zu mir werden ihre Kinder das Privileg genießen, perfekt zweisprachig, bilingue aufzuwachsen. Ich habe Französisch an der Universität studiert, an der Schule unterrichtet. In unterschiedlichen Lebensphasen habe ich summa summarum sicher mehr als zwei Jahre in Frankreich verbracht. Jeder Aufenthalt in diesem großartigen – und schwierigen – Land war und ist für mich ein mit nichts anderem zu vergleichendes Tonikum, und eine Herausforderung dazu.
Balzac oder Houellebecq schaffe ich einigermaßen problemlos im Original, auch wenn sich der Einstieg in die Lektüre nach längeren Phasen der Frankreichferne, die es immer wieder gibt, mühsam gestaltet. An Claude Simon, den ich liebe, scheitere ich konstant. Von meinem Hausgott Flaubert muss ich zumindest jedes dritte Jahr einen seiner Romane wiederlesen, um des Lebens froh zu werden, was darin resultiert hat, dass ich Madame Bovary sechs oder sieben Mal gelesen habe (das geht in der Originalsprache, an Salammbô mit seinen ausschweifenden Beschreibungen des antiken Karthago hingegen beiße ich mir die Zähne aus). Wessen Französisch nicht gut genug ist, die Madame Bovary, dieses ewige Meisterwerk des Bosnigls aus Rouen, auf Französisch zu lesen, sollte, ein erster Lektüretipp, unbedingt zur sensationellen Übersetzung von Elisabeth Edl greifen.
Wer ein Land ein wenig besser kennt, kann sich oft zu einem qualifizierten Erstaunen legitimiert fühlen, das als erster Schutzwall gegen europrovinzielle Versuchungen gute Dienste tut. Worüber ich mich nicht genug wundern kann, ist, dass ein Presseprodukt wie Charlie Hebdo, das ich für unübersetzbar gehalten hätte, im deutschen Sprachraum Fuß fassen konnte. Erstaunlich ist, dass in Frankreich die Wahl eines Wörterbuchs ein politisches Statement ist: Der 1967 im herannahenden Revolutionsgrollen gegründete Petit Robert, welcher heuer mit einer prächtig illustrierten Neuauflage seinen fünfzigsten Geburtstag feiert, gilt als Wörterbuch der Linken, weil er etwa weniger Berührungsscheu mit ausländischen Neologismen kennt als vergleichbare Lexika.
In den Gefilden der großen Literatur wurden in den vergangenen zwanzig Jahren drei Franzosen mit dem Nobelpreis bedacht: Patrick Modiano (2014), Jéan-Marie Gustave Le Clézio (2008) sowie der Franko-Chinese Gao Xingjian (2000). Diese mehr als zufällige Häufung hat gewiss auch mit der exzellenten Infrastruktur zu tun, die Frankreich für die Literatur ausrichtet. Ein erstaunliches Feature ist etwa die "Rentrée litteraire", die konzertierte öffentliche Leistungsschau der Büchermenschen, welche in Frankreich mit der "Rentrée scolaire", der Rückkehr der Schüler aus den Ferien, synchronisiert wird. Damit wird ein angestrebtes Naheverhältnis der geistigen und erziehungspolitischen Sphären der Nation quasi dick mit rot-weiß-blauer Farbe unterstrichen.
Während die literarischen französischen Herbstgepflogenheiten ihre Pendants im deutschsprachigen Raum haben (Deutscher Buchpreis, Buch Wien etc.), ist es erstaunlich, dass es dort keine mit der Bibliothèque de la Pléiade zu vergleichende Institution gibt. In der "Pléiade" zu erscheinen ist gewissermaßen die absolute Richtschnur, ob es jemand in den Literatenhimmel geschafft hat.
Ob Virginie Despentes in Zukunft irgendwann einmal zu Pléiade-Ehren kommen wird, kann niemand sagen. Evident hingegen ist, dass die Karriere der 48-jährigen "Skandalautorin", die der Nation 2002 mit ihrem Sexschocker Fick mich (Baise-moi) ein Feuchtgebieteerlebnis bescherte, steil bergauf geht. Seit 2016 sitzt das ehemalige Enfant terrible in der Académie Goncourt, und außerdem hatte sie mit ihrer Romantrilogie Vernon Subutex einen enormen Erfolg. Vernon schildert die Odyssee eines abgebrannten Schallplattenhändlers zu diversen Menschen, die in seiner Vergangenheit eine Rolle gespielt haben. Die meisten von ihnen sind ebenfalls nicht vom Glück geschlagen.
Boshaftes Panorama
Weil dieses Romankonzept den Anspruch erkennen lässt, eine gewisse gesellschaftliche Breite abzubilden, war von Despentes gelegentlich schon als einem neuen Balzac die Rede, was freilich grotesk überzogen ist. Als streckenweise pointiertes und boshaftes Gegenwartspanorama hat Vernon – vorläufig ist erst der erste Band ins Deutsche übertragen – aber seine Meriten. Im deutschen Text kommt das schöne Wort "Engländerkapuze" vor, was unverständlich ist, wenn man nicht weiß, dass die capote anglaise ein salopper Ausdruck für das Präservativ ist. Wahrscheinlich scheute die Übersetzerin vom gebräuchlicheren Ausdruck "Pariser" zurück.
Etliches im Despentes'schen Romankosmos – die allgegenwärtige Angst vor dem Alter, die Vorliebe für das kräftige Wort – erinnert an den bekanntesten französischen Gegenwartsschriftsteller, Michel Houellebecq, der in Frankfurt als offizieller Redner auftreten wird. Houellebecqs Bücher sind, obwohl sie sich auch international verkaufen wie geschnitten Brot, ironischerweise Bücher, deren Kern viel "französischer" ist, als das ihr grenzüberschreitender Erfolg vermuten ließe. Natürlich ist Unterwerfung so erfolgreich, weil es das global relevante Thema "Islam" behandelt. Unterwerfung behandelt aber ebenso in extenso die Finessen und Fallstricke der französischen Innenpolitik, die Werke von Joris-Karl Huysmans oder das französische Hochschulwesen. Vorsicht vor der europrovinzialistischen Ausblendung dieser nicht ganz so einfach zu verstehenden gallischen Spezialitäten ist geboten!
Einen neuen Roman wird Houellebecq nicht mitbringen, wohl aber ein schmales Bändchen über Schopenhauer, zu dem er in Liebe entbrannt ist. Als alternativer Großprosaist bietet sich Laurent Binet an, der in seinem Buch Die siebte Sprachfunktion einen intellektuellen Großkarneval entfaltet. Binets literarische Verfahrensweise ist die Unverschämtheit. Er krallt sich teils quicklebendige, teils verstorbene Repräsentanten des französischen Geisteslebens, nennt sie, Sollers, Derrida, Kristeva usf., ungeniert beim Klarnamen und verstrickt sie nach dem Unfalltod des Starsemiotikers Roland Barthes, der 1980 in Saint-Germain von einem Lkw-Lenker zu Tode gefahren wurde, in eine Kriminalhandlung, bei der ein Kommissar zu einem möglichen Mordanschlag auf Barthes recherchiert
Da kommt es bei Binet dann schon einmal vor, dass sich Michel Foucault in einer Schwulensauna von einem jungen Adoranten eine Pfeife anmessen lässt. Binets Witzen mangelt es nicht an teils amüsanten Gallig- und Garstigkeiten über die französischen Mandarine. Das Grundgerüst des Romans ist aber zu schwach, als dass es die Handlung über mehr als 500 Seiten durchtrüge. Um die Lektüre bis zum Schluss zu genießen, muss man ein veritabler Hardcore-Kenner des französischen (Post-)Strukturalismus sein.
Vom fiktiven zum tatsächlichen Verbrechen: Es mag ein Vorurteil sein, aber die Franzosen pflegen eine größere Zuneigung zum Chronikteil ihrer Zeitungen als unsereiner. Der für die Chronik gebräuchliche liebevolle Kosename "Pages du chien écrasé" ("die Seiten des überfahrenen Hundes") spricht Bände. Bei Zsolnay ist eine exzellente Darstellung eines Kriminalfalls erschienen, der die französische Öffentlichkeit über Jahrzehnte hinweg beschäftigt hat. 1977 verschwand Agnès Le Roux, Tochter aus einer reichen Familie in Nizza, spurlos, ihr Anwalt Maurice Agnelet geriet in Verdacht, sie ermordet zu haben. Die Pointe des Falles war, dass Agnelet seinen Sohn gleich nach dem Verbrechen quasi en passant eingeweiht hatte und dieser somit in einem quälenden Dilemma zwischen Familienloyalität und Geständnisdrang stand. Pascale Robert-Diard, Gerichtsreporterin bei Le Monde, hat diesen Fall auf 160 Seiten so geschildert, dass er, wie viele gute Chronikgeschichten, eine veritable existenzielle Komponente bekommt. Auch ein interessanter Pfad, um sich im heurigen Herbst Frankreich zu nähern. (Christoph Winder, Album, 7.10.2017)