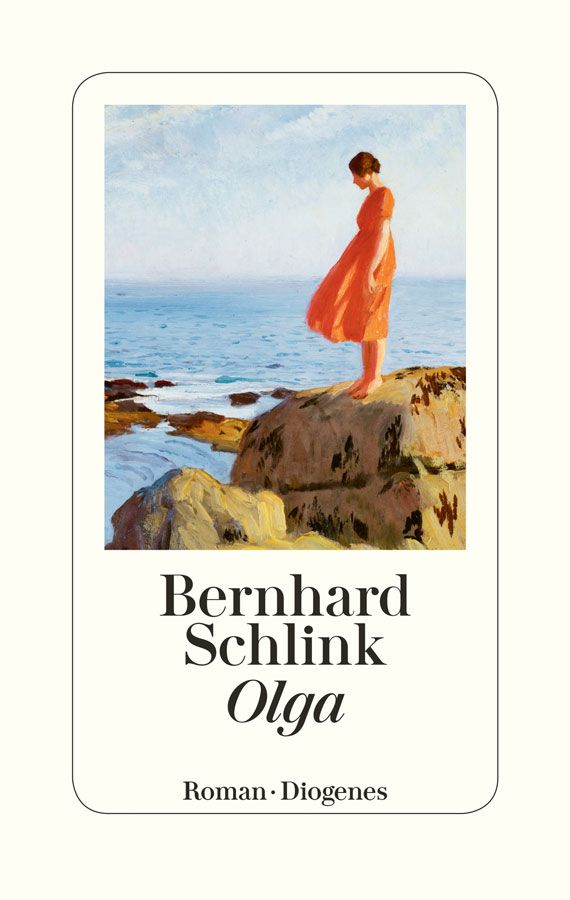Wien – Der Mechanismus der Weltaneignung ist offenbar rasch erklärt. Er steht auf niedlichen Kleinkinderbeinen. Herbert ist Gutsbesitzersohn in Pommern. Sein schändlich kurzes Leben – Herbert Schröder wird dreißig Jahre später in der Arktis verschwinden – beginnt der Bub als Eroberer, der noch vor dem sachgerechten Gehen das Stürzen erlernt. Nie konnte es dem Dreikäsehoch schnell genug gehen. Also "hob er den einen Fuß an, ehe er den anderen abgesetzt hatte, und fiel hin".
Doch geht es da wirklich mit kindgerechten Dingen zu in Bernhard Schlinks neuem Roman Olga? Herbert erblüht rasch zum Forrest Gump des wilhelminischen Zeitalters. Er läuft, aus Spaß und in Begleitung seines treuen Hütehundes, mit Preußens Dampfloks um die Wette. Der Strich des Horizonts versetzt den geborenen Unruhegeist erst in Anspannung, dann in Bewegung.
Olga, die Waise aus der Nachbarschaft, betrachtet ihren späteren Geliebten, den scheinbar nichts und niemand aufhalten kann, mit einer Mischung aus Bewunderung und Unwillen. Auf ihren als ausladend beschriebenen Schultern ruht Schlinks ganze, reichlich fragil anmutende Romankonstruktion.
Olga darf – was noch keiner Figur bekommen ist – für die guten Seiten einer insgesamt desaströsen Entwicklung einstehen. Zur Disposition des Romans steht Deutschlands verhängnisvoller Dreisprung: vom Nationalismus (und Kolonialismus) weiter zum Republikanismus, von dort hinüber in den Nationalsozialismus.
Olga arbeitet sich gegen Widerstände in ihrer engherzigen Umgebung zur Lehrerin hoch. Ihre sachliche Art nimmt den Leser sofort für sie ein. Sie bindet ihr Haar zu einem Dutt hoch und absolviert mit Bravour den zweiten Bildungsweg. Ihre Beziehung zu Herbert ist von schmerzlichen Unterbrechungen gekennzeichnet. Der junge Fant kann nämlich nicht ruhig sitzen. Er kämpft in Deutsch-Südwestafrika gegen die Herero und überlebt in Südamerika einen normalerweise letalen Schlangenbiss.
Niemand kann Herbert bezähmen, am wenigsten sein ihn nicht heiratendes Weib. Dabei fragt sie ihn auf einem seiner Heimaturlaube schön langsam verzweifelt: "Die Weite? Die Weite ohne Ende? Ist es das?" Wenn er das nur selbst wüsste! Ein schmerzlicher Zug umspielt Herberts Mund, als er beschließt, die Gegend um Spitzbergen zu erkunden und die arktische Nordostpassage zu befahren.
Lob der Solidität
Olga hilft ihm noch beim Abfassen von Vorträgen. Er bittet die Knasterbärte der vorletzten Jahrhundertwende um Geld und reist unter reger Anteilnahme der Öffentlichkeit in den höchsten Norden, dann ist betrüblicherweise Schluss mit Herbert, und Schlinks Roman ist da erst zu einem Drittel fertig. So viel scheint klar, die Welt kehrt sich nachdrücklich gegen diejenigen, die meinen, sie sich untertan machen zu müssen.
Olga hingegen verkörpert etwas Grundsolides, vielleicht das störrische Vernunftprinzip der jüngeren deutschen Geschichte. Nach ihrer Flucht aus Ostpreußen verdingt die Ertaubte sich als Näherin. Sie freundet sich irgendwo in der Gegend von Heidelberg mit einem Pastorensohn an. Es sind dessen umständliche Nachforschungen, die posthum Olgas Geheimnis als treusorgende Mutter und als ungeschickte Terroristin lüften. Die galoppierende Ermattung des Lesers ist mit solchen Salti in die Irrealität kaum mehr abzuwehren.
Schlinks treuherzige Breitwandmalerei deutscher Befindlichkeiten spart keine Trugschlüsse aus. Auch wirbt sie mustergültig für die zu Unrecht verunglimpften Ideale von Redlichkeit und Selbstbescheidung. Dieses Hochamt der Mäßigung wird – trotz mehrerer forcierter Wechsel der Erzählperspektive – abgehalten wie eine Andacht in einer ungeheizten Kirche. Man ist heilfroh, wenn die Veranstaltung vorüber ist. Jetzt muss es, wie beim Vorleser, wieder die Verfilmung herausreißen. (Ronald Pohl, 24.1.2018)