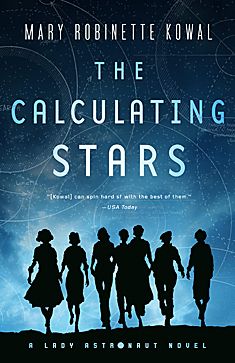
Mary Robinette Kowal: "The Calculating Stars"
Broschiert, 431 Seiten, Tor Books 2018, Sprache: Englisch
Margot Lee Shetterlys Sachbuch "Hidden Figures" über die vergessenen Mathematikerinnen der NASA wurde 2016 zum Welterfolg, erst recht nach der Verfilmung. Schon zuvor hatte US-Autorin Mary Robinette Kowal 2013 ihre preisgekrönte SF-Novelle "The Lady Astronaut of Mars" veröffentlicht. Das nun in Form einer Duologie nachgereichte Prequel ist aber unverkennbar von "Hidden Figures" beeinflusst worden. Denn "The Calculating Stars" ist vieles: ein Zeitporträt der Pionier-Ära, eine Familiengeschichte, eine Apokalypse und ein Alternativweltroman. Vor allem aber ist es ein Hohelied auf die astronautische Infrastruktur und auf die tausenden Menschen am Boden, deren Anstrengungen den Höhenflug einiger weniger ermöglichen.
Alternativweltgeschichte deshalb, weil Kowal ein paar Modifizierungen an der Historie vornehmen musste, um die letztlich in "The Lady Astronaut of Mars" mündende Zeitlinie zu ermöglichen. So wurde in ihrer Welt 1948 Thomas E. Dewey statt Harry Truman zum Präsidenten der USA gewählt – ein praktischer kleiner Trick, denn der war in Sachen Weltraum innovationsfreundlicher gestimmt, und das wird auch schon bald dringend gebraucht: 1952, wenn die Handlung einsetzt, zweigt Kowals Geschichtsverlauf nämlich endgültig ab. Ein Asteroid schlägt vor der Küste von Maryland ein und richtet enorme Verwüstungen an. Doch das war nur der Anfang: Wie sich herausstellt, setzen die vom Einschlag verdampften Wassermengen einen unaufhaltsamen Treibhauseffekt in Gang, der die Erde mittelfristig unbewohnbar machen wird. Die Menschheit muss den Weltraum erobern, um zu überleben.
Rollenverteilung
Hauptfigur und Ich-Erzählerin Elma York ist im Zweiten Weltkrieg als Rettungspilotin Einsätze geflogen, inzwischen arbeitet sie als Mathematikerin respektive als Computer bei den Raketentests des NASA-Vorläufers NACA. An ihrer Kompetenz auf beiden Gebieten kann keinerlei Zweifel bestehen. Doch Elma musste das Gleiche erleben wie Peggy in der Marvel-Serie "Agent Carter" (und natürlich unzählige Frauen in der Realität): Im Krieg wurde die Arbeit der Frauen gebraucht, doch nun sollen sie möglichst wieder in untergeordnete Rollen zurückgedrängt werden. Während nach dem Ersten Weltkrieg die Frauenrechte einen Aufschwung erlebten, folgt nach dem Zweiten ein gezielter Backlash.
Selbstverständlich lässt Elma das nicht auf sich sitzen. Unterstützt von Ehemann Nathaniel, der sie fachlich wie auch privat als gleichgestellte Partnerin behandelt, sammelt sie gleichermaßen unzufriedene wie kompetente Mitstreiterinnen um sich, um Lobbying für Frauen im Weltraumprogramm zu betreiben. Wie auch für Angehörige ethnischer Minderheiten: Dass die Gesellschaft ihrer Zeit nicht nur sexistisch, sondern auch rassistisch ist, hat Elma spätestens bei den Evakuierungen nach dem Einschlag festgestellt, die ganz auf die Wohngebiete von Weißen konzentriert waren.
Der Plot schreitet damit auf allen Ebenen im Gleichtakt voran: Auf der technologischen Seite sorgt die neugegründete International Aerospace Coalition dafür, dass die Eroberung des Weltraums trotz kleinerer Rückschläge einen Erfolg nach dem anderen verbucht, vom ersten bemannten Raumflug über den Bau einer Weltraumstation bis zur Landung auf dem Mond. Auf dieser Ebene lässt uns "The Calculating Stars" den Geist der Weltraumpionier-Ära gleichsam im Zeitraffer nacherleben; den Kapiteln vorangestellte Nachrichtenmeldungen schildern parallel dazu, wie sich die globale Klimaveränderung auswirkt. Und auf der gesellschaftlichen Seite setzen Elma & Co langsam, aber doch ein Umdenken in Gang.
Eine Heldin wie du und ich
Dankenswerterweise verfällt Kowal trotz gesellschaftspolitischer Agenda nicht in Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Elma ist keine von diesen supertoughen Superfrauen, die seit ein paar Jahren das Genre überschwemmen und längst zu einem ähnlichen Klischee geronnen sind wie die superpatenten Ehefrauen in der TV-Werbung, die stets mit einem Lächeln (und natürlich dem richtigen Produkt) das Problem lösen, an dem der ungeschickte Gatte gescheitert ist. Man versuche mal, einen Spot mit umgekehrter Besetzung zu finden ... aber zurück zum Buch: Wir lernen Elma zwar rund um den Einschlag als keck und kompetent kennen, werden aber bald feststellen, dass sie mit dem anfänglichen Bravado auch den Schock über die Katastrophe und den Verlust unzähliger Menschen überspielt hat; nicht zuletzt den ihrer Familie.
Und so sicher sie sich auch in ihrer Arbeit fühlt – Auftritte in der Öffentlichkeit bereiten Elma Übelkeit. Wenn sie vor einer Gruppe sprechen muss, rezitiert sie im Kopf die Stellen von Pi oder die Primzahlenfolge, um sich zu beruhigen. Und dass sie als Galionsfigur der Astronautinnen-Bewegung langsam, aber sicher zum Medienstar wird, sieht sie auch mit sehr gemischten Gefühlen. Yes, I wanted to change the public perception about women in space and our ability to be astronauts, but I had not wanted to be a pinup girl for spaceflight.
Grautöne
Auch Elmas großer Gegenspieler, Colonel Stetson Parker, wird nicht so eindimensional gezeichnet, wie man befürchten hätte können. Er ist zwar gewissermaßen die Verkörperung des Sexismus und tut alles, um Elmas Ambitionen auszubremsen. Doch obwohl er sie regelmäßig zum Zähneknirschen bringt, muss Elma doch anerkennen, dass auch er mit Kompetenz und Leidenschaft am Weltraumprogramm arbeitet.
Und was vorurteilsfreie Denkweisen betrifft, müssen selbst die Romanhelden noch Lernprozesse durchmachen. Elma und Nathaniel werden nach dem Einschlag bei einem afroamerikanischen Ehepaar einquartiert. Und obwohl sich daraus rasch eine Freundschaft entwickelt, bleibt die eine oder andere Beklommenheit nicht aus, wenn Angehörige zweier bislang separierter Welten – hier schwarz, da weiß und jüdisch – zum ersten Mal zusammenleben. Unwissenheit und Stereotype sind auf beiden Seiten vorhanden, da entfleucht einem trotz besten Willens schon mal eine geistlose Bemerkung, die heute als "micro-aggression" gewertet würde.
Empfehlung
Nach dem buchstäblich explosiven Auftakt schlägt "The Calculating Stars" ein eher gemächliches Tempo an; Action-Liebhaber werden vermutlich nicht zufrieden sein. Nichtsdestotrotz fand ich Kowals Geschichte ausgesprochen spannend, und das Tempo ist dem Inhalt angemessen – handelt es sich doch um die minutiöse Schilderung einer Gesellschaft, die sich in Bewegung setzt: räumlich wie auch geistig.
Eine Bemerkung noch: Für eine Geschichte, die derart von Weltraumbegeisterung getragen ist, halten wir uns äußerst wenig tatsächlich im All auf. "The Calculating Stars" ist der Froschperspektive auf die Sterne gewidmet. Den weiteren Weg schildert dann die Fortsetzung "The Fated Sky", die die Duologie vollenden wird und – Achtung! – bereits im August erscheint.
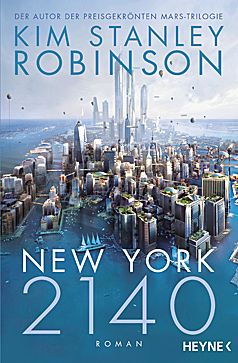
Kim Stanley Robinson: "New York 2140"
Broschiert, 813 Seiten, € 17,50, Heyne 2018 (Original: "New York 2140", 2017)
Oi, ein neuer Kim Stanley Robinson. Da ist die Vorfreude immer mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor verknüpft. Die letzte Veröffentlichung auf Deutsch, "Aurora", zeigte, dass KSR sehr wohl dazu in der Lage ist, eine fokussierte Erzählung abzuliefern, wenn er nur will. Für das davor erschienene "2312" brauchte man hingegen einen langen Atem (und während dessen prätentiöser Exkurse ein Sauerstoffzelt). Was also würde es diesmal werden? Die Titelgestaltung ließ schon vorab vermuten, dass KSR wieder ganz nach der Machart von "2312" vorgehen würde. Glücklicherweise ist ihm die Wiederholung aber nicht hundertprozentig gelungen.
Jahr und Schauplatz werden im Titel genannt. Wir befinden uns in einer Zeit, in der der Meeresspiegel nach zwei globalen Flutwellen wieder zur Ruhe gekommen ist, wenn auch auf 15 Meter höherem Niveau. New York ist seit damals zu weiten Teilen überflutet, aber beharrlich bei Business as usual geblieben. Im neuen Supervenedig ragen Wolkenkratzer aus dem Wasser, zwischen denen der Verkehr via Hochbrücken, Luftschiffe und vor allem Boote so dicht ist wie eh und je: Wie an den meisten Wochentagen ließ ich den Wasserläufer auf der Twenty-Third nach Osten zum East River schnurren. Der Weg durch die südlichen Stadtkanäle wäre zwar kürzer gewesen, aber schon kurz nach Tagesanbruch herrschte auf der Park Avenue Richtung Süden immer ein grauenvoller Verkehr, und am Union-State-Bacino würde es umso schlimmer sein. Echte New Yorker lassen sich eben von nichts unterkriegen, auch nicht vom Untergang.
Die Handlung
Es gibt eigentlich keine.
Die Personen
KSR legt "New York 2140" als Panorama an und verteilt dieses über die Erzählstränge von acht Einzelpersonen respektive Duos; ein voller Umlauf dauert jeweils etwa 100 Seiten. Alle Protagonisten leben im selben Wolkenkratzer, dem Met Life Tower am Madison Square. Entsprechend eng vernetzt sind ihre Geschichten – nicht nur, aber auch, weil das Met genossenschaftlich geführt wird, inklusive Vorstandstreffen, Mitgliederausschuss und Speisesaal. Es ist damit eines von vielen Beispielen, wie im Big Apple neue alte wirtschaftliche Organisationsformen aufleben. Generell ist Wirtschaft das eigentliche Thema des Romans: Gentrifizierung, Vampirkapitalismus und Ansätze zu einer ökonomischen Revolution sind einige der zentralen Aspekte.
Für Franklin Garr, Trader bei einem Hedgefonds, ist Wirtschaft sogar das Leitmotiv seines Lebens – zumindest bis er grollend, aber doch seine Gefühle entdeckt. Charlotte Armstrong hingegen arbeitet bei einer halbstaatlichen Agentur als Anwältin für Flut-Migranten und kennt die weniger glamourösen Seiten New Yorks nur allzu gut. Während Amelia Black buchstäblich über den Dingen schwebt: Sie gondelt mit einem Luftschiff durch die Gegend und ist Star einer Cloud-Show über Tiere, die in neue Lebensräume evakuiert werden.
Vlade Marovich muss als Supervisor des Met feststellen, dass jemand den Hochwasserschutz des Gebäudes zu sabotieren scheint: Ein Fall für NYPD-Inspektorin Gen Octaviasdottir, die daneben aber auch dem Verschwinden zweier weiterer Hausbewohner nachgehen muss, nämlich der beiden Programmierer Jeff und Mutt. Jeff hat einen Weg gefunden, Geldflüsse an der Börse zu manipulieren, und ist damit offenbar irgendjemand ins Gehege gekommen. Und zu guter Letzt wären da noch die beiden obdachlosen Jungen Stefan und Roberto, die im Umfeld des Met leben und unter Wasser nach Schätzen suchen. All diese verschiedenen Geschichten verknüpfen sich in Summe zu einem einzigen Geflecht.
Ein bisschen arty-farty muss schon sein
Damit das Ganze nur ja nicht zu konventionell erscheinen könnte, setzt KSR auf verschiedene Erzählformen. So ist Egozentriker Franklin der Einzige, der in erster Person sprechen darf. Gute Wahl übrigens, weil seine politisch unkorrekten Ansichten die Handlung immer wieder auflockern – etwa zum Thema Fleischessen: Ich selbst hatte allerdings im direkten Experiment herausgefunden, dass mir die unvermeidliche Anthropomorphisierung der Schweine aus der Hausfarm beim Töten keinerlei Zurückhaltung auferlegte, denn wenn man sich ein Schwein als Mensch vorstellt, hat man es mit einem echt hässlichen Menschen zu tun, der einem vermutlich dafür dankbar ist, wenn man ihn von seinem Leid erlöst.
Der Strang um Jeff und Mutt wiederum wird vorwiegend in Dialogen erzählt, was mitunter einem Hörspiel nahekommt und "New York 2140" zum Einstieg ein "sokratisches" Gespräch beschert, wie es sie in "2312" nur allzu viele gegeben hatte. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass KSR eher zum Belehren als zum Diskutieren neigt: schön ersichtlich an einem "Protagonisten", den ich noch nicht erwähnt habe und der im Buch schlicht als der Bürger bezeichnet wird. Es ist eine Art Meta-Erzähler, der – in relativ patzigem Ton – lexikalisches Wissen zum Besten gibt und die Hintergründe der Handlung erklärt.
Womit wir schon mitten in den offenbar unvermeidlichen Robinson'schen Manierismen wären. Wie schon in "2312" gibt es zwischen den Kapiteln wieder jede Menge Zitate und Anekdötchen aus der gesamten Kulturgeschichte, die möglicherweise irgendwie zur Handlung passen oder auch nicht. Diesmal hab ich sie einfach überblättert. Alle 100 Seiten kurz nachgeschaut, ob ich sie vielleicht doch brauche. Nein. Weiterblättern. Deshalb musste ich auch sehr lachen, als KSR seinen (Wut-)Bürger genau das ansprechen lässt: ... wobei diejenigen von euch, die so schnell wie möglich wissen wollen, wie es mit den drolligen Individuen in dieser Geschichte weitergeht, gerne zum nächsten Kapitel weiterblättern können (und ich sehe zu, dass alle weiteren Erklärtiraden, alle weiteren Infodumps in Rot gedruckt sein werden, damit ihr wisst, dass ihr sie überspringen könnt). Damit bin ich offiziell aus den aufgeschlosseneren, intellektuell flexibleren unter Robinsons Lesern aussortiert worden, o Schmach.
Warum es mir letztlich trotz allem gefallen hat
"New York 2140" enthält also alles, was mir "2312" seinerzeit verleidet hat. Dass ich diesmal doch mit Interesse am Ball geblieben bin, hatte verschiedene Gründe. Die Taktik, Unnötiges zu überspringen, hat natürlich geholfen (nicht nur den Zitatkram, es gab auch genug Füllmaterial im Haupttext, etwa ausgedehntes Schlittschuhlaufen auf den zugefrorenen Kanälen der Stadt). Auch die Unterschiede in der Grundanlage der beiden Romane spielten aber eine wichtige Rolle. New York ist schlicht eine engere Klammer als das Sonnensystem und hält das Ganze daher besser zusammen.
Zudem waren die Figuren diesmal einfach interessanter – ich erinnere mich mit Schrecken an den weichgespülten Saturn-Bewohner Fitz Wahram aus "2312", eine der schnarchnasigsten Romanfiguren, die mir in meinem ganzen Leserleben untergekommen sind. Überhaupt ist die treffsichere Zeichnung der Menschen eine der größten Stärken von "New York 2140". Sei es Flüchtlingshelferin Charlotte, die weiß, dass Dankbarkeit für beide Seiten ein sehr unangenehmes Gefühl ist. Seien es die beiden Schatzsucher Stefan und Roberto, die die volle Abgeklärtheit von Streetkids nach außen tragen und trotzdem erkennbar einfach Kinder sind. Oder sei es Franklin, dessen Ich-Bezogenheit regelmäßig für Facepalm-Momente sorgt, woraufhin er sich stets erschrocken fragt, was er denn jetzt wieder falsch gemacht haben könnte. Der "Bürger" mag all diese Figuren als drollig abtun – mich haben sie jedenfalls für sich gewonnen.
Nichtsdestotrotz darf KSR als Nächstes gerne wieder einen Roman ohne Jahreszahl im Titel bringen.
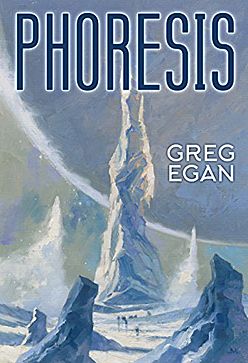
Greg Egan: "Phoresis"
Gebundene Ausgabe, 163 Seiten, Subterranean Presss 2018, Sprache: Englisch
Der Australier Greg Egan ist wohl der härteste unter den Hard-SF-Autoren. Das ist selbst auf dem riesigen englischsprachigen Markt eine Nische – ins Deutsche ist Egan (leider) schon lange nicht mehr übersetzt worden. Kenntnis der Naturwissenschaften oder zumindest ein aufrichtiges Interesse daran wäre eindeutig kein Schaden, wenn man sich an die Lektüre seiner Erzählungen macht. Doch selbst Vorwissen hilft nicht in jedem Fall: In seiner 2011 bis 2013 veröffentlichten "Orthogonal"-Trilogie beispielsweise oder in seinem Roman "Dichronauts" (2017) entführte Egan die Leser kurzerhand in Universen, in denen andere Naturgesetze gelten. Trotzdem genauso strenge wie bei uns.
Mit "Phoresis" macht es Egan den Lesern so leicht wie schon lange nicht mehr – vor allem deshalb, weil sich die darin beschriebene Zivilisation auf einem relativ bescheidenen technologischen Level befindet. Man weiß zwar über Vakuum, Gravitation und andere physikalische Phänomene Bescheid, lebt aber in einer präindustriellen Gesellschaft, falls man solche Vergleiche überhaupt ziehen kann.
Schwesterwelten
Schauplatz sind die beiden Zwillingsplaneten Tvíbura (bewohnt) und Tvíburi (leer), die einander in sehr geringem Abstand umkreisen und sich dabei stets dieselbe Seite zuwenden. Sie erinnern am ehesten an die Monde Europa oder Enceladus: Unter einer Eiskruste liegt ein Ozean, der durch die Gravitationskräfte laufend durchgeknetet und dadurch so weit erhitzt wird, dass Leben entstehen konnte. Yggdrasils genannte Pflanzen graben ihre kilometerlangen Wurzeln aus diesem Ozean durch den Eispanzer. Zusammen mit Geysiren pumpen sie Wasser, Methan, Alkane und andere Stoffe an die Oberfläche, wo die intelligenten Bewohner Tvíburas leben. So wird fortwährend die Atmosphäre von unten her regeneriert, während der Sonnenwind sie oben wieder abträgt.
Bald beginnt man sich zu fragen, wie denn diese Bewohner aussehen mögen, wenn sie in einer so fremdartigen Umgebung leben und gleichzeitig so un-fremde Namen wie Erna, Bridget oder Ingrid führen, an Tischen im Speisesaal sitzen, Kleider tragen und mit Spitzhacken im Boden graben. Natürlich stellt man sich unwillkürlich Menschen vor, aber da sollte man sich nicht zu sicher sein. Ein frühes Indiz: Alle Agierenden sind Frauen – deren nur am Rande erwähnte "Brüder" scheinen eine gesellschaftlich untergeordnete Rolle zu spielen. Wenn diese Brüder dann zum ersten Mal in Erscheinung treten, werden sie die Frage Ob-Menschen-oder-nicht mit einem ziemlichen Paukenschlag beantworten. Huch!
Der Plot
Weil auf Tvíbura die Ernten immer spärlicher werden, kommt die Visionärin Freya eines Tages auf die Idee, zur Schwesterwelt hinüberzusiedeln, die Tag für Tag verlockend am Himmel steht. SF-Fans werden an dieser Stelle aufhorchen: Interplanetare Reisen ohne Weltraumtechnologie ... das erinnert doch unwillkürlich an Bob Shaws "Zwillingswelten"-Trilogie aus den 80ern. Während bei Shaw allerdings Heißluft-Astronauten mit Ballons von einer Welt zur anderen fuhren, denkt Freya an eine andere Art von Verbindung. Eine Yggdrasil-Wurzel soll zu fortwährendem Höhen-(bzw. eigentlich Tiefen-)Wachstum animiert werden, bis aus dem Kondensat, das sich um sie bildet, ein Turm aus Eis entsteht, der die halbe Strecke nach Tvíburi reicht. Phoresis bezeichnet in der Biologie übrigens das Phänomen, wenn ein Lebewesen ein anderes als Transportmittel nutzt.
Es ist ein generationenübergreifendes Mammutprojekt, das Egan in drei zeitlich voneinander getrennten Abschnitten beschreibt. Der erste, mit Freya als Hauptfigur, ist der Planungsphase gewidmet und könnte kaum unterschiedlicher zu Shaws Herangehensweise sein. Shaw schrieb Abenteuerromane – Egan geht es ums Konzept. Wenn Freya ihre Idee präsentiert, alle Eventualitäten durchrechnet und zusammen mit einer Künstlerin ein PR-Konzept ausarbeitet, mit dem sich andere (bzw. natürlich wir Leser) von der Weltenbrücke überzeugen lassen sollen, dann erinnert das stark an die Vorgehensweise, mit der uns ein Ted Chiang Physik und andere Wissenschaften nahebringt.
Der zweite Abschnitt geht dann schon eher in die Abenteuerrichtung: Der Turm hat mittlerweile die erforderliche Größe erreicht, und die neue Hauptfigur Rosalind trainiert mit einem Segelflieger den Absprung auf die neue Welt. Rosalinds Gleitflüge werden so detailreich beschrieben, dass man aus dem Staunen lange nicht rauskommt und sich erst spät die Frage stellt, die einem eigentlich schon längst unter den Nägeln brennen sollte: nämlich was unsere Pionierinnen wohl auf der neuen Welt erwarten wird. Das sei hier aber natürlich ebenso wenig verraten wie die Handlung von Abschnitt 3.
Ein Gedankenspiel
"Phoresis" hat eine unverkennbar abstrakte oder auch allegorische Note. Bezeichnungen mit mythologischem Hintergrund wie Yggdrasil tragen ebenso ihren Teil zu diesem Stilisierungseffekt bei wie die zuvor schon erwähnten Allerweltsnamen. Eine Figur heißt nicht wirklich Petra oder Ingrid – das ist bloß der Versuch einer Annäherung im Kontext der beschriebenen Sprache und letztlich ebenso eine "Übersetzung" wie die Dialoge der Figuren. Nicht viele Autoren beschreiten auf diese Weise die Meta-Ebene – unter anderem J. R. R. Tolkien hat's getan (ich muss allerdings zugeben, ich habe es nie wirklich verdaut, dass Frodo "in Wirklichkeit" Maura Labingi heißt).
Der für heutige Verhältnisse geringe Umfang und die solcherart gestraffte Erzählweise tun den Rest, dass "Phoresis" nur schwer als pralles Abenteuer gelesen werden kann. Es ist ein Gedankenspiel und trotz runden Endes eher ein Szenario als eine Story. Nichtsdestotrotz aber faszinierend.
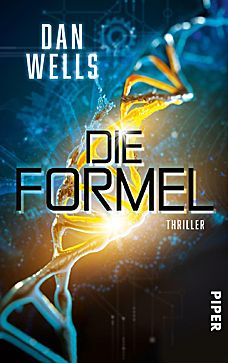
Dan Wells: "Die Formel"
Klappenbroschur, 524 Seiten, € 16,50, Piper 2018 (Original: "Extreme Makeover", 2016)
Atomkrieg, Klimawandel, Pandemien, Aliens, Zombies, Asteroideneinschläge und Roboterrevolte: Das wären die üblichen Verdächtigen in Sachen Weltuntergangsszenario. Obwohl es in der SF-Geschichte natürlich auch schon einige originellere Szenarien gegeben hat: In "Flammenalphabet" von Ben Marcus beispielsweise wird die menschliche Sprache "giftig", in "Blutmusik" von Greg Bear erlangen künstlich gezüchtete Blutzellen Intelligenz und gründen im menschlichen Körper eine eigene Zivilisation.
US-Autor Dan Wells, der seit seiner "Serienkiller"-Reihe um John Wayne Cleaver bei Piper ein Dauer-Abo hat, schießt nun aber den Vogel ab: In "Die Formel" wird der Untergang der menschlichen Zivilisation nämlich durch ... Hautcreme ausgelöst. Das gab's meines Wissens noch nie, nicht mal im Bizarro-Genre. Und es unterhält mit seinem satirischen Potenzial ausgezeichnet.
Und so beginnt es
Der Pharmakonzern NewYew hat ein neues Produkt entwickelt: die wirksamste Anti-Falten-Creme aller Zeiten. Bei Licht betrachtet entpuppt sie sich als – zum Schreien simpel anwendbare – Gentherapie, die die Hautzellen zu ständiger Regeneration animiert. Chefwissenschafter Lyle Fontanelle ist zufrieden – bis eine seiner Testpersonen nach grippeartigen Symptomen stirbt und eine andere ihm plötzlich immer ähnlicher zu sehen beginnt.
Eine nähere Untersuchung kommt zum wahnwitzigen Ergebnis, dass die Lotion die DNA des Anwenders sukzessive überschreibt, wenn sie zuvor mit dem Erbgut eines anderen Menschen kontaminiert wurde. Die "Infektion" breitet sich so lange im Körper aus, bis dieser vollständig umgewandelt wurde, ungeachtet des Geschlechts, der Größe oder anderer Faktoren – nur die Blutgruppe sollte kompatibel sein, sonst führt der Umwandlungsprozess zu einem qualvollen Tod. Lyle ist ein Universalspender, und so wird die Zahl an "Lyles" im Verlauf des Romans immer weiter steigen, während uns die Kapitelanfänge einen fortlaufenden Countdown unter die Nase halten: XXX Tage bis zum Weltuntergang.
Die Wirtschaft bringt uns noch alle um
In einem Punkt ähnelt "Die Formel" einer ganz anderen, aber ebenso originellen Apokalypse, nämlich der in Ward Moores "Greener Than You Think" ("Es grünt so grün") aus dem Jahr 1947. Beides sind nämlich letztlich Satiren auf die Konsumgesellschaft. Bei Moore soll ein neuentwickelter Superdünger an den Mann gebracht werden, der Gras zum prächtigen Vorgarten-Schmuck verwandelt ... bis sich dieses Gras immer weiter ausbreitet und schließlich den ganzen Planeten bedeckt. Und auch bei Wells hätten die Dinge niemals so aus dem Ruder laufen können, wenn es nicht um finanzielle Interessen gegangen wäre.
Die Skrupellosigkeit von NewYew und dessen CEO Carl Montgomery lernen wir gleich zu Beginn mit der Unternehmensphilosphie kennen: Behandeln ist einträglicher als heilen, und Kosmetik fährt mehr Geld ein als Krebsbehandlung, also hat sich der Konzern umorientiert. Soweit es Carl betraf, bestand der einzige spürbare Unterschied darin, dass in den Firmenräumen nun die Fotos von Supermodels statt von kahlköpfigen kleinen Kindern hingen. Wenn überhaupt, dann wirkten die Büroräume tatsächlich attraktiver als früher.
Und auch als Lyle entsetzt seine Untersuchungsergebnisse vorlegt, denkt man in der Firmenleitung gar nicht an einen Produktionsstopp – im Gegenteil: Unter dem Produktnamen ReBirth auf den Markt gebracht, könnte sich die Klonierungslotion doch zum Verkaufsschlager entwickeln. "Zu jedem Kosmetikprodukt gibt es Sicherheitshinweise. Wir formulieren sie in diesem Fall nur etwas ... strenger." Aber zu diesem Zeitpunkt ist das Ganze ohnehin schon außer Kontrolle geraten. Denn rein formal ist "Die Formel" eine waschechte Technologische-Singularität-Erzählung.
Nicht ganz logisch, aber dafür sehr lustig
Im Zuge (und zum Zwecke) der fortschreitenden Eskalation treffen die Figuren freilich einige Entscheidungen, die nicht gerade von Logik bestimmt scheinen. So will Lyle das medizinische Potenzial seiner Lotion genutzt sehen und vertraut eine Probe ausgerechnet einem windigen Guru an, woraus flugs ein Kult um "Reinkarnation zu Lebzeiten" entspringt. Der Wandel von Lyles Assistentin Susan Howell zur Revolutionärin und Bioterroristin wirkt ebenso wenig nachvollziehbar wie die Schnelligkeit, mit der in den USA der Ausnahmezustand ausgerufen wird, weltweite Unruhen ausbrechen und der Roman ins Fahrwasser von Zombiekalypse- und Pandemiemustern gerät.
Aber sei's drum. "Die Formel" steckt voll schwarzen Humors und tragikomischer Szenen, vom göttlichen Originaltitel "Extreme Makeover" bis hin zur Schlusspointe des Romans. Dankenswerterweise werden all diese Situationen vom Autor nicht übermäßig gemolken – stattdessen reißt er sie kurz an und lässt uns dann selbst das Groteske darin erkennen: Da hält etwa Susan einen bewaffneten Mann mit einer Tube Lotion in Schach und eine geklonte afrikanische Privatarmee soll in einen harmlosen Haufen weißer Cheerleaderinnen umgewandelt werden (was in der Einsatzbesprechung die Frage aufwirft, ob das nicht als Rassismus ausgelegt werden könnte).
Herrlich auch die Szene, in der sich die Manager eines Konkurrenzunternehmens mit kindlicher Freude gestohlenes ReBirth ins Gesicht klatschen ... bis sie von den Nebenwirkungen erfahren und in wildes Abwischen verfallen. Das würde man wirklich nur allzu gerne sehen: "Die Formel" bietet sich heftig für eine Verfilmung an – Wells' John Wayne Cleaver hat es ja bereits auf die Leinwand geschafft.
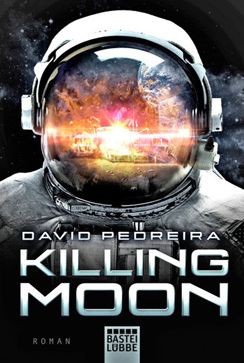
David Pedreira: "Killing Moon"
Broschiert, 350 Seiten, € 10,30, Bastei Lübbe 2018 (Original: "Gunpowder Moon", 2018)
Vor ziemlich genau einem Jahrzehnt erschienen der Reihe nach einige wissenschaftliche Studien, die sich als recht einflussreich auf die Science Fiction entpuppen sollten. Sie drehten sich um mögliche Vorkommen von Helium-3 auf dem Mond, einem Isotop, das sich als Treibstoff für Kernfusionsreaktoren eignen könnte. Die Idee war eigentlich schon Jahrzehnte alt und etwas in Vergessenheit geraten. Nun aber war sie plötzlich wieder in allen Köpfen – und prompt floss sie in so unterschiedliche Werke wie "Limit" (Frank Schätzing), "Luna" (Ian McDonald) oder "Artemis" (Andy Weir) ein. Sowie nun in diesen Roman von Newcomer David Pedreira aus Florida.
Und bislang hatte keine Zukunftserde die Ressource so nötig wie die von Pedreira. Im Jahr 2072 hat sich die Welt gerade einigermaßen von der größten Katastrophe der Menschheitsgeschichte erholt: Der Klimawandel setzte gewaltige Mengen an Methanhydrat frei, die die Erwärmung noch weiter vorantrieben, Fluten auslösten, drei Milliarden Menschen töteten und die einstmals reichen Nationen des Westens zur Neuen Dritten Welt machten. Immer noch befindet sich die Erde im Thermischen Maximum, doch der Aufbau schreitet voran und das vergleichsweise umweltschonende Helium-3 vom Mond spielt dabei eine maßgebliche Rolle.
Im Exil der Vernunft
Schwenk auf den Mond: Hier leitet Hauptfigur Caden Dechert eine kleine Station der US-amerikanischen Space Mining Administration, die den Abbau des kostbaren Rohstoffs im Mare Serenitatis überwacht. Dechert lernen wir kennen, als er gerade mit einem Raketenanzug in einen Krater springt – eine Memme ist er also schon mal nicht. Seine Crew hält er ohne Chef-Allüren, aber fest im Griff: Eine private Cannabis-Plantage und ähnliche kleine Verstöße duldet er, solange die Arbeit nicht beeinträchtigt wird.
Selbst zu seinem Gegenstück auf chinesischer Seite unterhält Dechert freundschaftliche Beziehungen, obwohl die USA und China erbitterte Konkurrenten sind. Schließlich steht das gemeinsame Überleben in einer feindlichen Umgebung an oberster Stelle: Tägliche Gefahren wie Sauerstofflecks, extreme Temperaturwechsel, Sonnenstürme, Mikrometeoriten und der allgegenwärtige aggressive Mondstaub sind weit wichtiger als irdische Revierkämpfe. Noch zumindest.
Die Eskalationsspirale
Bislang musste sich Dechert nur damit herumschlagen, dass seine Crew eigentlich zu klein und die Ausrüstung veraltet ist – eine Folge der strengen Rentabilitätsvorgaben, durch die der Sparstift überall angesetzt wurde, wo es nur ging. Doch plötzlich ändert sich das Spiel grundlegend: Es kommt zu Sabotageakten durch Unbekannt und bald schon zu einem ersten Todesopfer. Die Space Mining Administration schickt einen Behördenvertreter auf den Mond, und der quartiert auch gleich ein paar Soldaten in Decherts Station ein. Konsterniert müssen die Mondbewohner feststellen, dass der kommerzielle Wettlauf zwischen den USA und China kurz davor steht, in einen heißen Krieg überzugehen, und dass ihre Heimat das erste Schlachtfeld werden könnte.
Was hatte Armstrong gesagt, als er den ersten Schritt auf den Mond machte? Ein gewaltiger Sprung für die Menschheit? Jetzt machen wir unsere Schritte rückwärts, denkt sich Dechert. Doch er will die scheinbar unvermeidliche Entwicklung nicht einfach hinnehmen, sondern beginnt auf eigene Faust nachzuforschen, wer hier gezielte Eskalation betreibt. Pedreira liefert uns also die ewig jung bleibende Geschichte vom Aufrechten, der sich "denen da oben" (in diesem Fall "denen da unten") widersetzt, weil er für Vernunft und Wahrheit eintritt und sich weigert, vereinnahmt zu werden: "Räumen Sie wenigstens ein, dass wir hier die Guten sind?" – "Hier oben gibt es nur ein Richtig: zu überleben. Zu sterben ist falsch, ganz egal, wie es passiert."
Zwischen "Artemis" und "Expanse"
Passend zu dieser politischen Philosophie steht "Killing Moon" in Sachen Technologie ganz im Kontext der Mundane SF: Keine Wundermaschinen, die mit Handwavium betrieben werden, keine Fernreisen durch die Galaxis – stattdessen bleiben wir in allernächster Nachbarschaft der Erde und begnügen uns mit Technik, die nicht nur vorstellbar ist, sondern großteils auch heute schon konstruierbar wäre. "Killing Moon" ist ein Fest für Ingenieure: David Pedreira, hauptberuflich Journalist, widmet nicht nur den physikalischen Bedingungen auf dem Mond, sondern auch der zum Einsatz kommenden Maschinerie breiten Raum, macht sie aber zum Glück eher zum Teil der Erzählung, als den Fluss der Geschichte durch wissenswerte Exkurse und Fun Facts zu unterbrechen.
Rechnet man die Faktoren politische Haltung und bodenständige Technologie zusammen, kommt man zum Resümee, dass "Killing Moon" die richtige Lektüre für Fans von Andy Weir und James Corey ("Leviathan erwacht") ist. Und ein sehr solides Debüt.

Rainer Schorm & Jörg Weigand (Hrsg.): "Weiberwelten. Die Zukunft ist weiblich"
Broschiert, 182 Seiten, € 10,90, p.machinery 2018
Zum dritten Mal in Folge haben heuer bei den Nebula Awards Frauen in annähernder Ausschließlichkeit dominiert (nachdem männliche Autoren schon auf den Kandidatenlisten eine Randerscheinung geblieben waren). Es ist die exakt umgekehrte Variante dessen, was man oder frau dem zweitwichtigsten Phantastik-Preis der Welt im vergangenen Jahrzehnt als sexistische Auswahl vorgeworfen hatte – in denselben Blogs, die die aktuelle Schieflage nun als "Signal für Diversität" feiern. Es ist schon irgendwie kurios, wie mit zweierlei Maß gemessen werden kann.
Da grätscht nun eine Satiren-Anthologie aus Deutschland dazwischen: Festzustellen, dass die Kaiserin nackt ist, ist natürlich hochgradig sexistisch und damit nicht statthaft, heißt es im Vorwort zur Anthologie "Weiberwelten". Herausgeber Rainer Schorm geizt zum Stichwort Gender-Mainstreaming nicht mit Ausdrücken wie totalitäre Tendenzen oder Ideologie mit Absolutheitsanspruch. Das ist, dem Charakter einer Wutrede entsprechend, teilweise undifferenziert und einige Argumentationslinien Schorms sind schlicht nicht haltbar – zum Beispiel der Versuch, zwischen der Bewegung für Frauenrechte (gut) und dem Feminismus (schlecht) zu unterscheiden, als wären das zwei ganz unterschiedliche Phänomene. Aber gezielte Provokation ist für ein Vorwort auch nicht die schlechteste Taktik.
Neusprech*in
Dass Schorm eine Parallele zwischen gegenderten Schreibweisen und Orwells Neusprech herstellt, kann man schon eher diskutieren – in Hinblick darauf, dass beides die Funktion hat, das Denken in eine gewünschte Richtung zu kanalisieren. Und dass dies auch mit einer gewissen Vehemenz durchgesetzt werden soll. Dazu eine Anekdote aus der realen Welt, die mir eine Kollegin erzählt hat: Ein Wiener Kleinunternehmer, ein älterer Herr, hat bei einer Stellenausschreibung nach "MitarbeiterInnen" gesucht. War die Reaktion darauf nun Lob dafür, dass sich jemand weit jenseits der 70 bemüht hat, sich zeitgemäß nicht-diskriminierend auszudrücken? Nein, es hagelte Kritik von Seiten der Hundertzehnprozentigen, weil er nicht das viel korrektere "Mitarbeiter*innen" verwendet hatte. Die besten Satiren schreibt immer noch das Leben selbst.
Eine der Geschichten in "Weiberwelten" kommt diesem Level der Absurdität allerdings nahe: In "Flughafeneröffnung erneut verschoben" von Thomas Le Blanc geht der mittlerweile eh schon zur Legende gewordene Flughafen Berlin Brandenburg in eine weitere Warteschleife – diesmal, weil weder Toiletten noch Sicherheitskontrollen oder Hinweisschilder an die volle Bandbreite von neun Geschlechtern angepasst sind. Der Text hat die Form eines Bescheids vom "Berliner Referat für Gendergerechtigkeit" und liest sich in seiner bürokratischen Kompromisslosigkeit ebenso witzig wie realitätsnah. Widerspruchsschreiben, die sprachlich nicht geschlechtlich diskriminierungsfrei formuliert sind, werden zur Korrektur zurückgesandt und gelten als nicht eingegangen.
Den vorhandenen Platz überschätzt
Schorm selbst geht in seiner Geschichte "Das feministische Manifest" formal zunächst in die gleiche Richtung, indem er besagtes Manifest ausgiebig zitiert. Wir erkennen es rasch als satirische Version des deutschen Grundgesetzes, in der kurzerhand "Menschen" durch "Frauen" ersetzt wurde (plus ein paar sich daraus ergebende Modifizierungen). Allerdings belässt er es nicht dabei, sondern fügt es in eine Rahmenhandlung um einen Historiker aus der Zukunft und dessen Emanzipation ein.
Und schon sind wir bei einem Phänomen, das mir in den Anthologien aus dem Haus p.machinery immer wieder auffällt: Sie enthalten trotz geringen Umfangs in der Regel sehr viele Einzelstories, die daher entsprechend kurz sind. Viele Autoren passen sich an diese Kürze aber nicht an und stopfen in ihre Beiträge rein, was das Zeug hält. Da kann eine ganze Romanhandlung kursorisch auf zehn Seiten gepresst werden, eine Geschichte zur Hälfte aus Exposition bestehen oder in letzter Sekunde mit Gewalt ein Schluss hingebogen werden, ehe der Platz ausgeht – oder das Ganze bleibt überhaupt gleich fragmentarisch. Das gilt hier in der einen oder anderen Form unter anderem für die Beiträge von Udo Weinbörner, Monika Niehaus oder Jan Osterloh. Andreas Schäfer spricht in "Eine Novelle" zwar die unsäglichen Tendenzen zur Beweislastumkehr an, die im Zuge von #metoo aufgekommen sind ... mehr als ein Ansprechen ist es auf zweieinhalb Seiten allerdings wirklich nicht.
Besser gelöst
Die besseren Beiträge in "Weiberwelten" sind diejenigen, die der Kürze Rechnung tragen, indem sie sich räumlich und zeitlich beschränken. Wie etwa Claudine J. Lamaisons "Familienplanung", in dem wir Journalistinnen zu einer Presseführung nach Mutterland begleiten, die erste ökologisch-feministische Staat der Welt. Formal würde dies auch für "Erziehungsmaßnahmen" von Klaudia Vormann gelten, allerdings steht hier eher die Gesundheitsdiktatur im Fokus: auch ein Aufregerthema unserer Zeit, denken wir nur an die 2017 erschienenen Bücher "Neanderthal" von Jens Lubbadeh oder "Die Optimierer" von Theresa Hannig.
Auf Humor setzt Hans Jürgen Kugler in "Lakshivas Lover", in dem eine Eso-Tante von ihrem Dildo verlassen wird. Oder genauer gesagt von einem Dildoiden (handelsübliche Dildos mit einem komplett nachgebildeten maskulinen Androidanhängsel). Das bildet ein Gegenstück zur 30 Jahre alten Erzählung "Die Orchidee der Nacht" von Rainer Erler um einen Mann, der argwöhnt, dass seine junge Ehefrau ein Sexroboter ist. Ansonsten bleibt eher rätselhaft, warum Erlers Patriarchatsgeschichte in dieser Matriarchatsanthologie noch einmal veröffentlicht wurde.
Ausschläge auf dem Seismometer
Science Fiction ist ein Seismometer für Befindlichkeiten und Ängste der Gegenwart, insofern war es abzusehen, dass früher oder später ein Band wie "Weiberwelten" auf den SF-Markt kommen würde. 19 Stories sind enthalten, knapp die Hälfte davon stammt von Frauen – was bei einem solchen Thema eine relevante Information ist. Wichtiger noch dürften aber die Altersangaben im bibliografischen Anhang sein: Die mit Abstand jüngste Beitragende ist 1977 geboren, alle Beteiligten haben also schon mehrere Wellen des Feminismus miterlebt. Und wenn man den Grundtenor der meisten Geschichten herausdestilliert, kann man davon ausgehen, dass sie den aktuellen Fourth Wave Feminism als den intellektuellen Niedergang der Bewegung betrachten.
Ebenfalls keine Überraschung ist der Umstand, dass dort, wo das Ärger-Seismometer offenbar am heftigsten ausschlägt, die Satire grober wird. Das gilt für die Beiträge von Rainer Schorm (der hier auch als Rene A. Raisch auftritt) und Karla Weigand, die ebenfalls via Pseudonym mehrfach vertreten ist: als Marie Viking und ich vermute auch als Martina Schleich; wenn nicht, handelt es sich bei Letzterer um einen stilistischen Klon. Der Holzhammer war seit jeher ein zulässiges Mittel der Satire, die beiden verfallen aber für meinen Geschmack zu sehr in den Ton eines Thesen-Donnerwetters. Was sich für ein Vorwort eignet – weniger gut für eine Kurzgeschichte.
Unschärfen
Außerdem mündet der spürbare Grant recht rasch in Unschärfen. Beispiel Biologie: Wenn ich die schon heranziehe, muss ich auch akzeptieren, dass intersexuell neben männlich und weiblich ein genauso natürlicher Zustand ist. Er ist bloß wesentlich seltener, aber das ist ein Quantitäts- und kein Qualitätsunterschied und hat auch nichts mit sozial konstruierten Genderrollen zu tun. Ich wage auch zu bezweifeln, dass wirklich jede Frau (und ich rede hier nur von den heterosexuellen) erst mit einem Mann das Glück findet, wie es ein paar Geschichten suggerieren, in denen eine zukünftige Frauengesellschaft das Y-Chromosom aus dem Genpool entfernt hat, bis die Erlöser endlich rückgezüchtet werden. Und recht schnell wird dann auch der Bogen zu alten Zöpfen geschlagen, etwa zur "eher emotionalen Intelligenz" der Frau. Damit tun sich die betreffenden Autoren keinen Gefallen.
Fazit: "Weiberwelten" bringt ein – durchaus berechtigtes – Unwohlsein über einige Auswüchse des aktuellen Zeitgeists zum Ausdruck, scheitert aber in vielen Fällen dabei, dies in stimmige Worte zu fassen.
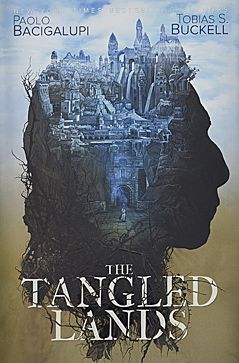
Paolo Bacigalupi & Tobias S. Buckell: "The Tangled Lands"
Gebundene Ausgabe, 304 Seiten, Saga Press 2018, Sprache: Englisch
So erkennt man einen profilierten Autor: Er bleibt sich auch dann treu, wenn er komplett das Genre wechselt. Paolo Bacigalupi haben wir als einen Schöpfer plausibler Zukünfte erlebt, die von Klimawandel und Ressourcenverknappung gekennzeichnet sind: siehe "The Windup Girl" (deutsch: "Biokrieg"), "Water", "Pump Six" und andere. Und ausgerechnet der hat nun ein Fantasy-Shared-Universe ins Leben gerufen? Rasch merkt man allerdings, wie nahtlos sich "The Tangled Lands" in Bacigalupis Schaffen einfügt.
Der Hintergrund
Auch hier haben wir es mit einer umfassenden Umweltkatastrophe zu tun: Die Welt war einmal von einem Imperium dominiert, in dem der Einsatz von Magie zum Alltag gehörte: mit fliegenden Teppichen, Wolkenpalästen und allem, was man sich in 1001 Nächten nur vorstellen kann. Doch das blieb nicht ohne Folgen, denn jeder Einsatz von Magie triggert das Wachstum einer schlicht als "Dornengestrüpp" vorgestellten Pflanze. Mittlerweile hat diese fast den ganzen Kontinent überwuchert. Es gibt nur noch wenige Städte, deren Bewohner einen täglichen Abwehrkampf gegen das Vorrücken des invasiven Gestrüpps führen und dabei doch laufend an Boden verlieren.
Die erste der vier hier versammelten Novellen, "The Alchemist", enthält diesbezüglich eine Schlüsselszene: Der Antagonist der Erzählung – Scacz, der letzte Zauberer – hält dem Helden einen Vortrag über den Untergang des alten Imperiums. Jeder kannte damals die Folgen von Magie – und benutzte sie dann doch, weil trotz guter Vorsätze letztlich niemand wirklich auf den Luxus und die Bequemlichkeit verzichten wollte, die sie bot. Das im Gestrüpp versunkene Imperium ist somit die exakte Entsprechung zur Ära der Expansion in "The Windup Girl" & Co (respektive natürlich zu unserem Zeitalter).
Die Entzauberung des Zauberns
Dass Magie ihren Preis hat, ist in der Fantasy ein gängiges Motiv. Auch "magische Umweltverschmutzung" analog zu Chemikalien, die den Boden verseuchen, findet man immer wieder. So sehr in einen profanen Kontext gestellt wie hier findet man Magie allerdings selten – Larry Nivens Erzählung "The Magic Goes Away", in der sie als nicht-erneuerbare Ressource beschrieben wird, ist aus einer ähnlichen Geisteshaltung entsprungen.
Wie fließend bei Bacigalupi das Märchenhafte ins Nüchterne übergeht, zeigt folgendes Detail: Die Dornen des Gestrüpps sondern ein betäubendes Gift ab, das seine Opfer in einen Schlaf versetzt, aus dem sie niemand mehr wecken kann. Klassisches Dornröschen eigentlich. Allerdings blieb den Grimm'schen Märchenfiguren erspart, was sich hier selbst bei fürsorglichster Pflege durch die Angehörigen nicht vermeiden lässt: Irgendwann fällt der wehrlose Körper des Schlafenden Ratten, Maden und Tausendfüßern zum Opfer.
Schicksale
Der Alchemist, Ich-Erzähler der gleichnamigen Novelle, heißt Jeoz und war einmal reich – inzwischen muss er Stück für Stück den Hausrat verkaufen. Schuldgefühle plagen ihn, weil er seiner kranken Tochter kein besseres Leben bieten kann – und schon hat Bacigalupi binnen weniger Seiten ein menschliches Drama etabliert, das uns für den Erzähler der Geschichte gewinnt. In Bacigalupis zweiter Geschichte, "The Children of Khaim", verhält es sich ebenso. Im Mittelpunkt stehen diesmal die beiden Flüchtlingskinder Mop und Rain. Sie schuften in einem der unzähligen Arbeitstrupps, die das Gestrüpp mit Feuer und Axt zurückdrängen sollen – bis Rain von dessen giftigen Dornen gestochen wird und Mop Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen versucht, um seine Schwester zu retten.
Der zweite Autor in diesem Band, Tobias S. Buckell, folgt Bacigalupis Muster großteils, aber nicht ganz. Der Familie von Sofija, der Ich-Erzählerin von "The Blacksmith's Daughter", wird es zum Verhängnis, dass sie sich auf Geschäfte mit intriganten Adeligen eingelassen hat. Ähnliche Erfahrungen hat schon Jeoz gemacht, nachdem er tatsächlich ein Mittel gegen das Gestrüpp gefunden hatte – und dann zu seinem Entsetzen feststellen musste, dass dieses auch ein perfektes Machtinstrument abgibt und vom Herrscher der Stadt dazu missbraucht wird, ein Terrorsystem zu etablieren.
Sowohl Jeoz als auch Mop, Sofija und die Henkerstochter Tana, Hauptfigur von Buckells "The Executioness", stehen nun vor der Wahl, ob und wie sie sich mit diesem System arrangieren sollen. "The Executioness" fällt allerdings insofern aus dem Rahmen, als sich Buckell – auf Deutsch bekannt durch seine "Xenowealth"-Romane und mehr noch durch Beiträge zur "Halo"-Reihe – entschlossen hat, dann doch lieber in den Abenteuermodus umzuschwenken: mit Entführung, Rache-Queste, Kriegselefanten, Axtschwingereien und der Geburt einer Legende. Das ist deutlich konventioneller gestrickt als Bacigalupis Geschichten, kommt aber denen entgegen, die ihre Hauptfiguren lieber als Rächer denn als Opfer sehen.
Gut und böse, richtig und falsch
Und apropos moralische Dilemmata: Da ist noch das eine große, das den ganzen Band überspannt. Ironischerweise haben die Bösewichte der vier Geschichten nämlich Recht, sowohl der in mehreren Episoden auftretende Scacz als auch die religiösen Eiferer in "The Executioness". Denn sie versuchen mit allen Mitteln, den Einsatz von Magie, also das Grundübel dieser Welt, einzudämmen. Sie desavouieren sich zwar selbst, weil sie ihre Macht in widerlichster Weise missbrauchen – doch ohne sie würde die Welt noch früher dem Untergang preisgegeben. Die uns so sympathischen Helden der Geschichten hingegen greifen auf ebendiese Magie zurück, um ihre Lieben zu retten. Menschlich betrachtet haben sie dafür unser vollstes Verständnis – doch tragen auch sie damit ihr Scherflein zur schleichenden globalen Katastrophe bei. Ziemlich fies, wie Bacigalupi und Buckell hier Kopf und Herz gegeneinander ausspielen.
Viele Gründe also, "The Tangled Lands" zu lesen: eine klare Empfehlung meinerseits. Einziges Manko bleibt, dass alle vier Geschichten nach einer Fortsetzung schreien. Oder wie es in einer Rezension sehr treffend hieß: Es fühlt sich an wie vier verheißungsvolle Trailer für ein Film-Epos, das man unbedingt sehen möchte. Die Hoffnung, dass dieses tatsächlich irgendwann mal "auf die Leinwand" kommt, ist jetzt aber wieder gewachsen. Immerhin stammen die beiden ersten Geschichten bereits aus dem Jahr 2010, während die beiden anderen nach langer Schaffenspause erst jetzt geschrieben wurden. Es tut sich also was.
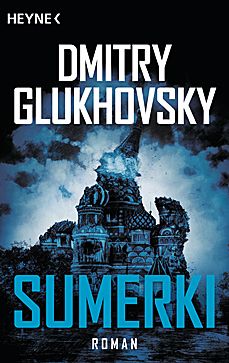
Dmitry Glukhovsky: "Sumerki"
Broschiert, 512 Seiten, € 10,30, Heyne 2018 (Original: "Сумерки", 2007)
Nach einer längeren Reihe von SF-Romanen greife ich zwecks Erholung immer ganz gerne zu einer Mystery: Kein großes Mitdenken und Worldbuilding-Begreifenwollen – einfach nur unsere Welt, und in der passiert dann halt etwas Seltsames. Ist irgendwie gemütlich. Da kam es mir gerade recht, dass Dmitry Glukhovskys "Sumerki" noch einmal neu herausgegeben worden ist. Die deutschsprachige Erstausgabe 2010 wurde ja nie in der Rundschau besprochen.
Im Original ist der Roman 2007 erschienen, im selben Jahr wie Glukhovskys Welterfolg "Metro 2033". Das gilt es zu beachten, weil hier nicht nur Naturkatastrophen wie Hurrikan Katrina und der Tsunami im Indischen Ozean ihre Spuren in der Handlung hinterlassen haben. Vor allem stammt er unverkennbar aus der Zeit, in der der Hype um den angeblich von den Maya vorhergesagten Weltuntergang 2012 gerade Fahrt aufnahm. Der bescherte uns seinerzeit nicht nur jede Menge pseudowissenschaftliche Sachbücher, sondern auch einen der schlechtesten Romane, die ich je für die Rundschau gelesen habe ("Das Ende" von Steve Alten). Fünfeinhalb Jahre nach dem Fortbestand der Welt können wir in "Sumerki" also noch einmal einen Blick darauf werfen, was damals so im Schwange war.
"Das ist meine kleine Welt"
Vorab: Kein Spektakel erwarten! Dafür war Roland Emmerich zuständig. "Sumerki" dreht sich um Dmitri Alexejewitsch, einen in Moskau lebenden Übersetzer, der den Großteil seiner Tage (und des Romans) in der Altbauwohnung verbringt, die er von Oma geerbt hat. Deren Tee- und Kaffeerituale hat er übrigens auch gleich übernommen. Sozialkontakte hat er kaum welche, da liegt er schon lieber in der Badewanne oder macht sich einen schönen Salat – es ist ein kleines, staubiges Leben, wie er es selbst ausdrückt.
Fast seine einzige Anbindung an die Außenwelt sind die langweiligen Dokumente, die er zum Übersetzen bekommt. Dmitris jüngster Auftrag allerdings fällt aus dem Rahmen: Der Text erweist sich als Originalmanuskript eines spanischen Konquistadoren aus dem 16. Jahrhundert, der eine Expedition nach Yucatán leitete. Dmitri wundert sich, dass man das keinem Universitätsgelehrten anvertraut hat. Und mehr noch darüber, dass jemand das wertvolle Dokument zerstückelt hat und ihm immer nur einzelne Kapitel zukommen lässt. Doch er nimmt die Arbeit auf und lässt sich von der Erzählung rasch in ihren Bann ziehen.
Diese Faszination kann man als Leser der Meta-Erzählung übrigens nur bedingt teilen. Auf ihrem Marsch ins Gebiet der Maya werden die Konquistadoren zwar mit allerlei Gefahren konfrontiert, von Seuchen und Überfällen bis zum sukzessiven Verschwinden oder Sterben von immer mehr Expeditionsteilnehmern. Doch sind die Passagen in einem etwas eigenwilligen Rhythmus geschrieben, in den man erst mal reinkommen muss. Vor allem aber sind sie kursiv gesetzt. Das geht zur Hervorhebung zwar auf Wort- bis Absatzlänge, aber seitenweise kursiv ist auf Dauer ein bisschen mühsam zu lesen.
Die Dinge spitzen sich zu
Dmitri jedenfalls wird nach dem Bericht geradezu süchtig. Als er einmal zu lange auf das nächste Kapitel warten muss, packt ihn fiebriger Entzug ... mit Symptomen wie denen der erkrankten Konquistadoren. Überhaupt findet er immer mehr Parallelen zwischen dem Bericht und seinem Leben, träumt von Menschenopfern, glaubt im Radio Nachrichten aus Maya-Land zu hören und verwechselt auf einem seiner seltenen Spaziergänge das Lenin-Mausoleum mit einer Maya-Pyramide (was allerdings verständlich ist). An einer Stelle denkt er sich, ganz unauffällig im Text versteckt, bei uns in Yucatán: Zeichen dafür, wie sehr er sich bereits in die Geschichte hineingesteigert hat.
Und während die Medien von einer noch nie dagewesenen Serie von Naturkatastrophen auf dem ganzen Erdball berichten, verschärft sich auch in Dmitris unmittelbarer Umgebung die Situation: Ein nicht-menschliches Wesen treibt sich in seinem Haus herum und versucht seine Tür aufzubrechen, Menschen in seinem Umfeld kommen in grausiger Weise zu Tode. All das verbindet sich in Dmitris Kopf – oder wie er sagt: in der Petrischale meiner Fantasie – zu einem höchst unheilvollen Gesamtbild.
Die Sache mit dem Ziegel
Ich war einfach zu sehr damit beschäftigt, die einzelnen Bausteine verbotenen Wissens nach und nach zu einem schwankenden Turm der Erkenntnis aufzuschichten. [...] Fast alle Ziegel lagen bereits fertig gebrannt zu meinen Füßen. Nun musste ich nur noch jeden von ihnen an seinen Platz hieven, um sodann den Balkon des errichteten Turms zu erklimmen und von dort die Welt aus neuer, zuvor unerreichbarer Höhe zu betrachten. – Alle Achtung, diese Metapher wurde ordentlich zu Tode geritten, die steht nicht mehr auf.
Ich würde übrigens gar nicht mal unbedingt vermuten, dass es Glukhovsky selbst ist, der sich so "kunstvoll" ausdrückt, sondern eher, dass er seinem behäbigen Ich-Erzähler eine adäquate Sprache in den Mund legt. Das macht sie freilich unterm Strich nicht mitreißender. In der Mitte wird der Roman doch etwas zäh, und ganz generell hätte ein Lektor Glukhovsky besser gesagt, dass für die Handlung die halbe Länge auch locker gereicht hätte.
Rettung in letzter Minute
Worauf all die seltsamen Phänomene rund um Dmitri hinauslaufen werden, ist derart offensichtlich, dass ... es als eine höchst angenehme Überraschung daherkommt, wenn wir am Ende feststellen müssen, dass sich Glukhovsky eine völlig andere Auflösung einfallen hat lassen. Die beiden letzten Kapitel retten "Sumerki"; an die Qualitäten von "Metro 2033" oder "Futu.re" reicht es dennoch bei weitem nicht heran. Im September wird übrigens im Europa Verlag Glukhovskys neuer Roman "TEXT" herauskommen: wieder eine Mystery, anscheinend aber ohne Phantastik-Einschlag.

Annalee Newitz: "Autonom"
Klappenbroschur, 351 Seiten, € 15,50, Fischer Tor 2018 (Original: "Autonomous", 2017)
Indirekt dürften viele die US-Amerikanerin Annalee Newitz schon seit Jahren kennen: Sie war die Gründerin des Blogs io9, der mit seiner einzigartigen Mischung aus Wissenschaft und Popkultur intelligente Unterhaltung auf allen Linien bot. (Nach Newitz' Abgang hat sich das thematische Angebot leider deutlich verengt, die Wissenschaft ist weitgehend von io9 verschwunden.) Natürlich stellte sich bei einer solchen Herkunft vorab die Frage, ob Newitz' Romandebüt wohl ein typisches Journalistenbuch geworden ist.
Das Szenario
"Autonom" ist eine Fortführung des Cyberpunk der 80er und des Biopunk der 90er, verbunden mit derzeit gängigen Wirtschafts-Dystopien. Die Romanwelt des Jahres 2144 weist einige große Staatenbünde auf, aber die sind eher ein letzter Restposten in einer Welt, die von Konzernen und der übermächtigen International Property Coalition (IPC) dominiert wird, die streng über die Einhaltung von Patenten wacht. In Nordamerika gibt man sich offenbar nicht mal mehr den Anschein staatlicher Souveränität: die USA und Kanada werden nur noch "die Freihandelszone" genannt.
Politisch-ökonomisch fühlt sich die Welt also eher wie 2044 als 2144 an – technologisch allerdings ist man tatsächlich im 22. Jahrhundert angekommen. Smartdust wolkt um den Planeten wie sein natürliches Vorbild und bildet als Partikelnetz das neue Super-Internet. Und die Robotik hat ebenfalls erhebliche Fortschritte gemacht: Bots jeglicher Bauart verfügen über ein eigenes Bewusstsein und können – unter den richtigen Umständen – gleichberechtigt mit Menschen agieren. Die zwecks Effizienz streng formalisierte und bezaubernd schlicht wirkende Kommunikation zwischen Bots ist übrigens einer der gelungensten Einfälle in "Autonom". ("Du bist Paladin. Ich bin Fang. [...] Das ist das Ende meiner Daten.")
Was die Gleichstellung von Mensch und Maschine anbelangt, entwirft Newitz für uns ein bemerkenswert zynisches, aber leider gar nicht so weit hergeholt wirkendes Szenario. Bots können nach jahrzehntelanger Kontraktarbeit durch Upgrades Autonomie erlangen. Und Menschen können den umgekehrten Weg gehen: Sie werden zwar frei geboren – doch in eine Welt, in der man sämtliche Bürgerrechte erst käuflich erwerben muss, vom Schulbesuch bis zur Niederlassungsfreiheit. Wer sich das nicht leisten kann, lässt sich an eine Kontraktschule verkaufen, wo er de facto zum Sklaven trainiert wird und ganz wie ein Bot für einen festgelegten Zeitraum seine "Schulden" abarbeitet.
Das Personal
Hauptfigur Jack Chen ist eine Patentpiratin. In ihrem getarnten U-Boot (sowas ist im 22. Jahrhundert offenbar kein großes Ding) schippert sie durch die kanadische Arktis und vertickt Plagiate von Pharmazeutika, die sie an Bord herstellt. Zuletzt hat sie aber ins Klo gegriffen: Das leistungssteigernde Mittel Zacuity zeigt nämlich schwerwiegende Nebenwirkungen – Menschen arbeiten sich buchstäblich zu Tode. Jack hat nun alle Hände voll zu tun, um zu beweisen, dass bereits das Original des Herstellers fehlerhaft war und die Schuld nicht bei ihrer Rekonstruktion liegt. Was freilich nichts daran ändert, dass sie letztlich genauso schlampig war wie der Konzern und das Produkt nicht ausreichend kontrolliert hat. Heldin ist Jack also keine, auch wenn sie ständig ihr soziales Gewissen betont ... was sich offenbar auch locker damit verträgt, einen Einbrecher kurzerhand zu ermorden.
Als Widerpart wird ein ungewöhnliches Duo ins Spiel gebracht, bestehend aus dem neukonstruierten Kampfroboter Paladin und dem Menschen Eliasz. Im Auftrag der IPC sollen sie die Person ausfindig machen, die die Zacuity-Kopie in Umlauf gebracht hat, und sie ausschalten. Klingt nach einer gängigen Konstellation, doch werden wir bald feststellen, dass der Plot von Fahndung und Flucht Newitz weniger interessiert als die Entwicklung, die das Verhältnis zwischen Bot und technophilem Menschen nimmt.
Die Schwerpunkte verschieben sich
Am Anfang steht ein gängiges Missverständnis zwischen Mensch und Maschine: Paladin trägt ein menschliches "Spenderhirn" in sich. Doch während Menschen dies unwillkürlich für den Sitz seiner Persönlichkeit halten, nutzt Paladin das Organ nur als – in seinen Worten – Graphikprozessor zur Mustererkennung (was etwas kurios ist, gerade in dem Bereich sind Künstliche Intelligenzen heute schon recht weit). Obwohl es also für ihn von untergeordneter Funktion ist, beginnt Paladin dann doch, dem Ursprung des Gehirns nachzuforschen – und als er erfährt, dass es von einer Frau stammt, ist die Angelegenheit plötzlich so wichtig geworden, dass er sich fortan als "sie" titulieren lässt. An der Stelle streut Newitz noch ein paar Binsenweisheiten aus dem Gender-Workshop ein ("Geschlecht war eine Form der sozialen Identifizierung"), aber zu diesem Zeitpunkt hat die Geschichte den Drive des ersten Drittels ohnehin bereits verloren.
Mittlerweile habe ich genug Liebesgeschichten gelesen, um zu wissen, dass es nicht auf Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit, Spezies oder wie in diesem Fall Konstruktionsweise der Beteiligten ankommt, ob sie als Plot funktionieren, sondern nur auf eines: erzählerisches Handwerk. Diese hier funktioniert nicht. Davon abgesehen hat sich's die Autorin auch nicht gerade leicht gemacht, wenn sie uns für die Selbstfindung zweier Protagonisten gewinnen will, in deren emotionalen Wandlungen es nur eine Konstante gibt: Sie setzen bei ihrer Fahndung durchgehend auf brutale Folter. Also mich zumindest interessiert es nur mäßig, wenn ein Arschloch in sein Inneres blickt und dabei nichts Schmutziges findet.
Jack immerhin hat ein schlechtes Gewissen. So richtig etwas mit ihrer Hauptfigur anzufangen wusste Newitz anscheinend aber nicht. Jacks Erzählstrang besteht zu erheblichen Anteilen aus extensiven Rückblicken auf ihren Lebensweg. Zwingend notwendig sind die nicht, schon gar nicht in der Länge. Vermutlich sollen sie den Umstand kompensieren, dass Jack auf der Gegenwartsebene primär mit der Herstellung eines Gegenmittels beschäftigt ist, und Pillendrehen gibt nun mal kein Spektakel ab. Im letzten Drittel tritt Jack dann auch noch für lange Zeit in den Hintergrund, während eine bisherige Nebenfigur – der Bot Med – nun breiten Erzählraum erhält. Auch in diesem Punkt ist die Geschichte aus dem Gleichgewicht geraten.
Die Bilanz
Letztendlich ist es also doch ein Journalistenbuch geworden – in seinem Bemühen, thematisch auf allen Hochzeiten zu tanzen und in allen Diskursen up to date zu sein. Die Schreibe ist flüssig, den Aufbau des Plots hatte Newitz aber nicht wirklich unter Kontrolle. Schade, als langjähriger Fan von io9 hätte ich "Autonom" gerne mehr gemocht.
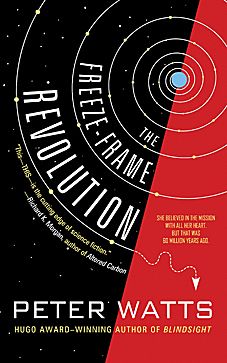
Peter Watts: "The Freeze-Frame Revolution"
Broschiert, 192 Seiten, Tachyon Publications 2018, Sprache: Englisch
Etwas Sense of Wonder gefällig? Bitte sehr: Peter Watts geht mit "The Freeze-Frame Revolution" ein gängiges Motiv der SF mal von der anderen Seite an. Üblicherweise lesen wir davon, dass sich die Menschheit überlichtschnell in der Galaxis ausbreiten konnte, indem sie Sprungtore nutzte, die irgendein (oft längst verschwundenes) Alien-Volk hinterlassen hat. Hier sind wir mal beim Aufbau eines solchen Netzes dabei – und wie der Vorgang abläuft und welche Folgen er mit sich bringt, fasziniert endlos.
Atemberaubender Zeithorizont
Nicht allzuweit in unserer Zukunft begann die "Ära der Diaspora", in der umgebaute Asteroiden mit relativistischer Geschwindigkeit hinaus in die Galaxis geschickt wurden, um ein Geflecht aus Wurmlöchern zu erzeugen. Eriophora, der Schauplatz des Romans, ist ein solcher Asteroid. 30.000 Menschen sind an Bord, die meisten davon befinden sich allerdings in Stasis. Nur wenn etwas Ungewöhnliches geschieht, holt die Bord-KI Chimp Menschen aus dem Schlaf; stets nur in kleinen Grüppchen und für ein paar Tage. Zwischen solchen Wachphasen vergehen in der Regel viele Jahrtausende.
Mittlerweile ist Eriophora seit 66 Millionen Jahren unterwegs – und dank Fluggeschwindigkeit und Kälteschlaf sind immer noch diejenigen am Leben, die einst an Bord gingen. Kontakt zur Außenwelt haben sie keinen. Bei seltenen Gelegenheiten kommt mal aus einem der Tore ein waberndes energetisches Dings hervor (die Crew spricht von gremlins), und dann stehen sie auf der Brücke und rätseln, ob es wohl das ist, was aus ihren Nachfahren geworden ist. Kommunikation findet mit diesen göttergleichen Monstrositäten keine statt. Als ein Crewmitglied anmerkt, dass die Wesen sich doch wenigstens bei ihnen für den Aufbau der Sternenstraßen bedanken könnten, kontert ein anderes mit dem nüchternen Kommentar, dass wir uns ja auch nicht bei Spitzmäusen für deren evolutionäre Vorarbeit bedanken. "I think they've got other priorities by now."
Es gärt
Aus dem Gefühl, aus jedem Bezugsrahmen hinauskatapultiert worden zu sein, erwächst langsam aber doch Unzufriedenheit. Nicht bei der Hauptfigur und Ich-Erzählerin Sunday Ahzmundin übrigens, die ist lange Zeit systemtreu. Doch ihre Freundin Lian Wei konfrontiert Sunday erstmals mit unbequemen Fragen: "Furthering the Human Empire. Whatever it's turned into by now. So we build another gate and nothing comes out. They're extinct? They don't care? They just forgot about us?"
"Bald" (in erlebter Zeit, nicht in draußen verstreichender) wird Sunday feststellen, dass es noch mehr Unzufriedene gibt und dass diese vor allem der Bord-KI misstrauen. Für Sunday stellt das ein persönliches Problem dar, denn sie betrachtete Chimp stets als Freund – die Saat des Zweifels beginnt aber zu keimen. Ist Chimp ein Mörder, gar ein Massenmörder? Natürlich besteht theoretisch die Möglichkeit, dass die Crewmitglieder nur Paranoia schieben und eigentlich alles grün ist. Allerdings haben wir es hier mit Peter Watts zu tun, und dessen Zukünfte sind selten Puppenstuben. Er konfrontiert seine menschlichen Protagonisten stets mit Umständen fern der Humanität: eine SF-Tradition, die 1954 mit Tom Godwins "The Cold Equations" begann und hier nahtlos weitergeschrieben wird.
Viele Gelegenheiten zum Staunen
Doch wie wehrt man sich gegen einen Super-HAL, der seine elektronischen Augen überall hat? Und wie organisiert man eine Revolution, deren Proponenten immer nur kurz und über extreme Zeiträume verteilt aktiv werden können? Das wird sich als ebenso faszinierend erweisen wie all die anderen Attraktionen in "The Freeze-Frame Revolution". Sei es der Besuch in einem lichtarmen Garten voller schwarzer Pflanzen, sei es die fantastische Zukunftstechnologie, die hier zum Einsatz kommt: von den Von-Neumann-Maschinen, die die Portale bauen, bis zu Eriophoras Antrieb, der auf einer Singularität beruht und daher für etwas spezielle Gravitationsverhältnisse an Bord sorgt.
Und immer wieder natürlich die immensen Zeiträume, die draußen im Weltraum verstreichen – noch einmal besonders schön verdeutlicht, als sich Eriophora über 100.000 Jahre hinweg einem sterbenden Stern annähert:
Each time I awoke, our destination had leapt that much closer. (...) Sometime when I was down it ran out of helium to fuse, fell back an carbon. Sodium appeared in its spectrum. Magnesium. Aluminium. Every time I woke up it had heavier atoms on its breath. (...) Buried in basalt, we slept away the cataclysm: the fusion of neon, of oxygen, the spewing of half the periodic table into the void. The collapse of nickel into iron and that final fatal moment of ignition, that blink of a cosmic eye in which a star outshines a galaxy.
Immer mehr verfestigt sich in mir der Eindruck, dass die 1990er und 2000er Generationen der SF-Autoren der 2010er um einige Klassen voraus sind.

James Abbott: "Höllenkönig"
Klappenbroschur, 603 Seiten, € 16,50, Penhaligon 2018 (Original: "The Never King", 2017)
So so, die Hipster-Bärte sind also in der High Fantasy angekommen. Wenn ich jetzt auch noch sage, dass James Abbott das neue Pseudonym des britischen Autors Mark Charan Newton ("Nacht über Villjamur") ist, werden sich alle auch in der Handlung modernistische Einsprengsel erwarten. Doch konservativere Fantasy-Leser, die sich von Setting und Wording nicht gerne ihr hehres Mittelalter verpatzen lassen, müssen sich nicht ins Beinkleid machen: Hier ist ein Körper wieder ein Leib und sind Länder wieder Lande.
Die Ausgangslage
Der Prolog von "Höllenkönig" schildert einen eher ungewöhnlichen Vorgang: Eine Dorfbevölkerung wird niedergemetzelt, weil die Bewohner sich weisungsgemäß als Barbaren aus dem Norden verkleidet haben, um diese bei deren Vorstoß ins Königreich Stravimon zu täuschen. Leider hat der königlichen Eliteeinheit niemand etwas davon erzählt. Sie sieht vermeintliche Invasoren vor sich und schlachtet sie ab. Später werden wir erfahren, dass es sich dabei um eine Intrige handelte, um ebendiese Elitekämpfer zu desavouieren – in Vorbereitung eines Staatsstreichs. Religiöse "Säuberungen" und Angriffe auf die benachbarten Reiche werden folgen.
Fünf Jahre später sitzt Hauptfigur Xavir Argentum, der ehemalige Anführer der Einheit, in einer Gefängniszitadelle am kalten Rand des Reiches ein: dort, wohin man alle Höhergestellten schafft, die in Ungnade gefallen sind. Unter der Bezeichnung Höllenkönig hat er sich an die Spitze einer Gang gestellt, die einigermaßen zivilisierte Zustände unter den Gefangenen garantiert. Im Prinzip hat sich der mit seiner Vergangenheit hadernde Xavir also recht gemütlich eingerichtet – bis sich ein Meisterspion einschleicht und versucht, ihn zum Ausbruch zu überreden. Draußen in Stravimon geht nämlich alles langsam den Bach runter, und der alte Kämpe wird so dringend gebraucht wie nie.
Da wär man doch lieber im Kittchen geblieben
Anders als der Klappentext andeutet, spielt das Gefängnis keine allzu große Rolle. Der Ausbruch mit ein paar Getreuen geht leicht und früh über die Bühne und erst danach setzt die eigentliche Handlung ein. Es gilt nicht nur, die Verantwortlichen des einstigen Massakers zu bestrafen, sondern auch das Reich zu retten, das inzwischen alle Anzeichen einer übernatürlichen Invasion aufweist: Aus Wänden quillt Blut, das zur ominösen Botschaft "Wir kommen" gerinnt, auf den Straßen treiben sich Fremdländische mit dämonischen Einschlag und potthässliche Megafauna herum.
Warum sich der neue König auf all das eingelassen hat, versucht Xavir nun zu ergründen, unterstützt von einer wachsenden Armee, an deren Spitze einige bunte Vögel stehen: Meisterspion Landril Devallios, die durch das Massaker ebenfalls kompromittierte Wolfskönigin Lupara aus einem Nachbarland und nicht zuletzt Elysia, die junge Novizin eines Nationen übergreifenden Hexenordens, den sich der neue König von Stravimon gefügig machen will. Elysias Erlebnisse werden anfangs als paralleler Handlungsstrang zu den Geschehnissen um Xavir geschildert. Je weiter der Roman voranschreitet, desto mehr wird Elysia aber zu einer Nebenfigur degradiert; ein gewisse Unebenheit in der Plot-Konstruktion.
Heraldische Motivik
Wenn wir lesen, dass Xavir der Favorit des weisen Ex-Königs war, ehe er von dessen intrigantem Nachfolger ins Off befördert wurde, dann erkennen wir, dass wir es mit exakt der gleichen Grundkonstellation wie in "Gladiator" zu tun haben. Die Murder-by-Numbers-Rache an denen, die einst die Intrige gegen Xavir spannen, erinnert wiederum stark an "Der Graf von Monte Christo". Und das nach außen aggressiv und nach innen faschistoid gewordene Reich Stravimon, das sich mit höheren Mächten eingelassen hat, findet seine Entsprechung in der "Babylon 5"-Erde unter Präsident Clark. Viel Bekanntes also – dazu kommt eine sämtlichen Fantasy-Konventionen entsprechende, wenn auch irgendwie blässlich bleibende Welt, der nur die Karte im Einband fehlt.
"Du bist am Leben, und sie sind tot", murmelte Xavir. "So sehen Siege aus." Der Kampf um Stravimon gerät erwartungsgemäß zum großen Hacken, Stechen, Schlitzen und Zaubersprücheschleudern: Klassische Sword-and-Sorcery, die – abgesehen vielleicht vom Auftreten einer schwulen Nebenfigur – in dieser Form auch vor 30 oder 40 Jahren erscheinen hätte können. Mit wie gesagt Leib und Landen und geiferndem Gebrüll (das versuch ich mir immer noch vorzustellen, aber ich hör's nicht).
Ausreichend unterhaltsam, aber nicht neu. Abgeschlossen, aber fortsetzbar.
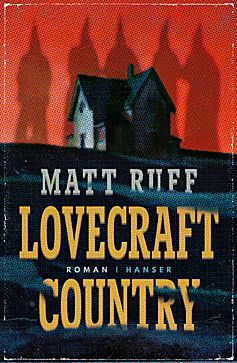
Matt Ruff: "Lovecraft Country"
Gebundene Ausgabe, 432 Seiten, € 24,70, Carl Hanser Verlag 2018 (Original: "Lovecraft Country", 2016)
Mit Antirassismus begann diese Rundschau-Ausgabe, mit Antirassismus hört sie auch auf. So vergnüglich wie in "Lovecraft Country" kommt das Thema allerdings selten daher. Die Originalausgabe ist hier bereits vor zwei Jahren rezensiert worden (siehe den Link oben). Nun gibt's endlich auch die verdiente deutschsprachige Ausgabe – übrigens wie schon seinerzeit bei Ruffs Alternativweltroman "Mirage" (dtv) nicht von einem der üblichen Genre-Verlage.
Ruffs Szenario führt uns ins Amerika der 1950er Jahre, in dem strenge und teilweise bizarre Gesetze zur Rassentrennung gelten. Ein machtgeiler Zirkel von alten Zauseln will an diesem verknöcherten System um jeden Preis festhalten und geht ein Bündnis mit dunklen Mächten ein. Allerdings haben sie nicht mit den quirligen Damen und Herren der schwarzen Familie Turner gerechnet. Die lassen sich nämlich auch vom Übernatürlichen nicht so schnell einschüchtern.
Der episodenhaft angelegte Roman erinnert an ein Gesellschaftssystem, dessen Auswüchse aus heutiger Sicht mindestens genauso abwegig wirken wie das, was Lovecrafts Große Alte & Co in ihren äonenalten Gehirnen ausgebrütet haben. Die Verknüpfung von Sittenbild, Schelmenstück und Hommage an die Horrorgeschichten der Pulp-Ära ergibt eine ungewöhnliche, aber bemerkenswert stimmige Lektüre mit Witz und Verstand. Nicht entgehen lassen!
An der nächsten Rundschau wird bereits gearbeitet
Und falls jemand die Zeitreisegeschichte vermisst hat, die ich vor einem Monat in der Vorankündigung erwähnt hatte: Die hab ich um eine Ausgabe geschoben, sonst wären wir diesmal gar nicht ins All gekommen. Nächstes Mal ist sie dann mit dabei, zusammen mit ein paar Weltraumtrips, die auf unvorhergesehene Weise schiefgehen. (Josefson, 28. 7. 2018)
___________________________________
Weitere Titel
Überblick über sämtliche bisher rezensierten Bücher