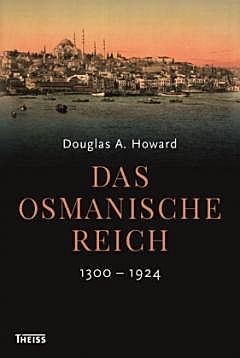
Douglas A. Howard, "Das Osmanische Reich 1300–1924". Übersetzt von Jörg Fündling. € 35 / 480 Seiten. WBG Theiss, Darmstadt 2018
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, seit seiner Wiederwahl mit praktisch absoluter Macht ausgestattet, versteht sich offensichtlich als legitimer Erbe der Osmanendynastie, die vor fast hundert Jahren zu Ende ging. Zwei Jahre nach dem mutmaßlichen Putschversuch wurde der Ausnahmezustand zwar formell aufgehoben, durch "Anpassung" der Gesetze gilt er aber de facto weiter.
Die türkische Zeitung "Hürriyet", eines der wenigen verbliebenen unabhängigen Medien, nannte das jüngst einen klaren Verfassungsbruch. Das wird Erdogan wenig kümmern. Eine Gefährdung seiner Macht braucht er bis auf weiteres nicht zu fürchten. Aber die Geschichte seiner bewunderten Osmanen hält auch für ihn Warnungen bereit.
Bild nicht mehr verfügbar.
In dem jetzt auf Deutsch vor liegenden Werk des US-amerikanischen Historikers Douglas A. Howard ("Das Osmanische Reich 1300–1924") liest sich das am Beispiel des drittletzten Osmanensultans so: "Mit der Zeit weckte die osmanische Verfassung, obwohl Sultan Abdülhamid II. sie ironischerweise unter Anwendung ihrer eigenen Bestimmungen außer Kraft gesetzt hatte, durch ihr schieres Vorhandensein Erwartungen einer offeneren politischen Kultur, selbst wenn der Sultan keine erkennbare Absicht hatte, diese zu erfüllen.
In vielerlei Hinsicht war Abdülhamid ein vorausdenkender Monarch und dazu einer, der durch seine öffentlich praktizierte Frömmigkeit die alte sunnitische Nervosität gegen Neuerungen beschwichtigen konnte. Doch das alte Misstrauen gegen jede Form von Spaß hielt sich in weltlichem Gewand nach wie vor. Folglich existierte die eilfertige Integration des Regimes in die internationale Ordnung eines ungebremsten Kolonialkapitalismus neben seiner ermüdenden islamischen Apologetik, einer paranoiden Informationspolitik und obsessiven Schuldzuweisungen. Osmanische Muslime fühlten sich von ihrer zudringlichen Regierung gegängelt, während die osmanischen Nichtmuslime außerdem noch den schäbigen religiösen Chauvinismus des Regimes zu spüren bekamen."
Auflösung des Reiches
Unter Abdülhamid II. (1876-1909) begann die Auflösung des Osmanischen Reichs. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Kriege auf dem Balkan und im Kaukasus führten zur Revolution der Jungtürken, der Erste Weltkrieg versetzte dem über drei Kontinente ausgedehnten Imperium den Todesstoß. 1923 beendete die von Mustafa Kemal Pascha (ab 1934 mit dem Nachnamen Atatürk, Vater der Türken) gegründete Republik Türkei die zuletzt schon stark eingeschränkte Herrschaft der Osmanen. Den letzten Sultan, Abdülmecid II., setzte das Parlament im März 1924 auch als Kalifen ab. Er ging ins Exil.
Mehr als 600 Jahre davor hatte das Osmanenregime begonnen: mit einem Sieg türkischer Kämpfer gegen die Truppen des byzantinischen (oströmischen) Kaisers im westmongolischen Grenzgebiet um das Jahr 1300. Eineinhalb Jahrhunderte später erreichte die osmanische Herrschaft mit der Eroberung Konstantinopels (im Jahr 1453) einen ersten Höhepunkt. Was erklärt die lange Dauer und – zwischenzeitlich durchaus auch prekäre – Stabilität dieser Regentschaft, die nur mit jener der Habsburger (1273–1918) vergleichbar ist?
In seinem Buch, das nicht nur in Fachkreisen schon jetzt als Standardwerk bewertet wird, sieht Howard den Schlüssel zum Verständnis dieses Herrschaftssystems in einem dreischichtigen Phänomen der osmanischen Weltsicht. Erstens der dynastische Anspruch: In ihm vereinigen sich spirituelle Energie als Fähigkeit, den Menschen das Göttliche zu vermitteln, mit Charisma zum Wohl des Volkes. Zweitens das Verständnis von Wohlstand und Erfolg und die dazu entwickelten Strategien, um beides zu erreichen. Und drittens ein Geflecht von spirituellen Überzeugungen; dabei kommt der Literatur eine Schlüsselrolle zu. Lyrik und Versepos sind jene Literaturgattungen, die den großen osmanischen Kulturmythos transportieren: dass allen Dingen im Kern die Verlusterfahrung zugrunde liegt.
Das Vergängliche ist also das einzige Beständige: eine an sich banale Erkenntnis. Den Osmanen gelang es offenbar, aus dieser Binsenweisheit ein höchst wirksames Herrschaftsinstrument zu formen, indem sie als von Gott erwählte Verwalter und Garanten einer labilen Stabilität auftraten, als personifizierte Versöhnung eines eigentlich unauflösbaren Gegensatzes. Daraus erklärt sich auch ein Umstand, den Howard so formuliert: "Das Netz der erweiterten Haushaltsbeziehungen der Osmanendynastie, gewoben aus Ehen und Erbschaften, Sklaverei und Klientel, wurde zum Muster für die gesamte osmanische Gesellschaft."
Dabei pendelten die osmanischen Sultane und ihre Familien in ihrer Herrschaftspraxis ununterbrochen zwischen Gegensätzen: Zentralismus und regionale Machtarrangements; religiöse Toleranz und islamischer Rigorismus; Spiritualität und kühler Pragmatismus. Am klarsten sei die osmanische Weltsicht in der Achtung vor dem Einzelnen und vor den bedeutsamen sowie den banalen Details seines Lebens zum Ausdruck gekommen, meint Douglas A. Howard. Auch hier ein tiefer Widerspruch: Für die eigene Familie galt die Achtung vor dem Einzelnen nur sehr bedingt. Dass Sultane Brüder und Söhne als tatsächliche oder potenzielle Rivalen eiskalt ermorden ließen, war bis weit ins 18. Jahrhundert gängige Praxis. (Josef Kirchengast, 29. 7. 2018)