
Cixin Liu: "Weltenzerstörer"
Klappenbroschur, 122 Seiten, € 9,30, Heyne 2018 (Original: "Ren he tunshizhe", 2002)
Huiuiuiuiui.
Dabei klang die Ausgangslage durchaus vielversprechend ... und vertraut obendrein: Wie in seinem später veröffentlichten Welterfolg "Die drei Sonnen" lässt Cixin Liu auch in dieser 16 Jahre alten Novellette der Menschheit eine Warnung vor einer Bedrohung durch übermächtige Außerirdische zukommen. In 100 Jahren werde ein ringförmiges Alienkonstrukt von 50.000 Kilometer Durchmesser eintreffen und sich um die Erde legen, um den Planeten buchstäblich auszusaugen. Größer als Roland Emmerich!
Diese Botschaft trifft mit einem Kristall ein, den eine andere, freundlich gesinnte Spezies ins Sonnensystem gesandt hat. Als ein menschliches Erkundungskommando ihn erreicht, erscheint die Projektion eines Mädchens und plärrt (im Vakuum): "Der Weltenzerstörer kommt! Der Weltenzerstörer kommt!" Dieses an jeden Satz angehängte Gekreisch hat mich absurderweise in den Schwedischunterricht zurückgeflasht, als wir Strindbergs "Gespenstersonate" gelesen haben, in der ja die Dame des Hauses in einem Schrank lebt und von Zeit zu Zeit wie ein Papagei losschnattert. Man sieht, zu diesem Zeitpunkt hatte ich "Weltenzerstörer" unbewusst noch in einen recht anspruchsvollen literarischen Kontext gestellt.
Seid ihr alle daaaaa?
Aber hier wird ein anderes Stück aufgeführt. Und weil in einem Kasperletheater das Krokodil nicht fehlen darf, trifft als Vorbote des Weltenzerstörers auch ein Echsen-Kaiju auf der Erde ein. Das frisst eines der versammelten Staatsoberhäupter, erklärt den Menschen anschließend, wie der Angriff ablaufen wird (interessante Taktik), verheißt ihnen, dass die Überlebenden als Fleischlieferanten dienen werden, und gefällt sich bärig im Ausleben des "Puny humans"-Klischees: "Haha, was seid ihr bloß für zarte, weiße Würmchen! Ein drolliges Völkchen!" Zusammen mit dem Plärren der Kristall-Insassin ("Der Weltenzerstörer kommt! Habt ihr denn gar keine Angst vor ihm?") ist das so überdreht, dass es auf eine Satire hoffen lässt und als solche auch lustig wäre.
Allein es ist keine, wie der weitere Verlauf zeigt. Eher eine holzschnittartige Parabel mit albernen Einsprengseln oder die Skizze einer Erzählung, sprachlich schlicht und mit einem Twist versehen, der das Ganze definitiv nicht besser macht. Ich habe auf Tiefgründigkeit gehofft, aber sie hat sich mir nicht erschlossen. Und am Ende darf das Krokodil auch Krokodilstränen vergießen: "Vor mir und meinen Nachkommen liegt nur das unendliche Universum mit seiner ewigen Nacht und seinen unaufhörlichen Kriegen. Wie könnten wir darin je ein Zuhause finden?" Bei seinen Worten wurde der Boden zu seinen Füßen nass. Ob von seinen Tränen, wusste niemand zu sagen.
Bandbreite nach unten erweitert
Meine persönliche Bilanz zu Cixin Liu fällt bislang gemischt aus. "Der dunkle Wald" hat mir wirklich gut gefallen. Dessen Vorgänger "Die drei Sonnen" und die Novelle "Spiegel" waren o.k., aber keineswegs überragend. Und jetzt das. Angesichts der beispiellosen Lobeshymnen, die seit Jahren auf den Autor einprasseln, drängt sich einem da doch ein weiterer literarischer Verweis auf – nämlich "Des Kaisers neue Kleider". Mit dem entscheidenden Unterschied vielleicht, dass das Kind, das in Andersens Märchen "Aber er hat ja gar nichts an!" ruft, noch am ehesten von "Weltenzerstörer" begeistert sein dürfte. Denn dies hier ist ein Kinderbuch.
Apropos "Buch" noch: Um die kurze Erzählung im Kielwasser der Cixin-Liu-Mode als Einzelband auf den Markt bringen zu können, musste sich der Verlag schon ziemlich strecken. Die eigentliche Geschichte ist keine 70 Seiten lang. Den Rest des Umfangs machen ein Nachwort zu chinesischer Science Fiction (ohne Bezugnahme auf "Weltenzerstörer"), ein langes Exzerpt des nächsten April erscheinenden Abschlussbands der "Trisolaris"-Reihe und Erläuterungen zu Schreibweise und Aussprache des Chinesischen aus (theoretisch interessant, aber gerade hier skurril unnötig, weil in der ganzen Geschichte kein einziger Name genannt wird).
Fazit: Kann man sich wirklich sparen. Und wenn schon aus keinem anderen Grund, dann aus dem, dass "Weltenzerstörer" eh im Storyband "Die wandernde Erde" enthalten sein wird, der im Dezember erscheint. Und darin hoffentlich das untere Ende der Qualitätsskala markiert.
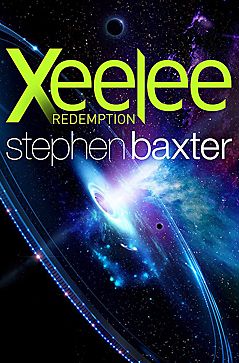
Stephen Baxter: "Xeelee: Redemption"
Broschiert oder gebundene Ausgabe, 432 Seiten, Gollancz 2018, Sprache: Englisch
Die Gerüchte haben gestimmt: Nach fast 30 Jahren und Dutzenden Erzählungen bekommen wir in diesem Band tatsächlich zum ersten Mal einen leibhaftigen Xeelee zu sehen! Wie die (ungewollte) Nemesis der Menschheit aussieht, sei hier nicht verraten – die Überraschung wird sich freilich in Grenzen halten. Das macht aber nichts, denn in "Xeelee: Redemption" nimmt uns Stephen Baxter wieder einmal zu einem derart atemberaubenden Rundflug durch das Wunderland der Hard SF mit, dass uns zum Zeitpunkt der Enthüllung ohnehin schon die Sinne abgestumpft sind.
Achtung, Spoilergrenze für den Vorgängerband! Wer "Xeelee: Vengeance" noch nicht gelesen hat, sollte diesen Absatz überspringen, um sich dessen Schlussfeuerwerk nicht zu verderben. "Vengeance", das mit "Redemption" eine Duologie bildet, endete mit der De-facto-Demontage des Sonnensystems. Ein Xeelee-Raumschiff hat die von Menschen besiedelten Himmelskörper in Lavasuppe verwandelt. Die Erde selbst konnte mit knapper Not gerettet werden, indem sie durch ein Wurmloch in den Kuipergürtel evakuiert wurde. Fern der Sonne friert sie allerdings zu – laufend starten nun Archen, um die Menschheit über die Galaxis zu verstreuen und ihr durch großräumige Verteilung das Überleben zu sichern: im Grunde die gleiche Strategie wie der "Goldene Pfad" in den "Dune"-Romanen, und Baxter verwendet mit Scattering sogar dasselbe Wort dafür.
So geht es weiter
Nach dem verheerenden Angriff hat Wissenschafter Michael Poole, der herausragende Kopf der Menschheit, dem Xeelee Rache geschworen. Und fliegt ihm mit drei Raumschiffen, die nicht schneller als das Licht sind, zum 25.000 Lichtjahre entfernten Milchstraßenzentrum hinterher (ebenso viele Jahre wird daher der Trip für Außenstehende dauern, während an Bord dank Zeitdilatation nur wenige Jahre verstreichen). Es ist ein Wahnsinnsplan, nicht nur aufgrund des Zeithorizonts, sondern vor allem angesichts des technologischen Unterschieds zwischen Menschen und Xeelee: Als würde eine Raupe den Kampfjet, der ihren Baum abgefackelt hat, über den Ozean bis zu seiner Militärbasis verfolgen wollen. Aber von geringen Chancen lässt sich ein Poole nicht beirren.
Mit einem Trick baut Baxter von Anfang an Distanz zu seinem getriebenen Protagonisten auf: Hauptfigur von "Redemption" ist nicht Michael Poole selbst, sondern dessen virtuelle Kopie Jophiel. Solche Virtuals (man kann sie sich in etwa wie den Holo-Doc aus "Voyager" vorstellen) werden in der Romanwelt anlassbezogen angefertigt und meistens bald wieder samt ihren Erfahrungen ins Original "reintegriert". Jophiel allerdings bleibt autonom und entwickelt sich von seinem Original in eine etwas nachdenklichere und letztlich menschlichere Richtung weiter. Er stimmt uns früh darauf ein, auf welche Botschaft der Roman letztlich hinausläuft: nämlich wie leer sich blinde Rache anfühlen kann.
An dieser Stelle sei auf den Titel hingewiesen. "Redemption" (also die Erlösung von Schuld) gilt hier zweifach: zum einen für Michael Poole, dessen Pioniertaten die Menschheit ein ums andere Mal in Ereignisse von kosmischer Tragweite gestürzt haben – in den früheren Erzählungen ebenso wie in der aktuellen Duologie, die einen alternativen Geschichtsverlauf etabliert hat. Der Begriff lässt sich aber auch auf die Xeelee beziehen, deren jahrtausendelanger Krieg mit der Menschheit letztlich auf einem Missverständnis basierte. Dass die Absichten der Xeelee nie bösartiger Natur waren, wurde früher schon angesprochen und wird in diesem Roman noch einmal stark hervorgekehrt.
Was geboten wird
"Redemption" ist geradezu eine Revue an SF-Motiven. Generationenschiffe, Aliens und virtuelle Existenzen kommen darin ebenso vor wie das Thema Evolution und die Frage nach dem Schicksal der Menschheit, das vielleicht größte Big Dumb Object aller Zeiten (dazu später noch mehr) und so zum Drüberstreuen das Werden und Vergehen des ganzen Universums. Und was den bereits etablierten Xeelee-Themenpark anbelangt, dürfen sich Altfans auf ein Wiedersehen mit den Silbergeistern und den Qax, dem Großen Attraktor und der ekeligen Schwarmlebensform aus dem Unterzyklus "Kinder des Schicksals" freuen. Es gibt sogar Verweise, bei denen sich in einem Baxter-Quiz die Spreu vom Weizen trennen würde – Stichwort Goobers Stern ... Aber keine Angst: Die Duologie lässt sich auch locker für sich allein lesen.
Im Wesentlichen gliedert sich der Roman in drei Abschnitte. Im ersten sind wir an Bord der Verfolgerflotte, im zweiten besuchen wir ein System, dessen Stern gerade gezielt zur Nova-Explosion gebracht werden soll (sowas fällt im Baxter'schen Kosmos noch unter kleinere Ereignisse). Im dritten schließlich bekommen wir es mit der Hauptattraktion des Romans zu tun: einer gigantischen radförmigen Struktur, die der flüchtige Xeelee im Zentrum der Milchstraße konstruiert hat. Rein vom Plot her sind die Parallelen zu Larry Nivens "Ringwelt" hier unübersehbar – es spielt sich bloß alles in wesentlich größeren Dimensionen ab.
Das größte BDO ever
Das Xeelee-Rad hat einen Durchmesser von zwei Lichtjahren und rotiert mit annähernd Lichtgeschwindigkeit. Dadurch vergrößert sich nicht nur seine Fläche gewaltig (ein spannender Nebeneffekt relativistischer Geschwindigkeit, den Baxter zusammen mit vielen anderen physikalischen Phänomenen in lockerem Ton erklärt), es macht die ganze Konstruktion auch gewissermaßen zu einer Zeitmaschine.
Für jeden Tag, den unsere winzigen Helden auf dem rasenden Rad verbringen, vergehen draußen im All 14.000 Jahre. Da spüren wir den Atem der Ewigkeit, wenn Michael, Jophiel & Co flüchtige Eindrücke von den Aktivitäten ihrer fernen Nachfahren draußen in der Milchstraße erhaschen und nur noch spekulieren können, wie es denen wohl ergeht. (An dieser Stelle sei noch einmal auf Peter Watts' famose Novelle "The Freeze-Frame Revolution" verwiesen, die ein ähnliches Gefühl der Entrückung hervorzurufen vermag.)
Wenn sich an einer Stelle Michaels Weggefährtin und Kritikerin Nicola an dessen kopiertes Bewusstsein wendet, dann scheint sie ihren Kommentar in Wahrheit an Stephen Baxter selbst zu richten: "You always were one for spectacle, weren't you?"
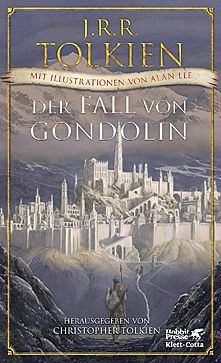
J. R. R. Tolkien & Christopher Tolkien: "Der Fall von Gondolin"
Gebundene Ausgabe, 352 Seiten, € 22,70, Klett-Cotta 2018 (Original: "The Fall of Gondolin", 2018)
Der Großen Geschichten der Ältesten Tage letzter Teil: Zum dritten Mal nach "Die Kinder Húrins" und "Beren und Lúthien" führt uns Christopher Tolkien mit einer sorgfältigen Bearbeitung der Originaltexte seines Vaters ins Erste Zeitalter der Sonne zurück. Das freilich noch gar nicht so hieß, als J. R. R. Tolkien seine Mythologie vom Leben und Leiden der Elben in Beleriand ursprünglich konzipierte – die späteren Zeitalter samt Ringen und Hobbits hatte er damals noch gar nicht ersonnen.
Those were the days, my friend
Angesichts von Tolkiens latent hierarchischer Ethnographie bedeutet das zugleich, dass hier alles eine Ebene "höher" angesiedelt ist als im "Herrn der Ringe": Statt Maiar wie Gandalf und Sauron werden hier die Valar selbst – de facto also die Götter – aktiv, allen voran der ewige Antagonist Morgoth und der Herr der Meere und Flüsse, Ulmo. Statt Menschen stellen noch Elben den ausschlaggebenden Teil der Weltbevölkerung. Und mindere Sterbliche, die im Geschehen die Rolle von Katalysatoren einnehmen, sind in diesem Zeitalter nicht Hobbits, sondern Menschen.
Genauer gesagt ist es der einzelgängerisch veranlagte Mann Tuor, der von Ulmo den Auftrag erhält, die verborgene Elbenstadt Gondolin aufzusuchen. In dieser Epoche hält Morgoth Mittelerde fest in seinem Würgegriff. Die stolzen Elben sind getötet, versklavt oder in die Flucht getrieben worden. Als letzte der glorreichen Elbenstädte ist nur noch Gondolin geblieben, das in einem ringsum von Bergen umschlossenen Tal vor Morgoths Blick verborgen ist. Und über eine eigene Fliegerabwehr in Form von Bogenschützen und Thorondors Adlern verfügt, wie wir an einer Stelle erfahren: Das nur als Info für alle, die wieder mal eine Logiklücke argwöhnen – schließlich hat Morgoth in seinem Gefolge allerhand fliegendes Geschmeiß, dem die schimmernden Türme Gondolins eigentlich nicht entgehen dürften ...
Verschiedene Fassungen
Wie schon im Band "Beren und Lúthien" legt uns Christopher Tolkien nacheinander die verschiedenen – und in vielen Details oft widersprüchlichen – Fassungen der Geschichte vor, die sein Vater im Lauf von Jahrzehnten niedergeschrieben hat. Manche sind nur skizzenhaft, zwei hingegen lassen mit ihren 60 respektive 80 Seiten das Epos erahnen, das Tolkien zeitlebens durch den Kopf ging, mit dem er aber in den Worten seines Sohnes letztlich "Schiffbruch erlitt". Es hat nie ein Pendant zum "Herrn der Ringe" gegeben, auch nicht in Gestalt dieses Bands: Das sei hier sicherheitshalber noch einmal ausdrücklich festgehalten – für den Fall, dass es wirklich noch jemanden gibt, der an verschollene Romane Tolkiens glaubt.
Die in ihrer Erzählweise elaborierteste Fassung ist der 1951 entstandene, grob 60-seitige Text, der später unter dem Titel "Tuor und seine Ankunft in Gondolin" veröffentlicht wurde – in den 80ern kam er sogar als eigenes kleines Bändchen auf den Markt. Hier ist die Erzählung am detailreichsten, dafür reicht sie aber dem posthum gewählten Titel entsprechend tatsächlich nur bis zu dem Moment, in dem Tuor zum ersten Mal die verborgene Stadt erblickt.
Aus der Historie gespeiste Mythologie
Das, was Christopher Tolkien in diesem Band schlicht "Die ursprüngliche Geschichte" nennt, erzählt hingegen auf 80 Seiten die ganze Story, von Tuors Queste über seine Zeit in Gondolin bis zu Belagerung und Fall der Stadt. Dieser Text, der den Band eröffnet, entstand bereits während des Ersten Weltkriegs. Was man ihm auch anzumerken glaubt, wenn man liest, wie Tolkien die Belagerungsmaschinerie Morgoths beschreibt:
Manche waren ganz aus Eisen und so kunstreich mit Gliedern versehen, dass sie wie langsame Flüsse aus Metall strömten, sich um Hindernisse herumwinden oder über sie kriechen konnten, und sie bargen in ihrem Inneren die grausamsten Orks, bewaffnet mit Krummsäbeln und Speeren; andere waren aus Bronze und Kupfer und hatten Innereien aus loderndem Feuer, und mit ihrem entsetzlichen Flammenspeien vernichteten sie alles, was vor ihnen stand, oder sie zertrampelten, was immer der verzehrenden Glut ihres Atems entging; doch wieder andere waren Kreaturen aus reinem Feuer, die sich wanden wie Schlangen geschmolzenen Metalls, und sie vernichteten jedweden Stoff, der in ihre Nähe kam, und Eisen und Stein lösten sich vor ihnen auf und wurden wie Wasser, und darauf ritten die Balrogs zu Hunderten ...
Hunderte Balrogs! Wie gesagt, im Ersten Zeitalter war alles noch etwas größer dimensioniert. Und auch wenn man in Tolkiens Schaffen jede Menge wiederkehrende Motive findet und hier die Schlacht um die Hornburg und die Belagerung von Minas Tirith ihren Vorläufer haben – neben den Kämpfen in Beleriand nimmt sich der Ringkrieg aus wie der Krieg der Knöpfe.
Zurück auf den Boden
Auf die verschiedenen Originaltexte folgt dann noch eine vergleichende Analyse Christopher Tolkiens, mit der "Der Fall von Gondolin" endgültig in den literaturwissenschaftlichen Bereich wandert; spätestens hier dürften sich die Tolkienologen von den bloßen Tolkien-Fans scheiden. Glossar, Ahnentafeln und die gewohnt sepia-getönten Illustrationen von Tolkiens Hofillustrator Alan Lee sind – wie man eigentlich schon erwartet – vorhanden. Dazu ist noch eine faltbare Karte von Beleriand beigelegt, dem Land (oder Subkontinent?), das zu Zeiten des "Herrn der Ringe" längst im Meer versunken ist.
Und irgendwie kommt man am Ende nicht drum herum, die Gedanken aufs aktuelle Tolkien-Thema Nummer 1 zu richten: Wir wissen, dass Amazon in Kooperation mit Tolkiens Erben eine TV-Serie plant, die Geschehnisse aus der Zeit vor dem "Herrn der Ringe" zum Inhalt haben soll. Geht man rein nach der Materialmenge, die Tolkien hinterlassen hat, dann würden sich die Großen Geschichten der Ältesten Tage heftig für eine Adaption anbieten: Zu keiner anderen Phase der Vorgeschichte von Mittelerde ist eine derartige Stoffdichte vorhanden. Darauf wetten würde ich allerdings nicht. Der momentane Stand der Gerüchte läuft darauf hinaus, dass die Prequel-Serie zunächst einmal die Jugendjahre Aragorns ins Auge fassen wird. Schau mer mal.

Stephen King: "Der Outsider"
Gebundene Ausgabe, 752 Seiten, € 26,80, Heyne 2018 (Original: "The Outsider", 2018)
Meine große Stephen-King-Phase hatte ich so um 20 herum, danach hab ich den Großmeister des Horrors wieder aus den Augen verloren. Was eigentlich etwas paradox ist, weil im selben Zeitraum seine Bücher immer unübersehbarer – soll heißen: fetter – wurden. Nach langer weitgehender Abstinenz mit nur ein paar Ausnahmefällen hab ich mir nun aus einer Laune heraus seinen jüngsten Roman gegriffen ... und zu meiner Freude einen weitgehend klassischen King vorgefunden. Also einen, der doch nicht nur ein Krimi ist, in dem das Metaphysisch-Philosophische aber auch nicht so sehr überhandnimmt, wie es das für meinen Geschmack in der Reihe um den "Dunklen Turm" tut. (Sorry, "Turm"-Fans!)
Klassisch zumindest zum Teil. Ehe nämlich – so viel darf oder muss sogar gespoilert werden – die Protagonisten des Romans in gewohnt King'scher Manier bedrohliche Begegnungen mit einer übernatürlichen Gestalt haben, folgt "Der Outsider" über längere Zeit hinweg dem Muster eines anderen Genres: Police procedural würde man dazu auf Englisch sagen, also den Vorgang der Ermittlungen nach einem Verbrechen beschreibend. Zu diesem Zweck wechseln einander in den ersten Kapiteln Niederschriften von Zeugenaussagen und die ausführlich geschilderte Verhaftung des Tatverdächtigen ab.
Ein Mann an zwei Orten
Die Tat hatte es übrigens in sich: Ein elfjähriger Bub wurde vergewaltigt, getötet und teilweise angefressen. Das kleine Städtchen Flint City in Oklahoma ist im Schock – erst recht, als nun der allseits beliebte Coach der Schulmannschaft, Terry Maitland, als mutmaßlicher Täter verhaftet wird; vor nicht allzu langer Zeit hatte man ihn noch zum Mann des Jahres gewählt. Die Beweislast ist erdrückend, sowohl Zeugenaussagen als auch Fingerabdrücke und letztlich der DNA-Test belegen Maitlands Schuld.
... wäre da nicht der Umstand, dass es genauso unumstößliche Beweise dafür gibt, dass Maitland zur Tatzeit in einer anderen Stadt war. Für geübte Phantastik-Leser ist klar, dass hier eine Erklärung jenseits des Natürlichen vorliegen muss. So weit, dies anzuerkennen, ist der Polizist Ralph Anderson mit seinem Team aber noch nicht – auch wenn ihn zunehmend Zweifel an dem, was er als ermittlerischen Triumph inszenieren wollte, beschleichen. Und bald ist es ohnehin zu spät für Wiedergutmachung: Maitland wird gelyncht und Anderson steht vor einem Scherbenhaufen. Vom Fehler der öffentlichen Verhaftung abgesehen, dürfen wir uns Anderson übrigens ganz wie einen der King-typischen Sympathieträger à la Alan Pangborn vorstellen. Und uns sicher sein, dass er anständig und mutig genug ist, das Rätsel um den wahren Täter nicht auf sich beruhen zu lassen.
Kontext und Kontinuität
Noch einmal zurück zum "Dunklen Turm". Für mich einer der Hauptstörfaktoren an diesem äußerst populären Erzählzyklus ist, dass er das Phänomen der Retroactive continuity in Kings Werk eingebracht hat, also der nachträglichen Umdeutung und (Pseudo-)Kontextualisierung. Das begeistert mich selten, und ich sehe auch keine Notwendigkeit dafür. Romane wie "Es" oder "The Stand" stehen ausgezeichnet für sich selbst – da muss man sie nicht nachträglich in ein größeres Ganzes hineinkrampfen.
Natürlich lässt sich auch "Der Outsider" da irgendwie integrieren, glücklicherweise kann man das Buch aber auch für sich allein lesen. Querverbindungen gibt es zwar – ob man sie erkennt oder nicht, macht für das Vergnügen an der Lektüre aber keinen Unterschied. Langjährige King-Fans werden sich freuen, dass Holly Gibney aus der Bill-Hodges-Trilogie ("Mr. Mercedes" & Co) ein Comeback feiert. Neulinge hingegen mögen sich kurz wundern, dass sich knapp vor der Hälfte des Romans eine neue Hauptfigur zu den bisherigen gesellt. Sie werden die einzigartige Holly mit all ihren Verschrobenheiten aber bald liebgewinnen, das ist garantiert.
Das menschliche und das unmenschliche Grauen
Dass sich Stephen Kings Ruf in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive von dem eines Horror-Stars zu dem eines ganz allgemein anerkannten Schriftstellers gewandelt hat, geht an der Interpretation seiner Werke nicht spurlos vorüber. Gerne wird die gesellschaftsbetrachtende Komponente betont – dass "Der Outsider", wie gelesen, Trump-Amerika und dem Zeitalter allseitiger Fake-News einen Spiegel vorhalten würde, erscheint mir allerdings trotz der Schilderung des Aufruhrs in Flint City ziemlich an den Haaren herbeigezogen.
Und ich habe bei King auch schon in tiefere menschliche Abgründe geblickt. Der erste Abschnitt ist eigentlich recht trocken – die Emotion, die hier hauptsächlich durchkommt, ist die Überraschung über einen Mann, der gleichzeitig an zwei Orten zu sein schien. Erst mit etwas Verspätung läuft King zur Hochform auf, wenn er in eindringlicher Weise die Folgen des Mordes für die Familien sowohl des Opfers als auch des vermeintlichen Täters schildert. Maitlands Frau Marcy etwa findet sich mit ihren Töchtern von einem Tag auf den anderen in einem vollkommen anderen Leben wieder. Plötzlich wird ihr Alltag von ganz neuen Routinen wie Anwaltsgesprächen, Gefängnisbesuchen und Freunden, die sich von ihr abwenden, bestimmt. Eine Maschine hatte Marcys Familie geschluckt – das sind Gänsehautpassagen.
Und Stichwort Gänsehaut: Dass "Der Outsider" beizeiten noch die Kurve vom Krimi in den Horror kriegt, wurde ja eingangs schon gesagt. Nicht von ungefähr ähnelt das Grüppchen um Ralph und seine Frau Jeannie, Holly, Marcy und ein paar andere den Protagonistenkonstellationen aus King-Klassikern wie "Es". Kings Neuer ist also einmal mehr das, was man sich von diesem Autor immer erwartet hat: ein Pageturner. Selbst wenn der ganze Riesenroman letztlich nichts anderes ist als eine stark verlängerte "Akte X"-Folge.
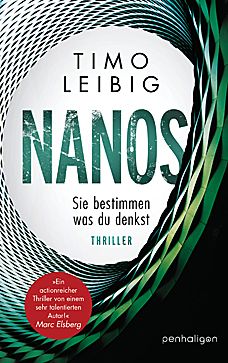
Timo Leibig: "Nanos"
Klappenbroschur, 510 Seiten, € 16,50, Penhaligon 2018
"In Kehlis!" ist das neue "Heil Hitler!" in einem Deutschland des Jahres 2028, das nach dem Zerfall der EU isoliert ist und sich zu einer totalitären Diktatur gewandelt hat. Das Szenario ist zugleich ein geglückter Genrewechsel des deutschen Autors Timo Leibig, der schon eine Reihe von Thrillern und Krimis via Selfpublishing veröffentlicht hat und nun mit "Nanos" seinen ersten Titel bei einem regulären Verlag herausbringt.
"Nanos" stellt sich ganz in die Tradition dystopischer Romane aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als uniforme Massenlenkung – inspiriert vom Aufstieg des Faschismus – recht einfach durchführbar schien. Es brauchte nur einen gewissen technischen Kniff. In Aldous Huxleys "Schöne neue Welt" hält die Droge Soma die Bevölkerung bei Laune. Leibigs Idee ist im Grunde die gleiche, auch wenn sie auf Nanotechnologie basiert. Die tückischen Partikel – verbreitet über Lebensmittel und Wasserversorgung – stellen die Menschen ruhig und impfen ihnen Gehorsam gegenüber dem neuen Führer Johann Kehlis ein. Im Prolog dürfen wir miterleben, wie sich ein solcherart angstbefreiter Proband auf die höfliche Bitte des Versuchsleiters hin einen Finger abschneidet: "Klar, kann ich schon tun."
Der Antiheld
Das System lernen wir ausnahmsweise nicht über jemanden kennen, der darin lebt, sondern der den politischen Wandel nur am Rande mitbekommen hat – er saß während der entscheidenden Jahre nämlich im Gefängnis. Malek Wutkowski war mal Söldner, später Verbrecher – ist also gut auf die Rolle des Action-Trägers vorbereitet. Zum ersten Mal kommt er mit der Staatsmacht in blutigen Direktkontakt, als er nach geglückter Flucht aus dem Gefängnis mit seinem Komplizen mitten im Wald aufgespürt wird. Den anschließenden Kugelhagel überlebt Malek als einziger, kurz darauf wird er von einer Gruppe Widerstandskämpfer aufgelesen.
Sonderlich beeindruckt ist Malek von den Rebellen nicht: Er betrachtet sie als Spießer mit Bügelfalten, Kampfqualitäten kann er bei ihnen keine erkennen – und genau das ist seine Chance. Er lässt sich für den Widerstand engagieren, ohne aber in den Verhandlungen zu verhehlen, dass er genauso gut für Kehlis arbeiten könnte: Vitus lächelte kalt. "Sie könnten sofort bei ihm einsteigen." – "Wenn er mehr bieten würde als Sie ..." Unbehagliches Schweigen folgte. – Ein amoralischer Romanheld also, ähnlich Donald Westlakes Figur Parker? Man wird sehen – dagegen spricht aber, dass Malek seinem Komplizen am Sterbebett versprochen hat, sich um dessen Schwester Maria zu kümmern. Womit wir bei der zweiten Hauptfigur wären.
Die Zeitzeugin und der Antagonist
Maria Müller führt ein vermeintlich ganz normales Leben als Ehefrau und Mutter. Allerdings ist sie free, die Nanos wirken bei ihr nicht. Die von Kehlis' Konzern vertriebenen Bio-Lebensmittel lösen bei ihr (und anderen) eine Abstoßungsreaktion aus. Dass sich diese in Form heftiger Bauchschmerzen äußern, ist gleichzeitig – ob als solches geplant oder nicht – ein passendes Symbol für Marias Reaktion auf den politischen Wandel in Deutschland.
Aus Marias Augen erleben wir mit, wie sich der Alltag verändert. Wir lesen von der sukzessiven Gleichschaltung der Bevölkerung, der Omnipräsenz von Johann Kehlis in allen Medien ("1984" lässt grüßen), der Angst vor Spitzeln und der verzweifelten Suche nach Gleichgesinnten, von der Gewalt der Exekutive gegen verdächtige Bürger und von sich häufenden Verschleppungen. Das ist jetzt nichts, was man noch nie gelesen hätte, aber es wirkt immer wieder.
Die dritte Hauptfigur trägt keinen Namen. Konfessor Nummer Elf gehört zur Elite des Systems. Mit seinen optimierten Analysefähigkeiten und mehr noch seinem Priesterkragen erinnert er ein bisschen an den "Kleriker" Christian Bale aus dem 2002er-Film "Equilibrium", wozu im übrigen auch das Motiv künstlich unterdrückter Gefühle passt: "Arbeiten Sie an Ihren Emotionen", das lässt man sich von einem Konfessor nicht zweimal sagen. Wie die vermeintliche Hausfrau Maria hat aber auch Konfessor Nummer Elf verborgene Seiten ...
Süffig erzählt
Ja, das Szenario ist – wie schon in den klassischen Dystopien, auf deren Schultern "Nanos" steht – etwas holzschnittartig. Das stört aber nicht wirklich. In den Jahren des Selfpublishings hat Leibig sein Handwerk offenbar gelernt. Die Handlung läuft wie ein Uhrwerk ab, das Tempo ist hoch, die Darstellung von Gewalt nicht zimperlich: alles Faktoren, die zum zügigen Weiterlesen animieren – unterbrochen höchstens von einem kurzen gedanklichen Abschweifen, wer Malek Wutkowski in einer Verfilmung am besten porträtieren könnte. Ungeachtet des "Equilibrium"-Vergleichs wäre es übrigens eine klassische Rolle für Jason Statham.
Kleine Hiobsbotschaft am Schluss: Die Handlung von "Nanos" wird zu einem Ergebnis führen, aber nur zu einem Teilergebnis. So schnell lässt sich ein totalitäres System eben nicht beseitigen. Immerhin soll der nächste Band bereits 2019 erscheinen.
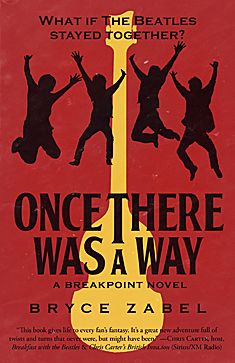
Bryce Zabel: "Once There Was a Way: What If The Beatles Stayed Together?"
Broschiert, 308 Seiten, Diversion Books 2017, Sprache: Englisch
Was, wenn es schon vor 50 Jahren eine "Herr der Ringe"-Verfilmung gegeben hätte, mit Stanley Kubrick als Regisseur und den Beatles als Hauptdarstellern? (Man stelle sich vor: John Lennon als Gollum, Paul McCartney als Frodo, Ringo Starr als Sam und George Harrison als Gandalf.) Die am bizarrsten erscheinende Idee in Bryce Zabels Alternativweltgeschichte "Once There Was a Way" ... ist zugleich eine, die beinahe Wirklichkeit geworden wäre. Entsprechende Pläne gab es nämlich tatsächlich, ehe Kubrick das Projekt dann doch in den Wind schoss. Hier hingegen wird der Film gedreht und zum Welterfolg.
Die "HdR"-Episode ist eines von vielen Beispielen in "Once There Was a Way", in denen der US-amerikanische TV-Produzent und Drehbuchautor Bryce Zabel ganz nah an der Wirklichkeit blieb, um dennoch eine vollkommen andere Lebensgeschichte der berühmtesten Band aller Zeiten zu erzählen. Man wird während des Lesens immer wieder zu Google und Wikipedia greifen, um erstaunt festzustellen, dass Zabels Spekulationen keineswegs aus der Luft gegriffen sind, sondern mit einem kleinen bisschen Glück zur richtigen Zeit hätten wahr werden können. Das Ergebnis ist ein fiktives Sachbuch und ein – zugegebenermaßen recht nerdiges – Vergnügen.
Ach, machen wir doch einfach weiter
Die Handlung setzt 1968 ein, als es innerhalb der Band schon ziemlich kriselt und Lennon & McCartney in der Johnny-Carson-Show einen Auftritt haben. Der verlief in der Realität recht unbefriedigend und verstärkte daher die Spannungen noch – hier hingegen nimmt er eine positive Wendung. Es ist nicht das singuläre Ereignis, ab dem nach klassischer Alternativwelt-Machart alles anders ist. Sondern nur einer von mehreren Anlässen, die in Zabels fiktiver Welt stets ein versöhnlicheres Ende nehmen, als in den Geschichtsbüchern steht. So entschließt sich Lennon, das umstrittene "Revolution 9" doch nicht aufs Weiße Album zu quetschen (Wie gesagt: Hier geht's manchmal sehr ins Detail!). Und die Beatles treten in Woodstock auf, was sie zwar Nerven kostet, aber auch wieder ein bisschen mehr zusammenschweißt. Zumindest für einige Zeit.
Mit Müh und Not werden die zentrifugalen Kräfte innerhalb der Band in Schach gehalten, bis es 1970 zu einem reinigenden Showdown kommt. Im Haus von George Harrison treffen die vier Beatles samt familiärem Anhang und Beratern aufeinander und verhandeln über das weitere Schicksal der Band. Das ganze Buch ist in einem journalistischen, leicht ironischen Ton geschrieben, aber hier läuft Zabel zur Hochform auf. Denn was eigentlich nur eine Party mit alten Freunden ist, liest sich wie ein Gipfeltreffen verfeindeter Machtblöcke und ist durch diese Unverhältnismäßigkeit entsprechend witzig.
"If John thinks war can be ended just by changing your mind and thinking differently," Paul said to Ringo, "then maybe he'll change his mind about the band." Ringo considered this over a cigarette before offering his opinion. "Don't count on it," he concluded. "Wars are simple things. The Beatles have real issues."
And the band played on
Ergebnis der Verhandlungen ist jedenfalls der Grand Bargain, kurz gesagt: Die Band macht weiter, bringt neue Platten auf den Markt (die Tracklisten mit diversen Titeln bestückt, die wir unter anderem von den Solo-Projekten der Fab Four kennen) und bleibt die Nummer 1 der Welt. Als die Bandauflösung abgewendet wird, sind wir erst bei einem Drittel des Umfangs angekommen. Aus der Zeit danach seien nur ein paar besondere Perlen genannt: So wird John Lennon von Terroristen entführt, Ringo Starr mausert sich zum neuen Q der Bond-Filme und Steve Jobs höchstselbst kommt zu einem ganz besonderen Auftritt.
Als detaillierte Chronologie wird das Ganze allerdings nur bis ins Jahr 1976 geführt. Nach der eigentlichen Handlung gibt es dann noch ein Interview, in dem die überlebenden Beatles auf ihr 50-jähriges Jubiläum zurückblicken. Und in dem Paul noch einmal erklärt, warum der Geschichtsverlauf von "Once There Was a Way" der bessere gewesen wäre: "If that had happened, that we broke up at the end of the '60s, we would have lived over four decades as a myth. That's not living. Living is living. This is better."
Für Genießer
Vor Kurzem hat "Once There Was a Way" den Sidewise Award für den besten Alternativweltroman des Jahres gewonnen. Und auch wenn es der Form nach streng genommen kein Roman ist, hat es diesen Preis verdient – alleine schon wegen der originellen Prämisse. Mal nicht das übliche "Hitler hat den Krieg gewonnen" oder "John F. Kennedy wurde nicht ermordet" (diesen konventionelleren Stoff hat Zabel freilich auch schon verarbeitet, nämlich in seinem 2015er Buch "Surrounded by Enemies").
Die Frage, wie aus dieser Prämisse ein für alle interessantes Buch werden kann, bleibt letztlich aber offen – so sehr mir die Lektüre auch Vergnügen bereitet hat. Wer an den Beatles kein Interesse hat, findet hier maximal das Porträt einer politisch bewegten Zeit, in der die Gesellschaft ähnlich polarisiert war wie heute. All die vielen Details, mit denen Zabel sein Szenario ausgestaltet hat, der Witz und die Subtilität, mit denen er der Geschichte einen anderen Verlauf gegeben hat: Das werden nur die genießen können, die entweder musikgeschichtliches Wissen mitbringen – oder die Bereitschaft, sich dieses parallel zur Lektüre anzueignen. So ist "Once There Was a Way" ein Paradebeispiel für die Frage "Was wäre, wenn ...", die am Anfang jeder Alternativweltgeschichte steht. Aber auch ein Paradebeispiel für Special Interest.
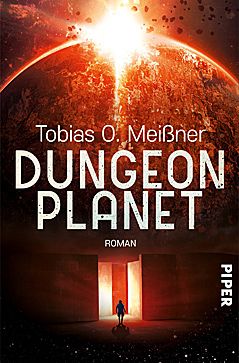
Tobias O. Meißner: "Dungeon Planet"
Klappenbroschur, 400 Seiten, € 15,50, Piper 2018
Nun ein Buch, das einen etwas eigenwilligen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Nicht, weil Tobias O. Meißner inzwischen eine feste Größe in der deutschsprachigen Fantasy-Szene ist ("Die Soldaten", "Barbarendämmerung") und nun einen unvermuteten Wechsel zurück in die Science Fiction vollzogen hat. Nicht wegen des ungewöhnlichen Szenarios. Und auch nicht, weil Meißner wie gehabt seinen ganz eigenen Stil pflegt, den kein Lektorat der Welt komplett streamlinen könnte. Sondern deshalb, weil "Dungeon Planet" eher wie zwei aneinandergeflanschte Novellen wirkt, von denen die zweite die Handlung der ersten weitgehend wiederholt.
In ungewohntem Ambiente
Als wollte er uns Meißners neue Faszination für den Weltraum verdeutlichen, bewundert zu Beginn des Romans der Raumfahrer Jephron Girant von seinem Cockpit aus die Säulen der Schöpfung (einen Teil des Adlernebels, den ein Bild des Hubble-Teleskops weltberühmt gemacht hat). Jephrons ehrfürchtiges Staunen wirkt fast ein bisschen naiv – andererseits ist es auch mal ganz schön, wenn wir es nicht mit einem abgebrühten Weltraumveteranen zu tun haben, der für die Wunder des Kosmos nicht mal mehr einen Seitenblick erübrigen kann.
Apropos Wunder: Es ist nicht so, als gäbe es in "Dungeon Planet" keine Ungereimtheiten. Da hätten wir einen ziemlich obskuren Überlichtantrieb und nicht näher erklärte physikalische Phänomene, über die selbst die Xeelee staunen würden (die Sternenkorridore, durch die sich Raumschiffe bewegen, werden nicht nur von Materie, sondern auch von Strahlung frei gehalten?). Und das alles, obwohl der technologische Stand, soweit beschrieben, ansonsten eher ans 21. als ans 31. Jahrhundert denken lässt. Aber sei's drum, soll ja keine Hard SF sein.
Eine Galaxis voller Themenparks
Kurz zum Hintergrund, der uns im ersten Romankapitel als geballte Exposition aufs Auge gedrückt wird: Wir befinden uns etwa 1.000 Jahre in der Zukunft. Die Menschheit hat sich über einen beträchtlichen Teil der Galaxis ausgebreitet; die wenigen Alienspezies, von denen man weiß, scheuen den Kontakt. Eine ordnende Struktur im Sinne einer Sternenföderation gibt es nicht, die Kolonialwelten spielen lieber ihre eigene Musik: Es gab Bordellplaneten, Wassersportplaneten, [...] Planeten für Fruktarier, einen garantiert pollenfreien Planeten für Allergiker, es gab einen Jazz-Planeten, einen Gothic-Planeten, einen Fußballturnier-Planeten ... und immer so weiter, wie Meißner in einem bemerkenswert langen Satz aufzählt, der sich fast über eine ganze Seite erstreckt.
Kurz gesagt: Von den 6.000 bereits besiedelten Planeten haben etwa 1.000 den Charakter von Themenparks, so weit haben sie ihr Spezialistentum vorangetrieben. Eine herausragende Stellung nimmt dabei die Welt Laurel ein, auf der alljährlich die galaxisweit geglotzte Gameshow Dungeoncrawler stattfindet. Deren Teilnehmer müssen "Schätze" aus einem unterirdischen Labyrinth bergen und sich dabei der "Monster" erwehren, die man dort ausgesetzt hat: ob Riesenkäfer, Wurmknäuel oder bisonköpfige Halbmenschen – für Dungeoncrawler wurde in der halben Milchstraße all das zusammengerafft, was einen telegen blutrünstigen Eindruck macht. Und irgendwo ganz unten im Labyrinth lauert der legendäre Minosaurus. Mit "s".
Ich war einmal berühmt
Hauptfigur Jephron Girant hat vor Jahren an der Show teilgenommen, unter spektakulären Umständen überlebt und genießt bis zum heutigen Tag den Status der Semiprominenz. Alljährlich zieht es ihn nach Laurel zurück – nicht um noch einmal teilzunehmen, sondern um wieder dort zu sein, wo er noch ein bisschen was ist. Mal ein Autogramm geben, mal einen kleinen Extrarabatt bekommen, die kleinen Freuden halt. Gerne schlendert er während der Show-Saison durch die Straßen und findet es schade, dass er immer seltener erkannt wird. Es ist eine Figur, die man sich gut vorstellen kann – mit Blick auf die "Survivors" unserer eigenen Welt, die noch über Jahre hinweg von ihrem verblassenden "Big Brother"- und "Bachelor"-Ruhm zu zehren versuchen. Irgendwie melancholisch.
Insofern passt es auch gut zu Jephron, dass er sich von der jungen Bjanje Cilings überreden lässt, mit ihr noch einmal an Dungeoncrawler teilzunehmen. Zum Teil geschieht es aus Verantwortungsgefühl für die ehrgeizige, aber vermutlich hoffnungslos überforderte Kandidatin, zum Teil ist es der Kitzel, noch einmal den Höhepunkt seines bisherigen Daseins nachzuerleben. Und der Batzen Geld, den es zu gewinnen gibt, spielt natürlich auch eine Rolle. (Bjanjes Motivation für die Teilnahme ist übrigens weniger nachvollziehbar, zumindest hat sie sich mir nicht erschlossen.) So weit, so gut.
Auf in die Reprise
Also steigen die beiden ins Labyrinth hinab und der Roman wechselt die Tonlage. Es gilt, sich mit Hieb- und Stichwaffen der diversen Monster zu erwehren; die Show wäre übrigens ein Albtraum für Tierschützer. Die Action gleicht nun der in einem Videospiel und ist auch entsprechend repetitiv: Stunden vergingen, zogen sich wie Reisbrei. An diesen Kapiteln dürften sich die Geister scheiden. Ich persönlich konnte solcher Art Action noch nie viel abgewinnen: Eine Falle wird überwunden oder nicht, ein Zweikampf wird gewonnen oder nicht, eine Verfolgungsjagd endet mit dem Entkommen oder nicht – kommen wir bitte zum Ergebnis. Gamer und alle, die das Wie-es-dazu-kam in Echtzeit genießen können, werden hier dafür gut bedient.
In der Mitte des Bands ist die Queste von Jephron und Bjanje zu Ende. Und dann ... geht alles wieder von vorne los. Es sind wieder Jahre vergangen, Jephron hat sich von der Show entfernt, lässt sich aber von Bjanjes Schwester einmal mehr zu einem Comeback überreden, und es wird wieder gehauen und gestochen. Zwar haben sich die äußeren Umstände und auch Jephrons Einstellung inzwischen gewandelt, doch unterm Strich kommt im Großen und Ganzen noch einmal der gleiche Ablauf raus. Es ist ja durchaus nicht unüblich, dass ein Autor einer Erfolgsstory Jahre später eine abgewandelte Version der Originalgeschichte als Sequel veröffentlicht. So als Gesamtpaket auf den Markt gebracht, wirkt es auf mich aber eigenwillig.
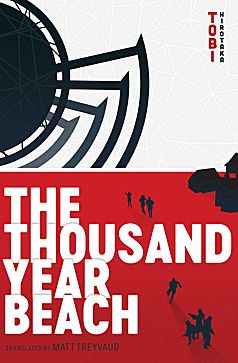
Tobi Hirotaka: "The Thousand Year Beach"
Broschiert, 336 Seiten, Viz LLC/Haikasoru 2018 (Japanische Originalveröffentlichung 2002), Sprache: Englisch
Was geschähe in Westworld, wenn eines Tages keine menschlichen Besucher mehr kämen? Das könnte man als eine der Ausgangsfragen von Tobi Hirotakas "The Thousand Year Beach" nehmen (das sich freilich nur auf die Original-Filme aus den 70ern beziehen könnte, nicht auf die aktuelle Serie, da die japanische Originalfassung schon 2002 erschienen ist). Dabei wird es aber nicht bleiben, und angehende Leser seien vorgewarnt: Dieser Roman wird einem einiges abverlangen – sowohl was die philosophischen Aspekte als auch was den Gore-Faktor betrifft.
Schauplatz des Geschehens ist die nach einem mediterranen Küstenstädtchen aussehende Realm of Summer, Teil eines an "Otherland" erinnernden Konglomerats virtueller Urlaubswelten. Seit dem Grand Down vor über 1.000 Sommern hat sich hier kein Besucher aus der realen Welt mehr eingefunden, und so spulen die Künstlichen Intelligenzen, die als Einwohner des Städtchens fungieren, Tag für Tag ihre idyllischen Routinen ab: Jules and his mother had been sitting down to breakfast in this dining room ever since the ChronoManager had begun keeping time one thousand and fifty years ago, and would presumably continue to do so in future.
Opfer des Tourismus
Die KIs in Menschengestalt sind sich ihres künstlichen Wesens vollauf bewusst. Sie kennen die Architektur ihrer Welt inklusive Teilen ihres Quellcodes. Und sie wissen auch, dass ihre Erinnerungen an die Zeit vor der Inbetriebnahme des Urlaubsresorts vorfabriziert waren, um sie mit Background-Storys zu versehen – dennoch hüten sie die Erinnerungen an Kindheitserlebnisse oder verstorbene Verwandte wie einen persönlichen Schatz. Sie betrachten sie als echten Teil ihrer Persönlichkeit. Hirotaka nimmt sich viel Zeit dafür, die KIs als menschliche Wesen darzustellen – was die Dinge, die ihnen widerfahren werden, nur umso grausamer erscheinen lässt.
Warum die Besucher ausbleiben, ist den KIs ein Rätsel. Sie spekulieren, ob es in der realen Welt eine Pandemie gegeben haben könnte oder ob einfach nur der Betreiber der Simulation pleitegegangen ist. Zum Teil bedauern sie ihre Isolation, da ihnen die Gastfreundschaft ja einprogrammiert wurde und Sinn ihrer Existenz ist. Sie sind aber auch erleichtert, denn wie wir aus einigen Rückblenden erfahren, haben sich die menschlichen Besucher der Realm of Summer genauso widerwärtig ausgetobt wie die von Westworld.
Hirotaka versteht es, idyllische Szenen vorwarnungslos in das nackte Grauen umschlagen zu lassen: Etwa wenn die junge Julie Geburtstag feiert und ihr "Vater" (eine der Rollen, die von wechselnden Besuchern verkörpert werden dürfen) ihr Kuscheltier als Festmahl serviert und begierig auf Julies Reaktion lauert. Oder wenn Pierre von seiner "kleinen Schwester" vergewaltigt wird. Wie gesagt: hier wird der Leser nicht geschont. Das Wesen des Leids ist das zentrale Motiv des Romans, und Hirotaka führt es uns auf vielfältige Weise vor Augen.
Der Horror beginnt
Auf die einstigen Exzesse der Besucher blicken die KIs aber fast nostalgisch zurück angesichts des Problems, das nun auf sie zukommt. Die Realm of Summer erlebt eine Invasion durch vielbeinige Maschinen, die sich wie Stephen Kings Langoliers durch die virtuelle Welt samt deren Bewohnern fressen. Die beiden jungen Hauptfiguren Jules und Julie sind die ersten, die Bekanntschaft mit diesen spiders machen – und bald tritt auch deren Lenker in Erscheinung. Der mysteriöse Langoni manifestiert sich – irgendwie fast wie Kings "Es" – in verschiedenen Inkarnationen, ist Mörder, Verführer und Zerstörer zugleich und verfolgt offenbar einen Plan, der über die bloße Vernichtung der Realm of Summer hinausgeht. (Nicht, dass das für die der Reihe nach massakrierten Einwohner ein Trost wäre.)
Diese Invasion beginnt bereits im ersten Kapitel, und der ganze folgende Roman ist eine einzige Abwehrschlacht auf verlorenem Posten. Je weiter der Kampf voranschreitet, desto surrealere Züge nimmt er an. Die Stadtbewohner setzen Glass Eyes genannte De-facto-Zaubersteine gegen die Maschinen ein – Langoni schlägt zurück, indem er Körper und Geist seiner Opfer infiltriert. Jules spinnt ein Abwehrnetz und erzeugt mit Hilfe seiner Mitstreiter Virtualitäten innerhalb von Virtualitäten, doch Langoni sickert auch hier ein. Dieses Geflecht wird immer komplexer und die Kampfhandlungen – gesprenkelt mit reichlich Body-Horror – immer abgehobener. Hirotaka verwendet eine vollkommen andere Sprache als William Gibson, um Cyberspace-Prozesse zu beschreiben, ist dabei aber nicht minder bildgewaltig.
Aufatmen, wenn's vorbei ist
"The Thousand Year Beach" folgt nicht unbedingt westlichen Erzählmustern. Das zeigt sich spätestens dann, wenn uns schließlich nach einigen Twists offenbart wird, dass der Knotenpunkt des Geflechts letztlich eine sehr persönliche Geschichte ist. Diese Auflösung kann man mögen oder nicht. Einen Kritikpunkt – an einem ansonsten beeindruckenden Roman – hätte ich aber auf jeden Fall: Gut, wir erfahren am Ende den Zweck des Zerstörungswerks. Aber wir dürfen nicht die Umsetzung dieses Zwecks miterleben (es gibt eine Fortsetzung, allerdings nur auf Japanisch). Und das ist nach all dem geballten Leid, das wir hier über uns ergehen lassen mussten, emotional einfach unbefriedigend. Nichtsdestotrotz ein Buch, das man geistig nicht so schnell zur Seite legen wird können.
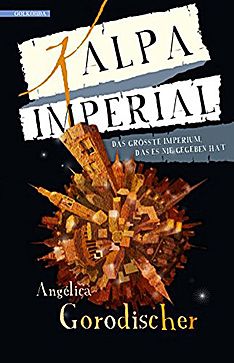
Angélica Gorodischer: "Kalpa Imperial"
Klappenbroschur, 302 Seiten, € 17,40, Golkonda 2018 (Original: "Kalpa Imperial", 1983)
"Kalpa" bezeichnet im Hinduismus – eindeutig die Religion mit der größten Langzeitperspektive – den Milliarden Jahre umfassenden Zyklus von der Geburt bis zum Vergehen eines Universums. Ganz so immens sind die Zeiträume, in denen Angélica Gorodischer Aufstieg, Fall und Wiedererstehen des fiktiven Kaiserreichs von "Kalpa Imperial" schildert, zwar nicht. Wir bewegen uns aber immerhin in Größenordnungen, die denen von Tolkiens "Silmarillion" gleichkommen.
"Kalpa Imperial" ist kein Roman, sondern ein Sagenkreis, oder banaler ausgedrückt: eine Sammlung von Kurzgeschichten, die keiner erkennbaren Chronologie folgen und die man daher in beliebiger Reihenfolge sowie mit zeitlichem Abstand lesen kann. Weswegen ich gleich an dieser Stelle die Empfehlung aussprechen würde, sich das Buch einzuteilen. Gorodischer erzeugt einen wunderbaren epischen Flow, der aber von der Unzahl an auftauchenden Namen etwas überschattet werden könnte, wenn man das Buch in einem durchliest. Das kann zur Überforderung führen, und da wär's doch schade um den sprachlichen Genuss.
Im Zickzackkurs durch die Geschichte
Obwohl allesamt im selben Fantasy-Universum angesiedelt, sind die einzelnen Episoden höchst unterschiedlicher Natur. Es gibt Parabeln ebenso wie kursorisch gehaltene Legenden, Rekonstruktionsversuche historischer Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven, Schelmenstücke und politische Kommentare. Letztere können explizit sein ("Den Thron bestieg Mezsiadar III. der Asket, ein Mann mit guten Absichten, der so viele Stunden und so viel Kraft darauf verwendete, Gutes zu tun, dass er so viel Schaden anrichtete wie zwanzig boshafte Kaiser zusammen.") oder unterschwelliger eingebaut: Etwa wenn die visionäre Kaiserin Abderjhalda ein Verbot für den Individualverkehr mit Pferdewagen erlässt, worauf das Reich in kleine, überschaubare Einheiten zerfällt – in denen die Menschen aber viel glücklicher leben als in der vernetzten Welt davor. Das kann man durchaus als Kommentar auf den sozialen Frieden in der Massengesellschaft unserer Tage werten.
Wir lesen vom aufgeweckten Jungen Bib, der in einer Ära lebt, als das Imperium wieder mal zu Asche zerfallen ist und der nun seine Zeitgenossen im Eiltempo aus der Steinzeit katapultiert (ein Gründungsmythos mit dem Tempo von "Trigan" ...). Oder von einem geflüchteten Verbrecher, der auf seinen Wanderungen durch den vermeintlich barbarischen Süden nicht nur zu seiner Identität findet, sondern sich auch zu einer Art Messias-Gestalt mausert. Oder – Gorodischer kann's durchaus auch mal amoralisch – von Drondlann, der mit "Kuriositäten" handelt (soll heißen: missgestalteten Menschen und exotischen Tieren) und einen Jungen, der die vergessene Kunst des Tanzens beherrscht, als Waffe gegen einen unliebsamen Kaufmann einsetzt. Manche Geschichten wirken in Handlung und Botschaft fremdartig, und die eine oder andere ist zugegebenermaßen auch an mir vorbeigeflossen.
Die Macht der Geschichte(n)
Als wäre es auf ein hiesiges Publikum zugeschnitten, demonstriert "Kalpa Imperial" wunderschön die doppelte Bedeutung, die das Wort Geschichte im Deutschen hat. Niemals suggeriert uns die Erzählweise, unmittelbar beim Geschehen dabeizusein. Stets ist ein Erzähler dazwischengeschaltet, der uns gleichsam als Besucher des Palasts um sich versammelt. Oder genau genommen verschiedene Erzähler, zieht man in Betracht, dass wir von dieser rätselhaften Instanz auf recht wechselhafte Weise angesprochen werden: Mal wendet "er" sich ganz höflich an uns, mal werden wir von ihm geschmäht.
Das Motiv kehrt im Verlauf des Buchs immer wieder. Besagte Kaiserin Abderjhalda etwa tritt in eine symbiotische Beziehung mit einem solchen Erzähler ein: Sie lässt sich von ihm die Historien ihrer Amtsvorgänger berichten und schildert ihm im Gegenzug ihren fantastischen Werdegang vom mittellosen Kind zur unangefochtenen Herrscherin. Und mehrfach werden Protagonisten durch Geschichten, die ihnen eine neue Perspektive vermitteln, zum Umdenken gebracht.
Bond, Dschäimsbond
Nichts weniger als die Umkehrung von Kulisse und Akteur beschert uns die Episode "Über das unkontrollierte Wachstum der Städte": Normalerweise sehen wir menschliche Protagonisten, die sich durch wechselnde Kulissen bewegen. Hier hingegen ist gewissermaßen das Bühnenbild – eine namenlose Gebirgsstadt, der wechselnde Machthaber ihren Stempel aufzudrücken versuchen – die Hauptfigur, während die letztlich unbedeutenden Menschen wie Kulissen durch sie hindurchgeschoben werden.
Und einmal saß Gorodischer offensichtlich der Schalk im Nacken. Die letzte Episode dreht sich darum, wie ein politischer Umbruch im Reich seinen Schatten auf eine Karawanengemeinschaft wirft. Mitten in diesen durchaus spannenden Ereignissen gibt dann einer der Karawanenführer die Kosmogenese dieser Welt zum Besten. Staunend lesen wir davon, wie am Anfang der Zeit aus einem riesigen Auge Staubkörner geflogen kamen, die sich zu Häusern mit Bezeichnungen wie "Vom Winde verweht" wandelten und Heldengestalten mit Namen wie Klargäibl, Dschäimsdien oder Woldisni hervorbrachten. Dschäimsbond und Magaretsätscha hatten einen Sohn, der Schohpohlsart hieß, ... da ist man erst mal baff.
Fragmente einer Weltgeschichte
Was die Geschichten trotz ihrer Verschiedenartigkeit eint, ist, dass sie alle sich um das menschliche Streben nach Höherem drehen – ob auf individueller oder gesamtzivilisatorischer Ebene. Einziger Wermutstropfen bleibt vielleicht, dass Gorodischer dem unter Genre-Fans sehr verbreiteten Einordnungswunsch nicht entgegengekommen ist. Ein chronologischer Rahmen wie im "Silmarillion" oder wenigstens wie in Cordwainer Smiths loser Future History ist nicht erkennbar. Den könnte wohl nicht einmal die Autorin selbst nachliefern, nimmt man den Umstand, dass unter all den Namen von Orten, Herrschern und Dynastien kaum je einer zweimal auftaucht – Gorodischer hat sie vermutlich in freiem Kreativgalopp nach Belieben ausgestreut.
In Südamerika ist die heuer 90 gewordene Autorin längst ein großer Name in der Phantastik. Im Norden hingegen hat man sie erst spät entdeckt: "Kalpa Imperial" ist erst 20 Jahre nach seinem Erscheinen ins Englische übersetzt worden, und zwar von niemand Geringerem als Ursula K. Le Guin. Nun gibt es also auch eine deutschsprachige Ausgabe – endlich, möchte man sagen, denn es liegt ein Zauber über diesen Geschichten.
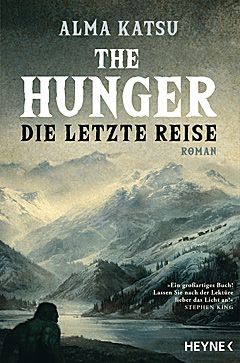
Alma Katsu: "The Hunger. Die letzte Reise"
Klappenbroschur, 448 Seiten, € 15,50, Heyne 2018 (Original: "The Hunger", 2018)
1846 brach die sogenannte Donner Party zu ihrer unseligen Reise auf: Es war einer der zahllosen Siedler-Trecks, die auf dem California Trail gen Westen zogen. Dort kamen von ursprünglich 87 Teilnehmern aber nur 48 an. Der Rest war der schlechten Planung zum Opfer gefallen, die die Donner Party zur Überwinterung im Gebirge zwang. Bei uns kaum bekannt, ist die tragische Geschichte der Donner Party in die US-amerikanische Populärkultur eingeflossen – vor allem deshalb, weil die Überlebenden in ihrem Winterlager gezwungenermaßen zu Kannibalen geworden waren.
Die aus Alaska stammende Autorin Alma Katsu hat sich des schon vielfach behandelten Stoffs angenommen und auf die für sie typische Weise behandelt, als Historienroman mit übernatürlichen Anklängen. Der Plot dürfte Gruselfans an Dan Simmons' "Terror" erinnern, das vor kurzem erst für eine TV-Serie adaptiert wurde. Auch die Filmrechte an Katsus "The Hunger" wurden übrigens schon verkauft, obwohl die letzte Verfilmung des Stoffs erst neun Jahre zurückliegt.
Die Wahl der Akteure
Bei einem derart großen Grundensemble hat man für eine künstlerische Bearbeitung natürlich die Qual der Wahl, wen man in den Vordergrund stellen und aus wessen Perspektive man das Grauen schildern will. Katsu setzte offenbar auf den Faktor Vernunft – jedenfalls ist das der Wesenszug, den ihre wichtigsten Protagonisten teilen. Nicht unwichtig in der brisanten Gemengelage eines "fahrenden Dorfs", in dem bald Eifersüchteleien, Aggressionen, Machtkämpfe, Mobbing und sexuelle Nötigung blühen. Nicht unwichtig, aber möglicherweise trotzdem fürs Überleben nicht ausreichend.
Im Vordergrund stehen also Vernunftmenschen wie der Junggeselle Charles Stanton oder der schwule James Reed, der vor Erpressung geflüchtet ist und einen viel fähigeren Treck-Führer abgäbe als der namensgebende George Donner. Doch leider ist Reed so uncharismatisch, dass niemand auf ihn hört. Dazu kommt die tugendhafte Mary Graves, die stets weiß, was das Richtige ist, aber nie den Mut hat, es auch zu tun. Und als schillerndes Gegenstück schließlich Donners Ehefrau Tamsen, die wir als egoistische Verführerin kennenlernen, bis wir einräumen müssen, dass wir sie möglicherweise falsch eingeschätzt haben.
Böse Vorzeichen
Tamsen Donner und Charles Stanton werden von schweren Schuldgefühlen geplagt – durchwegs unberechtigten, wie wir noch sehen werden, beide sind Gefangene der Moral ihrer Zeit. Dass Tamsen ihre ganz natürlichen Begierden als etwas "Verdrehtes" in sich fühlt, leitet aber zugleich zu einer langen Reihe böser Omen über, die den Treck von Anfang an begleiten. Charles träumt von seiner verstorbenen Verlobten. Ein Mädchen glaubt flüsternde Stimmen zu hören. Man findet in einer Hütte Briefe, die zur Umkehr mahnen. Ein Trapper erzählt Schauergeschichten von einem (fiktiven) Indianerstamm, der in der Gegend lebt, durch die die Donner Party ziehen will. Und der Guide, den man unterwegs treffen wollte, hat sich in einem Planwagen voller Talismane versteckt und stottert panisch: Etwas verfolgt uns.
Freilich bleiben auch etwas handfestere Indizien nicht aus, so wird schon zu Beginn der Reise der angefressene Leichnam eines Jungen in der Prärie gefunden. Es wird nicht der letzte bleiben. Der im Titel angesprochene "Hunger" hat also eine doppelte Bedeutung: Er steht einerseits für die Entbehrungen, die die Donner Party auf sich nimmt, ihre schwindenden Ressourcen und das daraus entspringende Elend zwischen Gewalt und Hoffnungslosigkeit. Und zum anderen für die Attacken auf den Treck, die sich langsam, aber doch häufen.
Katsu, die recht gemächlich erzählt und dabei vor allem auf die sozialen Prozesse innerhalb der Siedlergemeinschaft fokussiert, lässt uns lange Zeit rätseln, woher diese Angriffe kommen. Als versierte Genrefans wissen wir allerdings, dass die Möglichkeiten endlich sind. Entweder haben wir es mit der epidemiologischen Variante zu tun (inklusive Vampirismus, Zombifizierung und anderer von der Schulmedizin nicht anerkannter Krankheitsbilder). Oder es ist der Einzeltäter – der kann dann wieder übernatürlicher Natur sein wie in Simmons "Terror" oder ein Soziopath, eventuell aus der Siedlergruppe selbst stammend. Katsus Auflösung folgt ... beizeiten.
Was wirklich geschah
Stoffe, die auf einer realen Vorlage beruhen, verlocken natürlich dazu, anschließend auch die historischen Fakten nachzulesen. Sachbücher zur Donner Party gibt es jede Menge, ein kurzer Abriss des wahren Geschehens ist auch im Anhang des Romans zu finden. Das Bedürfnis weiterzulesen dürfte im Fall von "The Hunger" besonders stark sein, da Katsu die ganze Zeit zwar schön, aber langsam erzählt – um dann den Schluss so zu überhasten, dass man einfach nachblättern muss, was jetzt aus dem und der geworden ist.
Allerdings empfehle ich ausdrücklich, Detailrecherchen erst nach der Lektüre zu betreiben. Denn auch wenn Katsu bei den Vitae der Protagonisten von ihrer schriftstellerischen Freiheit Gebrauch gemacht hat (und einige der Beteiligten vermutlich entsetzt gewesen wären, was sie ihnen andichtet) – in einem Punkt musste sie sich an die Fakten halten: Wer die Hölle der Donner Party überlebt hat und wer nicht.

I. L. Callis: "Das Alphabet der Schöpfung"
Gebundene Ausgabe, 464 Seiten, € 22,70, Emons Verlag 2018
Vielleicht lag's daran, dass ich parallel zu diesem Buch einen Roman mit Meta-Ebenen gelesen habe – jedenfalls stieg nach der Lektüre von "Das Alphabet der Schöpfung" vor meinem geistigen Auge das Bild einer Protestversammlung verwirrter Romanfiguren auf, die die Autorin nach ihren Motiven fragen. So in etwa würde sich das anhören:
Max: Warum engagiere ich einen Aufdecker-Journalisten für eine PR-Broschüre, obwohl mein Unternehmen jede Menge Geheimnisse zu verbergen hat? Alexander: Was will ich eigentlich? Ich ändere meine Ansichten so oft, dass mir schon ganz schwindlig ist. Miriam: Du hetzt mich quer durch Deutschland und dann ist mein Beitrag zum Höhepunkt der Geschichte, dass ich eins übergebraten kriege und wieder nach Hause gehe? Der kleine Leon: Warum haben die mich geschlachtet und den anderen Jungen adoptiert? Das ist voll ungerecht! Yue: Warum verzapfe ich als Biologin dauernd Unsinn, wenn es um Biologie geht? Der Archaeopteryx an der Decke des Forschungszentrums: Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein rabengroßer Urvogel. Dass man mich von da unten so gut sehen kann, liegt daran, dass ich als riesiger Flugsaurier beschrieben werde.
Was sie alle zusammengebracht hat
Erst mal zur Handlung: Der Hamburger Journalist Alexander Lindahl hat sich gerade mit seinem Magazin überworfen, weil er Wert auf ungeschönte Wahrheiten legt. Nichtsdestotrotz nimmt er als Nächstes ausgerechnet einen PR-Job an: Sein alter Jugendfreund Max van Damme besitzt mittlerweile ein Biotechnologie-Unternehmen in Berlin und wünscht sich von Alexander, dass dieser ein Buch darüber schreibt. Warum Max das tut, bleibt wie eingangs erwähnt völlig offen. Es resultiert jedenfalls in einem romanlangen Eiertanz, was er Alexander offenbaren soll und was nicht.
Van Dammes Firma "Phoenix" ist ein Paradebeispiel für die weltoffene Unternehmenskultur, in der Zeit- und Teamgeist blühen und selbstgefällige Innovatoren Phrasen wie "Kreativität braucht Nähe" dreschen. Das ist von der Autorin recht gut auf den Punkt gebracht, und alle, die schon mal mit solchem New-Economy-Management-Mist zu tun hatten, werden das Ambiente wiedererkennen. Es ist fast gruseliger als die dunklen Geheimnisse, die hinter der Fassade von "Phoenix" lauern. Recht bald erfahren wir aus einem Gespräch van Dammes mit seinem inneren Zirkel nämlich, dass er bereits den einen oder anderen Mord in Auftrag gegeben hat und weitere in Erwägung zieht.
Denn "Phoenix" lebt zwar von medizinischen Patenten, hat aber auch auf einem anderen und streng geheimgehaltenen Gebiet erstaunliche Expertise. Worum es dabei geht, dafür werden schon früh reichlich Hinweise ausgestreut: So schildert der Prolog die letzten Stunden von Ötzi (ja, ebendem). Im Firmengebäude stehen diverse Urmenschen-Replikationen herum. Eine Nebenfigur sieht in einem Moor im Berliner Umland ein Hüttendorf und wird von Wesen angegriffen, bei denen man sich nicht ganz sicher ist, ob es Menschen oder Tiere sind. Und das Geheimprojekt van Dammes trägt den Namen "Lazarus" ... Dieses Puzzle ist nicht schwer zusammenzusetzen.
Spannungsfaktor gegeben
Kommen wir zum Positiven: das wäre die professionelle Schreibe. Die ist freilich keine Überraschung, denn hinter "I. L. Callis" verbirgt sich eine Autorin, die schon seit Jahren unter ihrem Klarnamen im selben Verlag Krimis veröffentlicht. Sie weiß also, wie man die obligatorischen Cliffhanger setzt, und schreckt auch nicht vor dem Reißerischen zurück: Das Böse hatte sich seines Freundes bemächtigt. Jetzt griff es nach ihm. Kaltes Grauen packte ihn. Er wollte weglaufen, aber seine Glieder waren wie eingefroren. Hinter ihm teilte sich das Schilf. (Kapitel aus, schnell weiterblättern.)
Das Witzige an Wissenschaftsthrillern ist ja, dass sie – nicht zuletzt in der begleitenden Werbekampagne – ganz besonders die gesellschaftliche Brisanz der darin behandelten Themen betonen (im vorliegenden Fall: die Gen-Schere & Co). Dabei gibt es kaum ein Genre, bei dem man sich vergleichbar gemütlich vor dem Kamin einwickeln kann, derart vertraut sind die Plotmuster. Außer spannend müssen solche Romane letztlich nicht viel sein ... bloß ein bisschen plausibel. Das ist hier aber leider nicht der Fall, und darum ist I. L. Callis auch kein neuer Marc Elsberg oder Daniel Suarez oder Michael Crichton.
Nicht die hellste Birne im Luster
Vieles in "Das Alphabet der Schöpfung" ist nicht nachvollziehbar – unter anderem die Entscheidungen, die einige zentrale Handlungsträger treffen. Und die Hauptfigur tut sich dabei besonders hervor. Schon bevor Alexander in der Klimax des Romans seine Ansichten im Minutentakt ändert und damit letztlich wie ein orientierungsloser Dodel dasteht, hat er ein Händchen dafür, auf Enthüllungen haarsträubend falsch (oder gar nicht) zu reagieren. Die Erzeugung genetischer Chimären scheint er wenig bemerkenswert zu finden, die ethischen Aspekte des von Max nonchalant enthüllten Zwecks des Geheimprojekts machen dem gesellschaftskritischen Journalisten offenbar auch kein Kopfzerbrechen. Zumindest werden sie nicht weiter thematisiert.
Klonen hingegen, das hält er für schieren Wahnsinn. "Das Alphabet der Schöpfung" ist übrigens wieder ein Rücksturz in die Zeit von Geschichten, in denen Klone auf wundersame Weise auch dieselbe Persönlichkeit hatten wie das Original (und nein, das bringen auch epigenetische Faktoren nicht zuwege). An einer Stelle lässt die "Phoenix"-Wissenschafterin Yue Chang diesbezüglich einen Satz fallen, der entweder a) unfassbar zynisch ist oder b) zeigt, dass sie (respektive die Autorin) nicht genug vom Thema versteht. Was auch immer davon zutrifft: Wieder bleibt eine Reaktion Alexanders aus. Der Typ ist echt nicht zu fassen.
Wie man im Chaos versinkt
Im Einband heißt es zwar, dass die Autorin zwei Jahre lang mit Experten gesprochen hat – allerdings lässt der Roman offen, worüber. Wissenschaft ist jedenfalls ganz eindeutig nicht Callis' Spezialgebiet. Und so wird auch etwas, das eigentlich ein Fall für eine humanitäre Mission sein müsste, auf vollkommen unglaubhafte Weise zu einer Gefahr für die Menschheit hochstilisiert: "Unsere Welt würde im Chaos versinken." Also ich hab mich vor der "Gefahrenquelle" nicht gefürchtet. Sie hat mir leid getan.
"Das Alphabet der Schöpfung" in einem Satz: Die Form passt, der Inhalt nicht.
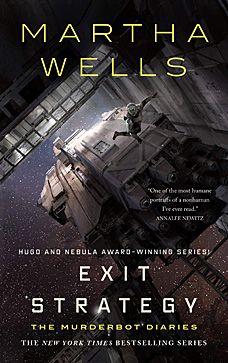
Martha Wells: "The Murderbot Diaries 4: Exit Strategy"
Broschiert, 176 Seiten, Tor Books 2018, Sprache: Englisch
When I got back to HaveRatton Station, a bunch of humans tried to kill me. Considering how much I'd been thinking about killing a bunch of humans, it was only fair.
Der erste Satz führt gleich zum ersten Grinser – yep, Martha Wells liefert zum Abschluss ihres Novellen-Quartetts um Murderbot noch einmal alles, was wir an der Hauptfigur liebgewonnen haben. Zur Erinnerung: Murderbot ist ein für den Kampf gezüchteter Cyborg, der sein Steuerungsmodul gehackt hat, dadurch autonom geworden ist und schließlich zum grummeligen Beschützer harm- und ahnungsloser Menschen mutiert ist. Was niemanden mehr verblüfft als Murderbot selbst.
"Exit Strategy" kann nicht für sich allein gelesen werden, dafür sind die Verweise auf die früheren Erzählungen zu dicht gesetzt. Für Neulinge empfiehlt es sich also, bei Band 1 ("All Systems Red") zu beginnen. Mit "Exit Strategy" schlägt Wells nun den Bogen zurück zum Anfang, soll heißen: Wir werden den Nebenfiguren aus der ersten Novelle wiederbegegnen. Das gibt einen schönen runden Abschluss, und ich nehme stark an, dass eher früher als später eine Omnibus-Ausgabe der vier Erzählungen auf den Markt kommen wird, die sich als nahtloser Roman lesen lässt.
Letzter(?) Einsatz
Kurz zur Handlung: Im Kampf gegen den skrupellosen Konzern GrayCris wurden bereits einige wichtige Etappensiege errungen, als die Nachricht eintrifft, dass Murderbots einstige Mentorin, die Forscherin Dr. Mensah, von GrayCris entführt worden ist. Also macht sich Murderbot auf zur Raumstation TranRollinHyfa, auf der die großen Corporations ihre Vertretungen haben, um Mensah mit der improvisierten Operation Not Actually A Completely Terrible Plan zu befreien.
Das wird in der ersten, stark Cyberpunk-geprägten Hälfte der Erzählung vornehmlich auf das Einhacken in Datenströme hinauslaufen, während in der zweiten wieder die Waffen sprechen dürfen. Das Durchschnittstempo: atemlos. Und einmal mehr darf man staunen, wie lustvoll sich eine eigentlich aus der Fantasy kommende Autorin in die Technologie stürzt und das auch überzeugend hinkriegt.
Quo vadis, Murderbot?
Die Arsenale des Gegners jagen Murderbot natürlich keine Angst ein – ganz anders als die Wiederbegegnung mit Mensah. Schließlich hat niemand Murderbot so tief unter den Panzer geblickt wie die Forscherin, und es steht zu befürchten, dass sie einmal mehr unbequeme Fragen zu Murderbots "Menschlichkeit" ansprechen wird. "I don't want to be human." – Dr. Mensah said, "That's not an attitude a lot of humans are going to understand. We tend to think that because a bot or a construct looks human, its ultimate goal would be to become human." – "That's the dumbest thing I've ever heard."
Erwarten wir also keine Rührseligkeit, wenn Murderbot einem möglichen Happy End entgegensieht. Gefühlsstürme sind ja schön und gut, solange sie in den Serien stattfinden, die Murderbot so gerne streamt. Aber selbst? I was having an emotion, and I hate that.
Blick nach vorn
Was mir erst nachträglich aufgefallen ist: Ein interstellarer Wirtschaftskrimi mit Cyberpunk-Einflüssen und einer sarkastischen Hauptfigur, der das Kämpfen überaus leicht von der Hand geht – eigentlich müssten die Murderbot-Erzählungen Fans der "Takeshi Kovacs"-Romane von Richard Morgan entgegenkommen. Womit wir auch schon mitten in der Überleitung zur nächsten Rundschau wären. Es ist ja in der Zwischenzeit nicht nur Morgans "Altered Carbon" ("Das Unsterblichkeitsprogramm") zur Vorlage einer TV-Serie geworden. Der Erfolgsautor hat nach seiner Fantasy-Trilogie "Land Fit for Heroes" auch sein Comeback in der Science Fiction in Angriff genommen. Noch diesen Monat soll das mehrfach verschobene "Thin Air" endlich erscheinen – zwar ohne Takeshi Kovacs, aber mit einem Szenario, das wieder in eine ganz ähnliche Richtung gehen dürfte.
"Thin Air" ist also der erste Titel, den der Rundschau-Lesezirkel für die nächste Ausgabe vorbereiten könnte. Dazu kommen "Wandernde Himmel" von Hao Jingfang und "Frontal" von John Scalzi. (Josefson, 20. 10. 2018)
________________________________
Weitere Titel
Überblick über sämtliche bisher rezensierten Bücher