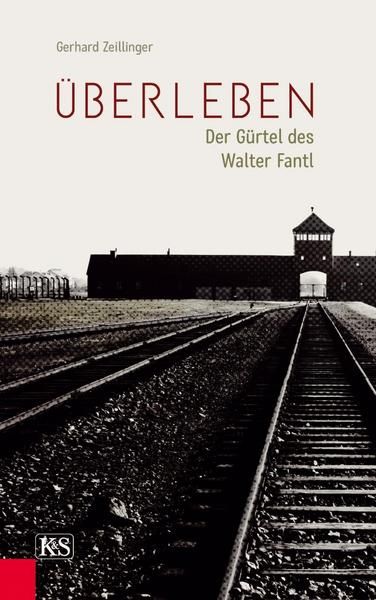"Wir waren befreit, aber so richtig frei haben wir uns nicht gefühlt, wir befanden uns ja mitten im Frontgebiet, und der Krieg war noch lange nicht aus. Aber in Blechhammer wollten wir nicht bleiben. Und da hat uns der russisch-jüdische Offizier, mit dem wir irgendwie Freundschaft schlossen, gesagt: Geht nach Ehrenforst, dort gibt es ein Spital, dort habt ihr zu essen und ein Dach überm Kopf. Wir waren fünf, sechs Burschen, die schon seit Auschwitz beisammen waren. Dann hat sich uns noch eine zweite Gruppe Wiener angeschlossen. So sind wir nach zwei Tagen losgezogen."
Die einzigen Menschen, denen sie begegnen, sind Fremde wie sie, Polen, Russen, Ukrainer, französische und englische Kriegsgefangene, die auch noch nicht wissen, wo sie hinsollen. An den Kreuzungen stehen Wegweiser mit russischen Aufschriften, einfache, mit der Hand gemalte Schilder. Da und dort liegen tote Soldaten im Schnee. Von jenseits des Kanals hört man Gefechtslärm, die Front ist nur 15 Kilometer entfernt. Ehrenforst ist wie ausgestorben. Es ist erst zwei, drei Tage her, dass die Menschen Hals über Kopf geflüchtet sind. Die meisten Häuser stehen offen. Überall stoßen sie auf Spuren der ehemaligen Bewohner. So, als wären sie eben noch dagewesen. Wir kamen in Wohnungen, da standen am Herd noch die vollen Töpfe, manchmal stand sogar noch das Essen auf dem Tisch. Wir entdeckten Vorräte, eingekochtes Gemüse, Obst und Fleisch in Einmachgläsern. Wir haben uns genommen, was wir brauchten. "Schleusen" sagen die jungen Männer, wenn sie brauchbare Dinge finden, die sie an sich nehmen. Noch vor wenigen Tagen haben sie nicht gewusst, ob sie überleben werden. Und jetzt wohnen sie in einer Villa, schlafen wieder in richtigen Betten. Sie essen auf Tellern aus Meißner Porzellan, die sie anschließend aus dem Fenster werfen. Es gibt genug neues Geschirr, man braucht nur in das nächste Haus zu gehen.
Meschuggenes Leben
"Eigentlich hatten wir ein meschuggenes Leben", erinnert sich Leo. "Und natürlich haben wir uns sofort neu eingekleidet." Sie nehmen aus den Kleiderschränken, was ihnen gefällt, es ist egal, dass die Hosen, Hemden und Mäntel für ihre abgemagerten Körper viel zu groß sind, Hauptsache, sie müssen nicht mehr wie Sträflinge herumlaufen. Walter greift sich die erstbeste Hose und schnallt seinen breiten Gürtel darüber. Die alte Hose und Jacke mit den "Zebrastreifen" verbrennt er im Ofen. Es ist das erste Zeichen ihrer Freiheit.
Einmal findet er einen Rasierapparat und ist glücklich, bis er draufkommt, dass der einem Franzosen gehört hat, einem Kriegsgefangenen. Da beschleichen ihn Zweifel, das ist Diebstahl, sagt er sich. Im Spiegel sieht er, wie die Bartstoppeln langsam verschwinden. Plötzlich steht ein Gespenst vor ihm, ein ausgemergelter, armseliger Körper. Als er im Spital von Ehrenforst auf eine Waage gestellt wird, sind es gerade einmal 37 oder 38 Kilo. Immer noch ist Walter schwach, er hat Durchfall und verträgt kein Essen. Dabei kann er sich zurückhalten, er ist diszipliniert. Im Spital haben Soldaten die Speisekammer aufgebrochen, Fleisch und Würste werden verteilt. Bevor sich die Ersten darauf stürzen, ermahnt sie Ernst Sonntag, der Älteste und Erfahrenste der Gruppe. "Wenn ihr das jetzt in euch reinstopft, dann krepiert ihr. Esst wenig, esst langsam!"
Ernst Sonntag versteht auch Russisch und kann dolmetschen, wenn sie auf sowjetische Soldaten treffen, das schafft Vertrauen. Manchmal antworten ihnen die Soldaten auf Jiddisch, das sie halbwegs verstehen, weil im Lager viel Jiddisch geredet wurde. Das macht sich bezahlt, weil die Russen immer irgendwo Lebensmittel auftreiben.
"Geht es uns nicht gut?", fragt Sonntag, wenn er mit Konservendosen oder Gläsern mit eingelegtem Gemüse zurückkommt. Oder er sagt: "Überleben gesichert!", und beginnt sofort in der Küche zu hantieren. Er hat wirklich auf uns geschaut, und wenn wir den Kopf hängen ließen, hat er uns aufgemuntert, obwohl es ihm selber nicht gut gegangen ist. Seine Frau Martha war mit ihm im selben Transport. Und er hat wohl geahnt, dass sie nicht überlebt hat.
So einfach ist das
Am 10. Februar brechen sie auf, zuerst nach Braunbach, ein kleines Dorf an der Gleiwitzer Straße. Am Kanal liegen tote Soldaten, auch erschossene Zivilisten, Kadaver von Pferden und Kühen. Am nächsten Tag kommen sie nach Gleiwitz. Ausgerechnet der Ort, von wo sie vor drei Wochen auf Todesmarsch gingen. Und wo sich ihr Lager befand. Gleiwitz I. Nicht weit entfernt die Werkstätten der Reichsbahn, die Hallen, in denen sie drei Monate lang gearbeitet haben. Viele Häuser sind nur noch Ruinen, unbewohnbar. Dennoch leben Menschen darin, nicht alle Deutschen sind aus Gleiwitz geflüchtet. "Die noch hier waren", erinnert sich Leo, "hatten vor uns große Angst. Und wir haben sie spüren lassen, dass jetzt wir die Herren sind." In der Rohrstraße, nicht weit vom Bahnhof, besetzen sie für zwei Tage ein Haus. "Verschwindet, jetzt sind wir da!", sagen sie zu den Bewohnern. So einfach ist das.
Aber Walter hat dabei kein gutes Gefühl. "So können wir das nicht machen. Nicht alle Deutschen sind schlecht." Er wird nie vergessen, wie ihm Herr Scholz im Bahnwerk regelmäßig Essen gebracht hat, vielleicht hat er ihm dadurch das Leben gerettet. Jetzt sucht Walter vergeblich nach ihm. Er will sich bei ihm bedanken, ihm sagen: Ich habe überlebt! Aber im Bahnwerk ist niemand mehr, die Hallen sind teilweise eingestürzt, die Betriebsstätten alle zerstört. Dann fahren sie weiter, bald ziellos von einem Ort zum andern. Oft warten sie einen ganzen Tag, bis ein Zug kommt. Manchmal lassen die Heizer sie auf der Lokomotive mitfahren, oder sie springen in einen offenen Waggon. Die Temperaturen sind immer noch tief unter null.
Am 17. Februar kommen sie nach Krakau, wo sie vom Zentralkomitee der Sozialfürsorge in eine Unterkunft in der ulica Dluga eingewiesen werden. Krakau ist ein Sammelpunkt für alle möglichen Gestrandeten, ehemalige Kriegsgefangene, befreite Häftlinge. Die Versorgungslage ist schlecht, auf den Straßen treiben sich Schmuggler und Schwarzhändler herum. Dazwischen Frauen und alte Menschen mit Einkaufstaschen auf der Suche nach Lebensmitteln und Kohlen. Die Stadt macht einen grauen und schmutzigen Eindruck, viele Geschäfte sind leergeplündert. Einmal sitzen sie sogar im Kino, nach vielen Jahren, und sehen einen polnischen Film, von dem sie kein Wort verstehen.
Wer Deutsch spricht, bekommt Probleme
"Nie mówimy po polsku!", Wir können kein Polnisch, sagen sie, wenn sie nach Papieren gefragt werden. Den Satz haben ihnen jüdische Freunde beigebracht. "Sprecht nicht deutsch, sonst bekommt ihr Probleme!" Tage später fahren sie mit dem Zug nach Kattowitz. Durch eine triste, vom Unheil verwundete Landschaft. "Polen ist ein trauriges Land", schreibt Primo Levi in seiner Autobiografie, der sich zur selben Zeit wie Walter und seine Kameraden ebenfalls in Krakau und später in Kattowitz aufhält. Vermutlich haben sich ihre Wege irgendwo gekreuzt.
Mitten im Zentrum sind sowjetische Panzer abgestellt, durch die Straßen patrouillieren Abteilungen der polnischen Armee und treiben deutsche Kriegsgefangene vor sich her. Bis vor kurzem haben in der Stadt noch 140.000 Menschen gelebt, aber die meisten Deutschen sind geflüchtet, viele Häuser und Geschäfte stehen leer. Die, die noch in der Stadt sind, haben Angst und trauen sich auf der Straße nicht mehr deutsch zu sprechen, seit sie erlebt haben, wie sie von ihren polnischen Nachbarn bespuckt und mit Steinen beworfen wurden. Vereinzelt kam es auch zu Racheakten und Gewaltexzessen, wie damals fast überall.
Walter und seine Freunde beziehen zunächst in der Ferdinandsgrube Quartier, einem Steinkohlebergwerk mit riesigen Hallen und Förderanlagen. Sie wohnen in den Unterkünften der Bergarbeiter, in einer der Anlagen unter Tage können sie auch wieder duschen, es gibt sogar warmes Wasser.
"Jeder hat eine Mutter gehabt"
Am 6. März wird Walter 21 Jahre alt. Am selben Tag bescheinigt ihm das polnische Rote Kreuz, dass er Häftling in Auschwitz war. Sein Name wird auf einer gelben Karte eingetragen, eine Reisebescheinigung, die ihn berechtigt, nach Wien zu fahren. Aber dorthin zurückzukehren kann er sich gar nicht vorstellen. Und was würde ihn dort erwarten? Walter fragt sich, wer überhaupt von seiner Familie überlebt hat.
Am 17. April brechen sie nach Sagan auf, eine Kleinstadt zwischen Cottbus und Breslau an einem Nebenfluss der Oder, wo sie mehr als einen Monat lang bleiben. Auch hier haben heftige Kämpfe Wunden in die Landschaft geschlagen. Aber zum ersten Mal seit ihrer Befreiung erleben sie eine fast unbeschwerte Zeit. "Ein neues Leben", schreibt Otto Kalwo, der sich aus einem der leerstehenden Häuser eine Schreibmaschine besorgt hat und nun anfängt, die Erlebnisse der letzten Wochen und Monate in die Maschine zu tippen. Er schreibt seitenlange Berichte und verteilt Durchschläge unter den Kameraden. Vielleicht begreifen sie erst jetzt, was sie in den letzten Monaten überlebt haben. "Wir hatten keine Ahnung, was morgen sein würde. Vermutlich dachten wir darüber gar nicht nach. Und dann hieß es plötzlich, der Krieg ist zu Ende. Und die Russen sagten zu uns: Ihr seid frei!"
An einem dieser wärmeren Tage – man kann den Sommer bereits spüren – bleiben sie vor der Zigeunerin stehen, die aus der Hand liest. Sie ist nicht die Einzige. Überall in der Stadt laufen einem Zigeuner über den Weg, auch sie Überlebende aus den Lagern, die in den letzten Wochen hier gelandet sind. Einige sitzen hinter kleinen Tischchen am Straßenrand und schlagen Karten auf. Die Zukunft. Wird alles gut werden? "Gib mir deine Hand", sagt sie zu Leo. Er sieht zu, wie sie mit einem Finger über seine Handfläche fährt. "Du hast eine Mutter", sagt sie. "Natürlich", sagt Leo, "jeder hat eine Mutter gehabt." "Nein", sagt sie, "du wirst deine Mutter wiedersehen." Die ist meschugge, denkt Leo. Niemand mehr hat eine Mutter! Soll er ihr erzählen, wie das in Auschwitz war? Aber die Zigeunerin bleibt dabei. Auch zu Otto Kalwo und Heinz Beer sagt sie denselben Satz. "Du hast eine Mutter, ich kann sie sehen." Walters Hand prüft sie wortlos.
Und Walter fragt nicht nach. (Gerhard Zeillinger, 22.9.2018)