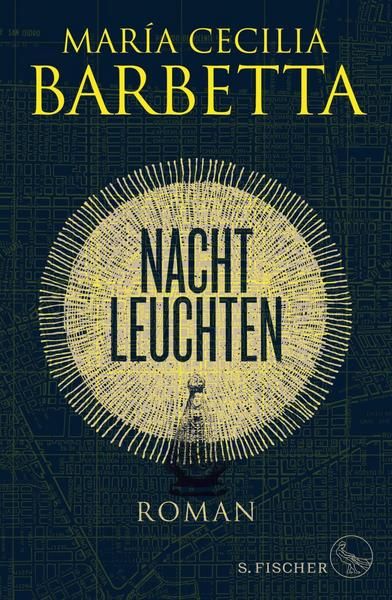Das Nachtleuchten in María Cecilia Barbettas gleichnamigem Roman kommt von einer kleinen, mit fluoreszierender Farbe bemalten Plastikmadonna. Ein billiger Trick, aber das Figurenpersonal des Romans kann jeden Hoffnungsschimmer gebrauchen: Sie leben Mitte der 1970er-Jahre, am Vorabend der argentinischen Militärdiktatur, in Ballester, einem Einwandererviertel von Buenos Aires.
Barbetta, 1972 in Buenos Aires geboren, hat, bevor sie 1996 nach Berlin kam, die wechselhafte argentinische Geschichte miterlebt: Perón- und Evita-Kult, Terrorismus und Militärdiktatur. Nachtleuchten ist ihr zweiter Roman, den sie auf Deutsch verfasst hat und der es nun auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis geschafft hat. Warum, ist jedoch rätselhaft.
Beeindruckendes Figurenpanoptikum
Nicht, dass Nachtleuchten ein schlechtes Buch wäre. Mit einem beeindruckenden Figurenpanoptikum erzählt Barbetta auf über 500 Seiten, in dreimal 33 Kapiteln plus einem Zusatzkapitel (das Buch ist voller Zahlenmagie und Wortspielereien) davon, wie die Menschen diese Zeit der Unsicherheit und des Umbruches erleben. Sie tut das so üppig und fantasievoll, dass sie bereits mit Julio Cortázar oder Jorge Luis Borges verglichen wurde.
Das erste Kapitel, "Bloody Mary", spielt vor allem in der Privatschule Instituto Santa Ana. Hier kommt die zwölfjährige Teresa durch den Einfluss der jungen Schwester María zum Schluss, sie müsse ihren Glauben hinaus in die Welt tragen. Bald gibt sie die Plastikmadonna als "Madonna von Ballester" wie eine Art Wanderpokal in Privathäusern ab, in der Hoffnung, sie möge die Menschen dort spirituell stärken. Im zweiten Teil begegnet man der politisierenden Männertruppe der Autowerkstatt Autopia, im dritten Teil geht es in spiritistische Zirkel. Was sich draußen im Land und in der Politik abspielt, erfährt man von den Figuren selbst: Die müssen sich an Ereignisse der jüngeren argentinischen Geschichte in unnatürlicher Detailfülle erinnern.
Stilistische Schwäche
Das Problem dieses Romans liegt aber nicht in dem flirrenden Gewirr aus Menschen, Alltäglichkeiten und Emotionen, das Barbetta mit einiger Kunstfertigkeit aufbaut. Das Problem ist seine sprachliche, stilistische Schwäche, die ausufernde Verwendung von Phrasen, Redewendungen, Metaphern. Es ist, als wäre der ganze Text in einen Synonymetopf gefallen, als dürfte hier kein Zeitwort zweimal vorkommen, müsste jedes Hauptwort von einem Adjektiv begleitet werden.
Nichts gegen abwechslungsreiche Sprache. Aber auf Dauer wird es enervierend. Es ergäbe noch einen Sinn, wären es die Figuren selbst, die durch ihre Sprache charakterisiert werden. Vor allem die Erzählstimme aber ist es, die in teilweise grenzwertig schiefen Bildern und Phrasen spricht. Da wird "dem aufgezwungenen Ernst ihrer Prozession" ein "Strich durch die Rechnung" gemacht, die Würde geht "flöten", und es gibt haufenweise Sätze wie diesen: "Da es dem Älteren davor bangte, dem Jüngeren übertriebene Hoffnungen zu machen, verkündete jener unmittelbar bevor sie sich anschickten, zu neuen Ufern aufzubrechen, dass man sie pünktlich erwarte, und gab zu verstehen, dass der Hausherr junior ein ziemliches Phänomen sei." Man wünschte sich, die Erzählstimme würde einfach einmal sagen, was ist. Denn es liegt auch an diesem umständlichen, uneigentlichen Sprechen, dass einem die Figuren und ihr Erleben seltsam fremd bleiben.
Falsche Wahl
Sie halten sich an ihren kleinen Leben, ihrer Gemeinschaft, den Utopien und Hoffnungen fest. Das ist ein schönes Bild, erst recht in Zeiten wie diesen. Man fühlt es nur nicht, genauso wenig, wie dass "im Lande alles aus den Fugen geriet". Dass es demgegenüber etwa Susanne Fritz, die in Wie kommt der Krieg ins Kind sehr genau und bedacht mit Sprache umgeht, nicht auf die Shortlist geschafft hat, verwundert. Es ist, als würde hier eine Idee ausgezeichnet – und als hätte man vergessen, worum es bei Literatur geht. Nicht um aufsehenerregende Ideen nämlich, sondern um die Sprache, in der Welt und Ideen vermittelt werden. (Andrea Heinz, 6.10.2018)