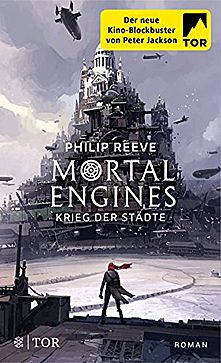
Philip Reeve: "Mortal Engines. Krieg der Städte"
Klappenbroschur, 334 Seiten, € 12,40, Fischer Tor 2018 (Original: "Mortal Engines", 2001)
Der Countdown beginnt: Am 13. Dezember läuft Peter Jacksons jüngstes Geschoss "Mortal Engines" an. Rechtzeitig zum Kinostart bringt der Verlag Fischer Tor noch einmal den 2001 im Original erschienenen und 2008 erstmals auf Deutsch veröffentlichten Roman des Briten Philip Reeve heraus, auf dem der Film beruht. Die weiteren drei Bände der ursprünglichen Tetralogie folgen in den nächsten Monaten, Teil 2 bereits in Kürze. Wer danach noch tiefer in die Steampunk- oder eigentlich Dieselpunk-Welt der "Mortal Engines" eintauchen will: Eine Prequel-Reihe dazu hat Reeve auch schon geschrieben. Und wer das Thema an sich faszinierend findet, kann sich als Ergänzung auch gleich Will McIntoshs Kurzgeschichte "City Living" aus dem Jahr 2015 auf den E-Reader laden.
Räuberische Amöben aus Stahl
Es war ein dunkler, böiger Nachmittag im Frühling, und im ausgetrockneten Bett der Nordsee eröffnete London die Jagd auf eine kleine Schürferstadt. [...] Zehn Jahre hatte es sich versteckt, in einer nasskalten Hügellandschaft weit im Westen, die nach Auskunft der Historikergilde einst die Insel Großbritannien gewesen war. – Das ist natürlich eine verheißungsvolle Einleitung für einen Roman, und ohne Verzögerung werden wir damit in eine Welt katapultiert, in der Städte auf Raupenketten und Rädern durch die Lande rollen, einander auflauern und mit gigantischen metallenen Kiefern ihre Beute packen.
Wir befinden uns in einer fernen Zukunft, Jahrtausende nach dem mit ABC-Waffen geführten Sechzig-Minuten-Krieg. Dass die Städte, die diese Apokalypse überstanden, anschließend mobilmachten, hatte ursprünglich sogar einen Sinn, wie wir noch erfahren werden. Inzwischen ist das Ganze aber längst zu einem globalen Ökosystem voller riesiger mechanischer Amöben verkommen, die einander die letzten Ressourcen streitig machen, wenn sie nicht überhaupt gleich zur Direkt-Ausschlachtung des Gegners schreiten. Es war nur natürlich, dass Großstädte kleine Städte fraßen, dass Kleinstädte Dörfer verschlangen und sich Dörfer an statischen Siedlungen gütlich taten. Das war der Städtedarwinismus.
Dramatis Personae
Hauptfigur Tom Natsworthy, ein 15-jähriger Museumsgehilfe der Londoner Historikergilde, findet diese Lebensweise übrigens grundsätzlich richtig. Erst nach und nach wird er im Verlauf des Romans seine Haltung zu überdenken beginnen – aber dafür braucht es auch eine transkontinentale Queste und eine Reihe von Schlüsselerlebnissen mit Menschen, denen er vertraut und die ihn umgehend aufs Übelste enttäuschen.
Zugleich steht Tom gewissermaßen im Mittelpunkt eines weiblichen Dreiecks, gebildet aus: 1) Katherine Valentine, einer Tochter aus begüterten Verhältnissen, die sich vom Prunk des reichen London aber nicht blenden lässt und bald auch das Dickens'sche Elend in dessen maschinellem Unterbauch kennenlernt. 2) Anna Fang, einer kampfgestählten Aeronautin, die die ortsgebundenen Städte Ostasiens gegen die Beutezüge der westlichen Traktionsstädte verteidigen will. Und vor allem 3) Hester Shaw, einer entstellten jungen Frau, die zur wichtigsten Gefährtin Toms auf seiner Queste wird. Auch wenn er ihre Rachepläne zunächst nicht unterstützen will.
Auf der Seite der Erwachsenen hätten wir dann noch Thaddeus Valentine, Katherines Vater und Toms Historiker-Idol – zugleich aber auch der Mann, den Hester töten will, weil er ihre Eltern ermordet haben soll. Magnus Crome, den zwielichtigen Oberbürgermeister Londons, der seine Stadt durch eine neue Superwaffe zur Beherrscherin der Welt machen will. Und schließlich Shrike, eine Art Steampunk-Terminator, den Crome auf Tom und Hester ansetzt (zu meiner Überraschung wird er im Film nicht von Andy Serkis verkörpert werden). All diese Figuren werden wichtige Rollen in Zusammenhang mit Cromes ominösem Projekt MEDUSA spielen, Spannung ist garantiert!
YA, aber nicht auf die simple Art
Die "Mortal Engines"-Tetralogie läuft offiziell unter "Jugendbücher", was aber recht großzügig aufzufassen ist. Young-Adult-typisch sind sicherlich das Alter der Hauptfiguren und die persönliche Entwicklung, die speziell Tom vollzieht. Anfangs glaubt er noch, dass in der Welt alles einer gerechten Ordnung folgt, bis er – Das war doch nicht fair! – gegenteilige Erfahrungen macht und gezwungen ist, das System, in dem er aufgewachsen ist, zu hinterfragen.
Die in YA-Literatur häufige Schwarz-Weiß-Zeichnung der Figuren findet sich bei Reeve allerdings nicht ... was erneut Tom am eigenen Leib erfahren muss. Er idealisiert den großen Thaddeus Valentine – bis der ihn ansatzlos in einen Abfallschacht schubst, weil er ein lästiger Zeuge ist. Immer wieder wird Tom in der Folge Menschen begegnen, deren äußerer Anschein nicht mit ihren tatsächlichen Handlungen übereinstimmt. So ist der Bürgermeister eines rollenden Dorfs, das den heimatlos gewordenen Tom aufnimmt, ein vollkommen freundlicher Zeitgenosse – verkauft Tom aber in die Sklaverei, wofür er sich mit den "harten Zeiten" entschuldigt. Ein blutrünstiger Pirat, der eigentlich keinerlei Skrupel kennt, behandelt Tom hingegen äußerst zuvorkommend. Viele der Figuren in "Mortal Engines" bewegen sich in einem spannenden Graubereich.
Vorfreude auf den Film
Und gar nicht YA-kompatibel scheint der Grad an Gewalt. Für ganz junge Leser ist das Buch wohl zu blutig – tote Kinder, Hunde und Hauptfiguren inklusive. Wird interessant sein zu sehen, wie die Kinoadaption damit umgeht, immerhin sind Hollywoodfilme ein wesentlich unfreieres Genre als Literatur.
Und apropos: Liest man "Mortal Engines", dann merkt man, dass es sich für eine Verfilmung geradezu aufgedrängt hat. Abgesehen vom Schauwert des Grundszenarios rollender Städte findet man hier von Beginn weg Passagen, die sich 1:1 in eine wirkungsvolle Szene umsetzen ließen, so optisch ist Reeves Stil. Inklusive sogenannter Money-Shots, etwa wenn sich die Kuppel der St. Paul's-Kathedrale öffnet, um eine Strahlenkanone zu enthüllen. Und dankenswerterweise stellt Reeve auch gleich eine ganze Reihe von Onelinern und Dialogen bereit, die Witz haben. Der Qualitätsunterschied zwischen der "Herr der Ringe"- und der "Hobbit"-Trilogie hat ja gezeigt, dass es durchaus hilfreich ist, wenn Peter Jackson auf O-Töne zurückgreifen kann, anstatt sich alles selbst ausdenken zu müssen ...
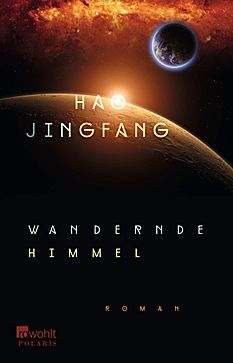
Hao Jingfang: "Wandernde Himmel"
Klappenbroschur, 748 Seiten, € 17,50, Rowohlt 2018 (Original: "Stray Skies", 2016)
Eine Geschichte von zwei Marsen: So könnte man die beiden folgenden Bücher zusammenfassen, die sich beide mit der Entwicklung von Kolonien auf dem Roten Planeten in vergleichbar naher Zukunft befassen – und dabei zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Vor Richard Morgans heißblütigem Yang auf der nächsten Seite ist erst einmal Hao Jingfangs entschleunigtes Yin dran. Die chinesische Autorin ist uns von der fantastischen Novelle "Peking falten" noch in bester Erinnerung. "Wandernde Himmel" war also auch unter dem Gesichtspunkt interessant, wie der Autorin der Sprung vom Kurz- zum XXL-Format gelingen würde.
Zum Hintergrund: Im späten 22. Jahrhundert haben Erde und Mars einen Krieg hinter sich gebracht und beäugen einander immer noch misstrauisch. Zaghaft wird die Diplomatie wieder aufgenommen – wie zaghaft, zeigt der Umstand, dass derzeit nur ein einziges Raumschiff zwischen den beiden Planeten hin- und herpendelt. Als der Roman beginnt, hat es gerade neben einer bunt zusammengesetzten Delegation von der Erde auch eine Gruppe von marsianischen Austauschschülern an Bord, die nach fünf Jahren Erde-Kennenlernen nun in ihre Heimat zurückkehren.
Symmetrie
"Wandernde Himmel" besteht aus drei Teilen und ist im ersten geradezu supersymmetrisch angelegt. Der individualistischen und tendenziell "westlichen" Kultur der Erde steht die kollektivistische und tendenziell "östliche" des Mars gegenüber. Dazu kommen nun zwei Hauptfiguren, die mit ihrem jeweiligen System zu hadern beginnen. Luoying, eine 18-jährige Tanzschülerin (und zugleich die Enkelin des marsianischen Generalgouverneurs), war Teil der Austauschgruppe und hat sich an die für Marsianer wilden Verhältnisse auf der Erde gewöhnt. Obwohl keineswegs ein Partygirl, vermisst Luoying die irdischen Vergnügungen und Freiheiten, die die Mars-Gesellschaft nicht bieten will. Die ist zwar kein Zwangssystem, wie man auf der Erde glaubt, sieht aber jeden am liebsten auf seinem Platz. Alles war so idealtypisch geordnet wie die Bepflanzung in einem platonischen Garten.
Auf der anderen Seite steht der junge Dokumentarfilmer Igor Lu von der Erde, der den Mars bald als vernunftgeprägtes Gegenmodell zur erbarmungslosen Dauerhektik und Durchkommerzialisierung der Erde schätzen lernt. Verstärkt wird die Symmetrie noch durch den Umstand, dass beide Figuren der Vergangenheit nachforschen: Igor möchte wissen, was sein verstorbener Mentor während eines Jahre zurückliegenden Marsaufenthalts getan hat. Und Luoying recherchiert das Schicksal ihrer Eltern, die einst aus unbekanntem Grund zu Zwangsarbeit verurteilt wurden und in weiterer Folge zu Tode kamen. Die Lösung dieses speziellen Rätsels erfahren wir übrigens nach 650 Seiten – zu einem Zeitpunkt, da viele es vermutlich längst vergessen haben, weil es Hao Jingfang weniger um eine klassische Handlung als um eine gesellschaftliche Betrachtung geht.
Über die Gesellschaft philosophieren
Liegt der Sinn des Lebens darin, große Werke zu schaffen und die Geschichte voranzutreiben, oder trägt das Leben seinen Sinn in sich selbst? Diese Frage steht für Luoying im Zentrum und ist der Ausgangspunkt dafür, die irdische und die marsianische Gesellschaft zu vergleichen. Wobei die Erde des Romans im Prinzip für unsere aktuelle Gesellschaft steht, während der Mars als möglicher Gegenentwurf diskutiert wird – mit Licht ebenso wie Schatten. "Wandernde Himmel" ist ein extrem diskursives Werk, was in Teil 1 noch auf recht originelle Weise gelöst ist, in den folgenden Abschnitten aber zunehmend zäh gerät.
Im zweiten und dritten Teil des Buchs nimmt der Textanteil, in dem wir uns im Hier und Jetzt der Handlungszeit befinden, spürbar ab. Immer wieder geht die aktuelle Handlung nahtlos in Erklärungen, philosophische Betrachtungen, historische Rückblicke und Ähnliches über. Dabei kommt auch ein von mir gar nicht geschätztes Stilmittel zum Einsatz: Eine Figur – in der Regel Luoying – liefert mit einer kurzen Frage ein Stichwort, auf das eine ausführliche erklärende Antwort folgt. Wie war das damals mit dem Krieg? Warum arbeiten die Leute? Ist mein Großvater ein Diktator? Und so weiter. Neutral formuliert könnte man auch sagen, dass sich ab Teil 2 die Geister scheiden werden: Wer einen Roman im engeren Sinne lesen möchte, dem wird das Geschehen nicht ausreichen. Wer hingegen das Gedankenspiel um eine im Detail beschriebene Gesellschaftsform und deren mögliche Weiterentwicklung schätzt, der ist hier gut bedient.
Die totale Entschleunigung
Man könnte "Wandernde Himmel" durchaus in eine Tradition mit Ursula K. Le Guins Utopien-Betrachtung "Planet der Habenichtse" stellen. In der praktischen Ausführung würde ich es auf halbem Weg zwischen Kim Stanley Robinsons "2312" und klassischen gesellschaftlichen Utopien aus dem 19. Jahrhundert ansiedeln, die auf einen Plot komplett verzichteten.
Ganz banal ausgedrückt, ist "Wandernde Himmel" viel, viel, viel zu lang. Immerhin haben wir es mit 750 Seiten in sehr kleiner Schrift zu tun und als Action-Crescendos gibt es einen Kreativwettbewerb, eine Parlamentsdebatte und eine Tanzdarbietung, die mit einer Sehnenscheidenentzündung endet. Und das war jetzt keine rhetorische Übertreibung. Aber Himmel wandern eben langsam ... Richard Morgan, obwohl gesellschaftspolitisch ebenfalls sehr bewusst, hatte da einen etwas anderen Ansatz, wie wir auf der nächsten Seite sehen werden.

Richard Morgan: "Thin Air"
Gebundene Ausgabe, 544 Seiten, Gollancz 2018, Sprache: Englisch
Es war ein Debüt nach Maß: Zu Beginn des neuen Jahrtausends – prä-Rundschau und daher hier nie rezensiert – katapultierte sich der Brite Richard K. Morgan ansatzlos mit seinen "Takeshi Kovacs"-Romanen in die erste Liga der Science-Fiction-Autoren. Die drei SF-Krimis aus den Jahren 2002 bis 2005 wurden zu Kultbüchern und sind nun aktueller denn je, seit sie für die TV-Serie "Altered Carbon" adaptiert wurden. Morgan indes wechselte später vorübergehend in die Fantasy (die "Land fit for Heroes"-Trilogie). Wobei "vorübergehend" in seinem Fall ganz schön lange ist, denn Morgan lässt sich für seine Bücher Zeit. Mit "Thin Air" ist er nun nach über einem Jahrzehnt in die Science Fiction zurückgekehrt und hat sich offensichtlich kein bisschen verändert.
So vage die zeitliche Einordnung auch bleibt, sie dürfte das einzige sein, was verhindert hat, dass "Thin Air" gleich ein Kovacz-Roman geworden ist. Denn nach Takeshi Kovacz und Carl Marsalis aus "Black Man/Th1rte3n" ("Skorpion") haben wir es erneut mit einem Protagonisten zu tun, der auf künstlichem Wege überlegene Kampfkraft erlangt hat und davon auch ohne viel Federlesens Gebrauch macht. Der "Neue" heißt Hakan Veil und war mal ein Overrider – was das genau heißt, muss man sich im Verlauf der Handlung selbst rekonstruieren. De facto bedeutet es, dass Veil von Geburt an auf verschiedene Weise körperlich aufgemotzt wurde und eine KI als unterstützenden "Partner" in sich trägt. Veils veränderter und veränderlicher Metabolismus erfordert es, dass er vier Monate im Jahr im Kälteschlaf verbringen muss – aber wehe, er läuft heiß!
Ende der Illusionen
Schauplatz des Geschehens ist der Mars – und wie Morgan den zeichnet, könnte er nicht unterschiedlicher zu dem in Hao Jingfangs "Wandernde Himmel" sein. Hier hat der Neoliberalismus gesiegt und alle hehren Visionen von einst zu Gunsten kurzfristiger und kurzsichtiger Geschäftemacherei entsorgt. "Mars is open for business", heißt es mehrfach im Roman. Profit steht über allem, und wer überleben will, muss seine Nische finden. Das gilt für den Roten Planeten als Ganzes, der der Erde laufend neue technologische Errungenschaften liefern soll. Und es setzt sich bis auf die individuelle Ebene hinunter fort. Für die meisten bedeutet es, dass sie sich irgendwo zwischen Kleingewerbe und Verbrechen durchschlagen müssen.
Es ist ein illusionsloses Zukunftsbild, und Morgan findet für das allgemeine Gefühl der Ernüchterung einige schöne Metaphern. Da lesen wir etwa vom Denkmal der einstigen Mars-Pioniere, das mittlerweile vandalisiert und mit Graffiti bedeckt ist. Oder erfahren nebenbei, dass das SETI-Observatorium auf dem Mars geschlossen wurde – nicht wegen anhaltender Erfolglosigkeit, sondern weil man tatsächlich Signale von Außerirdischen empfangen hat. Doch sind die Aliens durch solche Abgründe von Raum und Zeit von der Menschheit getrennt, dass die Entdeckung letztlich sinnlos war. Sie wurde abgehakt und vergessen.
Und letztlich ist das ganze Projekt Marskolonisierung das beste Beispiel für aufgegebene Träume. Die Terraformierung des Planeten wurde nämlich abgebrochen. Nur im Grabenbruchsystem des Valles Marineris kann man unter erdähnlichen Bedingungen leben, weil darüber eine künstliche Himmelsschicht aus (nur vage beschriebenen) Lamina eingezogen wurde. Zu Beginn des Romans stehen die Bewohner der größten Mars-Stadt auf den Straßen, um zu bewundern, wie die Lamina es regnen lassen – es ist bezeichnenderweise nur eine armselige Gischt. Dass die Stadt den Namen Bradbury trägt und damit ganz andere Marsbilder heraufbeschwört, unterstreicht noch einmal den Kontrast zwischen den Träumen von einst und der Wirklichkeit von heute.
Die Handlung in aller Kürze
"Thin Air" ist ein äußerst dicht gewobener SF-Krimi – zu dicht und personalstark, um auf Einzelheiten der Handlung einzugehen. Daher hier nur eine grobe Skizze: Veil hat seinen einstigen Overrider-Job verloren und sitzt seit Jahren auf dem Mars fest. Er verdingt sich als Mann fürs Grobe – eben hat er noch einen Auftragsmord erledigt (für den später allerdings eine moralische Rechtfertigung nachgereicht wird), schon wird er von der marsianischen Polizei als Bodyguard für eine Besucherin von der Erde engagiert. Madison Madekwe ist Teil einer Delegation der Colony Initiative (COLIN), die auf dem Mars eingeschwebt ist und unter dessen Bewohnern Sorgen um eine schleichende Übernahme auslöst. Nicht zu Unrecht: Das propagierte Selbstbild von COLIN ist zwar das einer "Hebamme der Menschheit" – Morgan aber beschreibt die Organisation als Raubtier, genauer gesagt als einen Dornenkronenseestern, der langsam seine Opfer aussaugt.
Der MacGuffin des Romans ist übrigens ein Mann, der bei einer Lotterie ein Ticket zur Erde gewonnen hat, aber verschwunden ist. Damit die "Überprüfung" des Mars durch COLIN zu begründen, ist zwar eine eher windige Angelegenheit, aber darum geht's ohnehin nicht wirklich: Nachdem so der Stein erst mal ins Rollen gebracht worden ist, erschließt sich für Veil und uns Leser während der Suche nach dem Verschollenen nach und nach das Netz aus Macht- und Profitgier auf Mars und Erde, das die Grenzen zwischen Politik, Wirtschaft und organisiertem Verbrechen vollständig verschwimmen lässt. Im Grunde ist der Mars ein einziger Sumpf – in gewisser Weise hat das Terraforming ja also doch geklappt ...
Nimmt einen in Anspruch
"Thin Air" ist vom Cyberpunk der 80er ebenso geprägt wie von der Popliteratur und den Neo-Hardboiled-Krimis der 90er – alles Genres mit illusionslosem Blick auf die Welt, soll heißen: sowohl genauem als auch zynischem. Die Handlung steht auf dem sicheren Fundament von Morgans analytischen Fähigkeiten, was politisch-ökonomische Verhältnisse anbelangt, sowie seiner Gabe, dies sprachlich umzusetzen. Der Roman ist ebenso komplex wie actionreich (und an einigen Stellen superbrutal) ... aber nicht unbedingt schnell. Etwas kürzen respektive ausdünnen hätte "Thin Air" meiner Meinung nach nicht geschadet – und jetzt werden Morgan-Fans wohl endgültig empört aufschreien: Dasselbe habe ich mir auch schon seinerzeit zu Takeshi Kovacs gedacht.
Nichts einzuwenden hätte ich allerdings gegen ein paar zusätzliche Seiten in Form eines Glossars gehabt. Immerhin werden wir hier nicht nur mit einer Vielzahl an Wortneuschöpfungen konfrontiert (besonders gelungen übrigens das Konzept der überall auf dem Mars herumschwirrenden codeflies, die Menschen wie Moskitos stechen, um ihnen Updates für ihre diversen Augmentierungen einzuimpfen), sondern auch mit jeder Menge an Organisationen und zwielichtigen Figuren, über deren Beziehungsgeflecht man erst mal den Überblick behalten muss. Immerhin gibt es aber ein äußerst ausführliches Interview mit Richard Morgan, in dem er auf die Hintergründe seiner jüngsten Schöpfung genauer eingeht – lesen lohnt.

Carlton Mellick III: "Neverday"
Broschiert, 192 Seiten, Eraserhead Press 2018, Sprache: Englisch
"Und täglich grüßt das Murmeltier" gehört zu den Standardmotiven der Phantastik – doch es blieb dem verehrungswürdigen Großmeister der Bizarro Fiction, Carlton Mellick III, vorbehalten, dem wohlvertrauten Thema neue Seiten abzugewinnen. Natürlich indem er es bis zum Extrem treibt: In der großartigen Novelle "Neverday" läuft die ewige Wiederholung des immer gleichen Tages schon seit Jahrtausenden ab. Und die Zeitschleife wird auch nicht nur von einer Person wahrgenommen, sondern vom Großteil der Bevölkerung. Die ganze Gesellschaft hat sich mittlerweile darauf eingestellt, dass an jedem Morgen wieder alles so ist wie am Tag zuvor.
Aufgewacht
Wie jeden Tag – es ist immer der 17. April 2017 – wacht Hauptfigur Karl Lybeck um halb acht auf, erledigt seine Morgenroutine (minus Zähneputzen, kein Grund mehr für vorausschauende Dentalhygiene) – und erschießt sich anschließend. "Killing yourself isn't good for you", wird man ihn später dafür tadeln. Es braucht eben nur den richtigen Kontext, und selbst der irrsinnigste Satz erhält seinen Sinn ...
Doch dann passiert eines Tages zum ersten Mal seit einer Ewigkeit etwas Neues. January Bradley, eine junge Frau aus der Nachbarschaft, wird davon geweckt, dass ihr Freund Jason sie beklaut, weil er angeblich fliehen muss. Die verwirrte January schließt sich ihm an, beide sterben auf der Flucht. Doch als sich das Ganze am nächsten Tag zu wiederholen beginnt, kann sich January zum ersten Mal ans Gestern erinnern. Nun ist auch sie awake – und Karl muss verblüfft feststellen, dass sich während all der Jahrtausende, in denen er abgeschieden daheim den täglichen Selbstmord begangen hat, nach und nach schon 70 Prozent der Bevölkerung der Zeitschleife bewusst geworden sind.
Die neue Gesellschaft
Nachdem sie nun den Behörden bekannt geworden sind, werden Karl und January in einen Orientierungskurs(!) geschickt, um sich in den neuen Umständen zurechtzufinden. "You'll never get a hangover no matter how much you drink. You'll never gain weight no matter how much you eat. You never have to worry about global warming or nuclear war or natural disasters or going hungry. You will never grow old. You will never get sick. You will never die."
Der Freibrief gilt aber natürlich nur für das, was man am 17. April tut. Wer da schon mit üblem Erbe vom Vortag aufgewacht ist, wird dies durch den täglichen Druck auf die Reset-Taste immer wieder tun müssen. Es gibt Selbsthilfegruppen für Menschen, die täglich verkatert, krank oder schwanger aufwachen. Und Mellick vergisst in seinem Gedankenspiel auch nicht auf tragikomische Einzelschicksale wie das von einem Mann, der täglich im Gefängnis aufwacht. Weil inzwischen alle wissen, dass er seine Strafe mehr als nur abgesessen hat, wird er nach dem Frühstück zwar jedes Mal freigelassen und kann arbeiten gehen – fühlt sich aber dennoch nicht wirklich frei und hat abends auch keinen Platz zum Heimkommen. "I'm a prisoner in the morning, a bag boy during the day, and a homeless man at night."
Apropos Arbeiten: Wie Karl und January im Kurs erfahren, hat die Gesellschaft die totale Anarchie, die aus dem Bewusstsein des konsequenzenlosen Handelns entspringen musste, durchlebt und hinter sich gelassen. Jetzt müssen wieder alle schön die Ordnung aufrechterhalten. Bankbeamte erinnern sich daran, ob man brav arbeiten war, und updaten den Kontostand der Bürger jeden Morgen entsprechend. Erinnerungen sind nun das höchste Gut – Karl, der schon viel länger wach sein will als alle anderen zusammen, hält dem allerdings entgegen, dass früher oder später alles wieder vergessen werden wird, wenn erst genug Zeit verstrichen ist. Trotzdem freut er sich wie ein Schneekönig darüber, dass sein Tag nun anders abläuft als all die unzähligen Male davor.
Klare Empfehlung
Es ist schon bemerkenswert, wie aus dem schock- und grindverliebten Bizarro-Genre ein Werk der Ideen-SF entspringen kann, der blütenweißesten Form von Science Fiction. Man wartet die ganze Zeit auf einen Eiter-Tsunami, raketenbrüstige Killer-Gynoiden mit explodierenden Köpfen oder was immer so zum alltäglichen Inventar von Bizarro-Autoren gehört. Umso gespannter blickt man auf die Deadline des geheimnisvollen Neverday, des 18. April, den man angeblich erreicht, wenn man sich wach hält. Die Behörden haben dies streng verboten, doch Karl und January wollen den Neverday trotzdem erleben, um die Ursache der globalen Zeitschleife herauszufinden.
Was sie dort vorfinden werden? Verraten sei nur so viel: Ganz lässt sich Mellick die pulpigen Horror- und SF-Elemente letztlich nicht nehmen. Doch nichts verursacht so viel Gänsehaut wie die Konfrontation mit der Ewigkeit ...
Weitere Titel von Carlton Mellick III
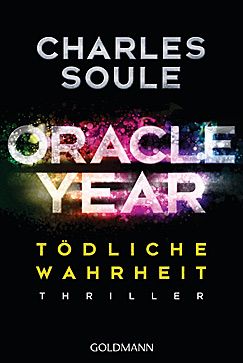
Charles Soule: "Oracle Year. Tödliche Wahrheit"
Klappenbroschur, 510 Seiten, € 10,30, Goldmann 2018 (Original: "The Oracle Year", 2018)
"Das sind die Dinge, die passieren werden." So steht es auf einer anonymen Website über einer Liste von 20 bunt zusammengewürfelten Ereignissen aus der nahen und nächsten Zukunft. Die sind großteils recht banaler Natur – etwa die genaue Geburtenzahl in einem Krankenhaus an einem bestimmten Tag. Aber weil die Vorhersagen nacheinander punktgenau eintreffen, entwickelt sich rasch ein riesiger Medienhype um das "Orakel", wie die mysteriöse Quelle genannt wird.
Wir Romanleser sind der Öffentlichkeit freilich voraus: Wir wissen von Anfang an, dass sich hinter dem Orakel Will Dendo verbirgt, der eines Tages mit dem Wortlaut von 108 Prophezeiungen im Kopf aufgewacht ist, ohne zu wissen, woher sie kommen. Will ist ein New Yorker Musiker ohne Diskographie – ein Umstand, den er übrigens mit seinem Schöpfer Charles Soule teilt. Soule kennen Comic-Fans von seiner Arbeit für Marvel und "Star Wars" und vielleicht auch von seiner Eigenschöpfung, der First-Contact-Serie "Letter 44". "Oracle Year" nun ist Soules Roman-Debüt – ein recht gelungenes, sei gleich gesagt.
Der Rubel rollt
Soule hält sich – eine erfrischende Entscheidung – gar nicht erst mit der Vorgeschichte auf und überspringt den Teil, in dem das unerhörte Ereignis Will aus seiner bisherigen Normalität reißt; es ist Soule nicht einmal einen späteren Rückblick wert. Als der Roman beginnt, hat sich Will bereits mit seinem "Geschenk" arrangiert und zusammen mit seinem besten Kumpel, dem Investmentbanker Hamza Sheikh, einen Weg ausgeknobelt, wie sich aus der Sache Geld schlagen lässt. Denn nichts anderes ist die Orakel-Website: Sie soll potenzielle Kunden anlocken, die für Wissen um die Zukunft ordentlich Kohle lockermachen.
Und schon sind wir mitten in Soules Herangehensweise, das Thema aus allen möglichen Winkeln zu beleuchten. Die kommerzielle Verwertung ist nur einer davon. Da kann ein Hedgefonds eine halbe Milliarde Dollar für die Info über bevorstehende Ernteausfälle abdrücken. Oder es läuft etwas komplizierter ab: So besagt eine der Prophezeiungen nichts anderes, als dass eine bestimmte Durchschnittsfrau, die bisher niemandem aufgefallen ist, zum ersten Mal seit ihrer Kindheit wieder Schokomilch trinken wird ... flugs mutiert die Betreffende daraufhin zum neuen Werbestar der Milchindustrie. Soule hat insgesamt recht realistische Vorstellungen davon, wie sich Wahrsagerei in der Praxis auswirken würde und anwenden ließe.
Das kann doch nicht alles sein
Während Hamza voll und ganz mit der finanziellen Verwertung zufrieden ist, beschleichen Will Zweifel: "Aber wenn hinter alledem keine höhere Absicht steckt, dann bin ich bloß ein kleiner Musiker, der Glück hatte. Wenn die Prophezeiungen nichts bedeuten, dann bedeute ich auch nichts." – "Darauf geschissen", sagte Hamza. "Wenn man reich ist, bedeutet man automatisch etwas." Natürlich lässt sich Will damit nicht dauerhaft abspeisen und stellt bald einen zweiten Schwung Vorhersagen ins Netz, der diesmal Unfälle und Katastrophen betrifft und damit das Potenzial hat, Leben zu retten. Er steckt kurz gesagt mitten im bekannten Superhelden-Dilemma: Habe ich durch meine besondere Kraft auch eine besondere Verantwortung?
Gegenspieler dürfen natürlich auch nicht ausbleiben. Der US-Geheimdienst setzt eine recht ungewöhnliche Figur namens "Coach" auf die Spur des Orakels: äußerlich eine freundliche ältere Dame mit erstaunlichen Networking-Fähigkeiten, die sich aber als stahlhart und skrupellos erweist, wenn's drauf ankommt (vor meinem geistigen Auge ist unwillkürlich das Bild von Shohreh Aghdashloo aus "The Expanse" aufgetaucht ...). Und weil es ein US-Roman ist, darf leider auch das Thema Religion nicht fehlen – diesmal in Person des Reverends Hosiah Branson, der seinen persönlichen Kreuzzug gegen das gottlose Orakel startet.
Wesentlich reizvoller ist da schon die Antwort, die das Orakel für diesen speziellen Gegner bereit hält. Der simple, mit Datumsangabe versehene Satz "Reverend Hosiah Branson pfeffert sein Steak" führt uns nämlich auf bezaubernd schlichte Weise zur Frage des freien Willens. Das erinnert ein bisschen an Ted Chiangs Gedankenspiel "Was von uns erwartet wird" um eine Maschine mit einem Lämpchen, das stets eine Sekunde, bevor man den Einschaltknopf drückt, aufleuchtet. So einfach, so fies! Wir dürfen gespannt sein, ob der gute Reverend sein Steak am Ende pfeffern wird oder ob er sich erfolgreich seinem Schicksal widersetzt. Und eine gute Nachricht an dieser Stelle noch: Von Ted Chiang wird 2019 endlich wieder eine Storysammlung herauskommen, bislang Unveröffentlichtes inklusive. Hurra!
Spannend bis zum Schluss
Aber zurück zu Charles Soule. Dass er auf keinen Aspekt des von ihm gewählten Themas vergisst, soll nicht heißen, dass wir es hier mit einer theoretischen Abhandlung zu tun hätten. Bei weitem nicht. "Oracle Year" ist ein schnörkellos erzählter Mystery-Thriller klassischer Prägung und spannend bis zum Schluss, wofür nicht allein Wills Gegenspieler sorgen. Unser Held beginnt nämlich zu argwöhnen, dass die vermeintlich zusammenhanglosen Prophezeiungen untereinander doch irgendwie eine Ereigniskette bilden könnten – und in ihrer Gesamtheit womöglich sogar dazu beitragen, dass die Welt im Verlauf des Romans auf immer bedrohlichere Weise auf ein wirtschaftliches und politisches Chaos zutreibt. Und über allem steht noch das Rätsel der allerletzten Prophezeiung, die nur aus der ominösen Zahlenreihe "23 12 4" besteht ...
Eine andere Zahlenreihe wäre "11/22/63". So hieß Stephen Kings Roman über den Versuch zur Verhinderung des Kennedy-Attentats respektive die daraus entwickelte TV-Serie mit James Franco. Ungefähr in dieser Machart könnte auch die Serie angelegt sein, für die – Tataaaa! – "Oracle Year" bereits optiert wurde (sogar noch bevor das Buch überhaupt erschienen ist). Der Stoff ist einfach dankbar – heute noch auf Papier, bald vielleicht schon im Stream.
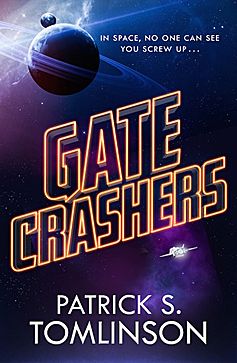
Patrick S. Tomlinson: "Gate Crashers"
Broschiert, 304 Seiten, St Martin's Press 2018, Sprache: Englisch
"Congratulations! You've discovered another space-faring race. Now, don't panic. The fact your're reading this means you haven't been vaporized." So steht es im offiziellen Handbuch für den Erstkontakt unter "Section 4: Encountering E. T. in Space", das die wackeren Romanhelden von "Gate Crashers" konsultieren werden – bedauerlicherweise erst, nachdem sie bereits in den ersten Fettnapf getappt sind und damit eine Ereigniskette ausgelöst haben, die sie bis zum Schluss auf Trab halten wird ...
Patrick S. Tomlinson haben deutschsprachige Leser im vergangenen Jahr über sein Generationenschiff-Abenteuer "The Ark" kennengelernt (der Nachfolgeband "The Colony" wird im Frühling erscheinen). Und ein Langstreckenschiff ist auch in "Gate Crashers", angesiedelt im 24. Jahrhundert, einer der Schauplätze. 30 Lichtjahre hat sich das Raumschiff "Magellan" schon von der Erde entfernt, und noch liegen die 157 Crewmitglieder friedlich im Kälteschlaf: Hearts beat once every other minute. Blood flowed with the speed of buttercream frosting. Dreams played at a pace that would make a Galapagos tortoise glance at its watch.
Doch dann werden sie von der Schiffs-KI aus dem Schlaf gerissen, denn die hat mitten im Nirgendwo ein außerirdisches Artefakt entdeckt. Und was tut man vernünftigerweise in einer solchen Situation? Richtig, man holt das unbekannte Ding ungeachtet der möglichen Folgen an Bord ...
Interstellare Frechheit
Zur Lösung des Rätsels wird ein interdisziplinäres Team auf das Artefakt angesetzt. Vor Ort gehört Allison Ridgeway dazu, die Kommandantin der "Magellan" – auf der Erde sind unter anderem Eugene Graham, der Leiter der Space Administration, und das junge Ingenieurstalent Felix Fletcher im Einsatz: Dank Anton Zeilingers Vorarbeit können alle Beteiligten überlichtschnell per Quantenverschränkung kommunizieren und finden so bald heraus, dass es sich bei dem Objekt um eine Boje handelt, die eine Botschaft an unbekannte Empfänger ausstrahlt.
Mit einiger Mühe wird diese Botschaft schließlich auch entschlüsselt ... und ist zu komisch, um ihren Wortlaut hier zu spoilern. Auf jeden Fall empört sie den US&EU-Präsidenten derart, dass er sofort ein waffenstarrendes Kriegsschiff bauen lässt, um es der "Magellan" hinterherzuschicken. Das Kommando führt der Weltraumheld Maximus Tiberius, der – nomen est omen – in seiner pompösen und politisch unkorrekten Art das Ensemble noch einmal in willkommener Weise bereichern wird (willkommen freilich nur beim Leser; seine Mithelden und speziell -heldinnen treibt der Astro-Gockel an den Rand des Wahnsinns).
Humor ist Trumpf
Vom ersten Absatz an ist erkennbar, dass "Gate Crashers" auf Humor angelegt ist. Im Nachwort erklärt Tomlinson, dass ihn die Lektüre von "Per Anhalter durch die Galaxis" zu seiner Geschichte inspiriert habe, und einige Elemente scheinen das auch zu unterstreichen: Da erklären beispielsweise die in weiterer Folge noch auftretenden Aliens – allesamt übrigens ziemliche Karikaturen –, dass sie Englisch gelernt haben, weil man in der ganzen Galaxis "Sesamstraße" und "Star Trek" glotzt. Oder unsere Helden übertölpeln einen Gegner mit einem derart haarsträubenden Trick, dass man beim Lesen rote Ohren bekommt.
... und doch, trotz aller Klamauk-Elemente, ist der Plot in seinem Kern gar nicht so albern, sondern entspricht eigentlich ganz einem klassischen Weltraumabenteuer. Irgendwie hat sich bei mir der Eindruck eingestellt, als wäre die ursprüngliche Idee zu "Gate Crashers", Tomlinsons Aussage zum Trotz, eine herkömmliche Action-Erzählung gewesen, die erst nachträglich durch eine bewusste Entscheidung auf Humor gebürstet wurde – analog etwa zu Filmen wie dem David-Duchovny-Vehikel "Evolution" oder in jüngster Vergangenheit "Thor 3".
Wie auch immer: Auf jeden Fall hat Tomlinson die Lockerheit konsequent durchgezogen. Und weil mir ausnahmsweise kein zusammenfassender Schlusssatz eingefallen ist, zitiere ich einfach einen aus einer anderen Rezension, den ich voll und ganz unterschreiben kann: "Gate Crashers" ist in keinster Weise eine lebensverändernde Lektüre, aber eine sehr unterhaltsame.
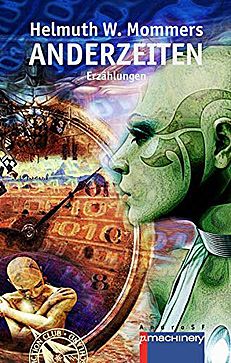
Helmuth W. Mommers: "Anderzeiten"
Gebundene Ausgabe, 580 Seiten, € 24,60, p.machinery 2018
Aus dem steten Strom an Paperbacks des Verlags p.machinery ragt dieser gebundene Brocken so deutlich heraus, dass man ihn noch aus dem Weltraum sehen kann. Und das seltene Format ist auch nichts weniger als eine angemessene Würdigung für – ist nicht böse gemeint – einen der Veteranen der Science Fiction im deutschsprachigen Raum. Den Helmuth W. Mommers nebenbei so sehr in sich vereint wie niemand anderer: Geboren in Wien, wo er in den 2010er Jahren auch die Bibliothek der Villa Fantastica aufgebaut hat, lebte er lange Zeit in der Schweiz und veröffentlichte seine Erzählungen in annähernd der vollen Bandbreite an verlegerischen Kurzgeschichten-Biotopen, die man in Deutschland finden kann.
Den SF-Literaturbetrieb hat der gestern(!) 75 gewordene Mommers als Autor ebenso wie als Übersetzer und Herausgeber mitgestaltet. Wobei seine Autorentätigkeit in zwei weit voneinander getrennte Phasen zerfällt: Der erste Schub war in den 1960ern, dann setzte es eine lange Unterbrechung (bzw. einen "Unterbruch", wie Mommers im Vorwort schreibt, man merkt die Schweizer Jahre), bis es in den 2000ern wieder losging. Der empfehlenswerte Sammelband "Anderzeiten" umfasst 26 Erzählungen dieser zweiten Welle, entstanden zwischen 2002 und 2011.
Keine Geschichte ohne Idee
Wie Mommers betont, betrachtet er die Idee als den Dreh- und Angelpunkt einer SF-Erzählung. "Geschenk von den Sternen", das er als seine Lieblingsgeschichte bezeichnet, führt dies exemplarisch vor: Eine intergalaktische Sonde lässt unzählige Würfel auf die Erde regnen – es stellt sich heraus, dass diese jeden Gegenstand nach Belieben verdoppeln oder an einen anderen Ort versetzen können. Was würde das mit unserer Gesellschaft machen?
Der Ideen-Fokus führt mehrfach dazu, dass wir uns in "Twilight Zone"-artigen Szenarien wiederfinden. Da ist etwa das Ehepaar von "Immer wieder Sonntag", das beim Morgensex von zeitreisenden Touristen beobachtet wird, die glauben, sie wären unsichtbar. Oder der treffend benannte Handelsvertreter Rudi Gerngross in "Goodbye James!", dem durch eine Kofferverwechslung Supertechnologie in die Hände fällt. Oder – weniger humorvoll – die Familie in "Incommunicado", die plötzlich in eine fremde Umgebung versetzt und dort wie Käfigtiere von Aliens beglotzt und betatscht wird. Das mit übernatürlichen Kräften ausgestattete Mädchen aus "Loris Wunderland" (sehr schön ominöser Schluss!) würde übrigens ebenfalls eine spannende "Twilight Zone"-Episode abgeben.
Humoristisch bis besinnlich
Satirisch wird's, wenn in "Habemus Papam" eine Papstwahl im 29. Jahrhundert ansteht. Die Geschichte lebt von der grotesken Diskrepanz zwischen dem althergebrachten Wahlritual und dem Umstand, dass inzwischen auch Aliens, Roboter und sogar Frauen wählbar sind. Oder wenn sich in "Zur falschen Zeit" der ziemlich unsympathische Balthasar für ein Leben in einer besseren Zukunft einfrieren lässt. Das führt nicht zur simplen Pointe, dass die Zukunft schlechter ist (auch wenn es stimmt), sondern zu einer wahren Odyssee, weil sich der anspruchsvolle Balthasar immer weiter durch die Zeit schicken lässt, bis er zum Fliegenden Holländer auf Eis wird. Herrlich grotesk auch "Körper zu vermieten", in dem die Welt so voll geworden ist, dass man seinen Körper im Teilzeit-System an andere Bewusstseine vermieten kann. Leider hat der Erzähler das Pech, an einen rücksichtslosen Mietnomaden zu geraten, und liefert sich mit diesem einen erbitterten Kleinkrieg.
Gerade weil der Erzählton in der Regel locker bis humorvoll ist, sind mir aber die besinnlicheren Geschichten besonders positiv aufgefallen. "Ein Hund und sein bester Freund" etwa lebt ganz von seiner Stimmung: Die Menschen haben die Erde verlassen und nur ein genmodifizierter Hund und ein Roboter ziehen noch durch die Leere – aber wenigstens haben sie einander. "Stimme des Gewissens" ist eine geraffte Coming-of-Age-Geschichte in einer Gesellschaft, die persönliche Beziehungen (inklusive Elternschaft) meidet und Kinder durch implantierte KIs sozialisieren lässt. Mommers vermeidet in seiner nüchternen Schilderung explizites Moralisieren – auch wenn seine Meinung klar erkennbar bleibt.
"Ruhe in Frieden" schließlich zeichnet ebenfalls ein Leben im Zeitraffer – diesmal in der Rückschau. Der Erzähler blickt kaleidoskopartig auf die Stationen seines Lebensweges zurück, während er auf seinem eigenen Begräbnis die Asche seines Körpers in Empfang nimmt, um eine posthumane Existenz anzutreten. Was zu guter Letzt sogar noch mit einem Schuss Hoffnung durchsetzt ist – für mich wäre das die bessere Abschlussgeschichte für den Band gewesen als die tatsächlich gewählte.
Zeitlose Lektüre
So verschieden die Themen der Geschichten auch sind, es ziehen sich einige rote Fäden durch. Neben dem Ideen-Fokus (und dem Umstand, dass Mommers' männliche Hauptfiguren in Summe durch einen ganzen Ozean aus wogenden Brüsten kraulen dürfen) ist das vor allem die muntere Erzählweise; die 26 Geschichten sind wirklich äußerst angenehm zu lesen. Mommers bleibt dabei stets geradlinig und lockert den Grundstil hin und wieder auf, indem er leichte Variationen ausprobiert: Mal ist eine Geschichte in Tagebuchform oder als Audio-Protokoll verfasst, mal überwiegt indirekte Rede statt Dialogform, mal dürfen zur Abwechslung spanische Lehnwörter die SF-üblichen Anglizismen ersetzen.
An einer Stelle bezieht sich Mommers auf Robert Sheckley und Fredric Brown – und das passt. Die Geschichten in "Anderzeiten" haben eine Golden-Age-Anmutung und wirken im guten Sinne zeitlos. Manche der Themen hätten im Goldenen SF-Zeitalter um die Mitte des 20. Jahrhunderts nicht vorkommen können (Stichwort Online-Welt), andere hätten auch schon den damaligen Autoren einfallen können. Am anachronistischsten – immerhin ist seit den frühen 2000er Jahren auch schon wieder einige Zeit verstrichen – wirkt witzigerweise kein technologischer Aspekt, sondern eine Namensvergabe. Da gestaltet der Protagonist von "Ein Programm zum Verlieben" einen weiblichen Avatar zur Frau seiner Träume, die alle Cybersex-Fantasien wahr werden lässt – und wie nennt er sie? Angela ...
Das Vorwort zu "Anderzeiten" hat Mommers mit "Ein Plädoyer für die Kurzgeschichte" betitelt. Während man – ein Zitat Wolfgang Jeschkes – bei einem Roman geistig die Hausschuhe anlassen könne, bis man durch ein unweigerliches "Ende" sanft entschläft, hält einen der schnelle Umsteigetakt von einer Kurzgeschichte zur nächsten wach. Ich habe das wörtlich genommen und über einen längeren Zeitraum hinweg jeden Morgen mit ein paar der Kurzgeschichten hier begonnen. Macht wirklich munter!
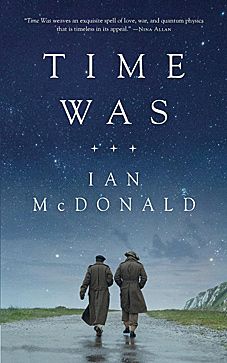
Ian McDonald: "Time Was"
Broschiert, 144 Seiten, Tor Books 2018, Sprache: Englisch
Das also macht Ian McDonald in der Pause zwischen zwei "Luna"-Schmökern: Er haut mal eben eine Novelle zu einem ganz anderen Thema raus. Nämlich eine Zeitreise-Mystery mit romantischem Einschlag – eine durchaus gängige Kombination, denken wir etwa an das kürzlich in der Rundschau vorgestellte "Buying Time" von Eric Brown oder, natürlich, an den Bestseller "Die Frau des Zeitreisenden" von Audrey Niffenegger.
Doch auch wenn "Time Was" offiziell als time travel romance firmiert, spielt die Liebesgeschichte im Kern der Erzählung nur eine indirekte Rolle. Das betreffende Paar – die beiden Soldaten Ben Seligman und Tom Chappell – bleibt nämlich weitestgehend im Hintergrund. Die Geschichte der beiden ist letztlich nur das Geheimnis, das die eigentliche Hauptfigur zu ergründen versucht.
Die Liebenden der Zeit
Besagte Hauptfigur – zugleich der Ich-Erzähler, dessen Namen wir aus gutem Grund erst spät erfahren – hat sein Leben der Bibliophilie gewidmet. Er stöbert nach seltenen Büchern, vertickt seine Funde im Internet und hortet in seiner Wohnung derartige Stapel, dass seine Vermieterin hin- und hergerissen ist: Soll sie ihn rausschmeißen, ehe ihr die Decke unter der Bücherlast durchbricht, oder lässt sie ihn bleiben, damit sie ihm nicht beim Abtransport helfen muss?
Eines Tages findet der Erzähler in einem anonymen Gedichtband aus den 30er Jahren einen beigelegten Liebesbrief von Tom an Ben und ist sofort angefixt. Er aktiviert sein Bücherfreunde-Netzwerk, ob es noch irgendwo sonst Informationen über die beiden gibt. Es finden sich tatsächlich welche – allerdings solche der ungeahnten Art. Fotos zeigen die beiden Soldaten nicht nur im Zweiten, sondern auch im Ersten Weltkrieg und sogar im Bosnien der 1990er Jahre. Ohne Spuren von Alterung tauchen Tom und Ben in ganz verschiedenen Kapiteln der Historie auf – auffallend oft übrigens an Stätten grausiger Massaker wie Nanking oder Gallipoli. Und doch sind die Fotos von Kriegsschauplätzen Zeugnisse der kurzen glücklichen Perioden, in denen Tom und Ben wenigstens zusammen waren. Sehr viel öfter blieben die beiden unfreiwilligen Zeitreisenden Jahrzehnte und Kontinente voneinander getrennt, wie unser Erzähler Stück für Stück zu rekonstruieren beginnt.
Mit der freigeistigen Büchersammlerin Thorn Hildreth an seiner Seite gerät unser Erzähler in der Folge immer tiefer in ein Geflecht seltsamer Ereignisse, rekonstruiert aus spärlichen Hinweisen und "erklärbar" nur durch quasi-mystical quantum-magical theories, wie es an einer Stelle heißt. Es werden Namen wie Shingle Street und Rendlesham fallen, die das Herz professioneller Verschwörungstheoretiker und UFO-Gläubiger sofort höherschlagen lassen. Alle anderen können ja googeln – und bei der Gelegenheit auch gleich zeitgenössische Jargon-Ausdrücke wie Eyties nachschlagen. "Time Was" hat zwar ein historisches Setting mit Schwerpunkt auf den 40er Jahren, vermittelt aber genauso konsequent wie der Zukunftsroman "Cyberabad", dass wir uns in einer anderen Welt mit entsprechend anderen Bezugspunkten und anderem Wording befinden.
Bittersüße Melancholie
"Time Was" ist die richtige Lektüre für den Herbst, Melancholie das vorherrschende Gefühl (Under a sky the colour of judgment ...). Zum Ausdruck gebracht wird diese von McDonald in gewohnter sprachlicher Souveränität, inhaltlich gespeist wird sie in mehrfacher Hinsicht: Durch das Motiv von Liebenden, die bei ihren Stürzen durch die Zeit immer wieder getrennt werden und nur mit großer Mühe wieder zusammenfinden, und durch das Gefühl der Unausweichlichkeit, das sich bei Geschichten über Zeitschleifen unweigerlich einstellt, wenn es aufs Ende zugeht.
Auf besonders poetische Weise kommt die Melancholie über die spezielle Form der Kommunikation ins Spiel, die Tom und Ben ersonnen haben: Sie hinterlassen einander Botschaften in Gedichtbänden, wie unser Erzähler einen gefunden hat. Aufbewahrt werden diese Bände in renommierten Antiquariaten – deshalb, weil diese die einzigen Fixpunkte im Wandel der Zeit sind. Während sich rings um sie die Städte laufend verändern, haben nur die alten Traditionsbuchhandlungen über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte Bestand und können so den Zeitreisenden als Anlaufstelle dienen. Oder hatten Bestand, genauer gesagt. Denn nun, in der Zeit des Internethandels, sterben die Antiquariate allmählich aus. Und unser Erzähler, der ja selbst einen Buchversand von seinem Wohnzimmer aus betreibt, trägt damit auch seinen Teil dazu bei, dass es keine Geschichte mehr wie die von Tom und Ben geben wird.
"Time Was" ist eine zwar leider traurige, zugleich aber auch sehr schöne und vielschichtige Erzählung, die lange nachwirkt. Ich wage die Prognose, dass man sie auch dann noch nicht vergessen hat, wenn der begehrlich erwartete nächste "Luna"-Band auf den Markt kommt: Im März soll es so weit sein.

Frank W. Haubold: "Jenseits der Dunkelheit"
Broschiert, 202 Seiten, € 9,99, Apex/epubli 2018
Gleich zwei Storysammlungen in unmittelbarer Abfolge hat der deutsche Autor Frank Haubold im Oktober herausgebracht: "Gesänge der Nacht" im Begedia-Verlag (wird zu einem späteren Zeitpunkt rezensiert) und diesen Band, der den Untertitel "Drei Novellen" trägt. Korrekterweise müsste man allerdings eher von zwei Novellen und einer Kurzgeschichte schreiben, zumal der Längenaspekt für die Erzählungen auch nicht ganz unerheblich ist.
Also stürzen wir uns gleich mal rein, wie es auch die Kurzgeschichte in der Mitte des Bands tut: "Feenland" beginnt nämlich erst da, wo bei einem Kinofilm schon der Abspann liefe – nun versuchen wir herauszufinden, welche Art Film es war. Die beiden Hauptfiguren, das Liebespaar Jason und Ivory, haben es geschafft, mit ihrem Raumschiff "Hoffnung" aus der Föderation zu fliehen. Wovor genau Jason Ivory retten musste, erfahren wir im Rückblick, einen Twist gibt's obendrauf.
Utopia in der Ägäis
Genrewechsel. Die Erzählung "Die beste aller Welten", die den Band eröffnet, ist eine Variation zum Thema Utopie. Der nicht mehr ganz taufrische Schriftsteller Marian Grünberg sagt einer EU Lebwohl, die von Terror heimgesucht wird und zunehmend autoritäre Züge angenommen hat. Freiheit erhofft er sich auf der Insel Kalanos, die der griechische Staat an die Betreiber eines geheimnisvollen Sozialprojekts verkauft hat. Durch Mundpropaganda ist Kalanos zum Wunschziel von EU-Bürgern geworden, die sich nun wie Marian von Schleppern übers Meer schmuggeln lassen: Das ist zwar nicht der Kern der Handlung, aber eine gelungene Ironie am Rande.
Thriller- und Mysteryelemente reichen sich hier die Hand. Da ist zum einen der EU-Geheimdienst, der argwöhnt, dass sich hinter dem Projekt eine potenzielle Bedrohung verbirgt, und deshalb Marian als Spitzel einsetzen will. Und dazu kommt das Phänomen, dass Marian beim Betreten eine körperliche Verjüngung erlebt. Das gilt es erst mal zu genießen, ehe das Geheimnis der Insel ergründet wird – ebenso wie den Umstand, dass Kalanos auch sexuell eine befreite Zone ist. Es ist das ideale Biotop für einen Mann alter Schule, dem zu Frauen Gedanken wie dieser durch den Kopf gehen: In gewisser Weise waren sie wie Blumen, die immer weiter blühten, leuchteten und lockten, egal, wie oft sie bestäubt worden waren. – Marians Staubbeutel erlebt einen zweiten Frühling.
Ausnahmsweise wünschenswert: Verlängerung
Was das Geheimnis von Kalanos ausmacht, ist übrigens auch nicht der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte: Die wahre Natur des Insel-Idylls wird bereits zur Hälfte enthüllt – danach schlägt die Erzählung noch einmal eine ungeahnte Volte. Womit wir allerdings schon beim eingangs erwähnten Längenaspekt wären. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob die beiden Erzählungen ursprünglich wirklich in dieser Form gedacht waren. Jedenfalls hätte sowohl der Kurzgeschichte als auch der Novelle der Ausbau zur jeweils nächstlängeren Erzählform gutgetan.
So setzt es in "Feenland" einen Infoblock über wirtschaftspolitische und kriminelle Querverbindungen. Der erklärt zwar den Hintergrund zur Geschichte von Jason und Ivory, wirkt aufgrund der Kürze der Erzählung aber etwas überproportional. Ein Phänomen, das mir in deutschen Kurzgeschichtenbänden übrigens immer wieder begegnet: Es wird mehr Hintergrund geliefert, als die knappe Erzählung braucht. "Die beste aller Welten" wiederum wartet in der zweiten Hälfte mit teils beträchtlichen Zeitsprüngen auf; bei weiterem Ausbau hätte das einen epischen Roman ergeben können. Sowohl "Feenland" als auch "Die beste aller Welten" sind im Prinzip gut – in beiden Fällen scheint mir aber die dahinterstehende Idee größer als der vorhandene Platz.
Glaube und Wissen
Ein vollkommen harmonisches Maß erreicht dafür die dritte Erzählung, "Das Mädchen aus dem All". Die führt uns nicht nur in den Bereich der Science Fantasy, sondern auch in eine bestens vertraute Welt, nämlich die von Haubolds "Götterdämmerung"-Trilogie. Immerhin gehört eine der beiden Hauptfiguren, der Weltraum-Pater Adrian, dem schon in der Trilogie vorkommenden Orden der Heiligen Madonna der Letzten Tage an. (Die Madonna ist übrigens die einzige weibliche Figur im ganzen Band, die nicht in einem sexuellen Kontext steht, just sayin' ...)
Adrian befindet sich auf einem Erkundungsflug in eine Dunkelzone jenseits der von Menschen bevölkerten Teile der Galaxis, ohne zu ahnen, dass er dort bereits erwartet wird. Lalena, eine nicht im herkömmlichen Sinne menschliche Frau, lebt auf einem Ozeanplaneten – und natürlich ist es auch kein Meer im herkömmlichen Sinne: Immerhin schweben auf dieser metaphysischen Welt die Seelen Verstorbener in Form von "Traumkugeln" ein. Wenn das Meer Lalena dem Pater auf einem Abfangkurs entgegenschickt, ist es letztlich also nichts anderes als Gott, der einen Engel aussendet, um einen Sterblichen vom Betreten des Himmels abzuhalten.
Selbst wenn man es wie ich mit Wolfgang Jeschke hält und Religion als die Pest der Menschheit betrachtet, kommt man nicht umhin, "Das Mädchen aus dem All" als in sich stimmige Erzählung zu empfinden: Vom Grundgedanken, dass Wissen den Glauben zerstören würde, bis zum eigenwilligen Szenario zwischen Science Fiction und Metaphysik – eine Nische, die im deutschen Sprachraum keiner in vergleichbarer Weise besetzt hat wie Frank Haubold.
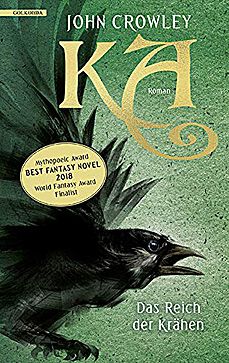
John Crowley: "Ka. Das Reich der Krähen"
Gebundene Ausgabe, 573 Seiten, € 25,60, Golkonda 2018 (Original: "Ka. Dar Oakley in the Ruins of Ymr", 2017)
Irgendwie ist es nie dazu gekommen, dass ich John Crowleys "Little Big" ("Das Parlament der Feen") gelesen hätte – ich bin mir aber bewusst, in welcher Ehrfurcht Leute, die etwas von Fantasy verstehen, von diesem Buch aus dem Jahr 1981 sprechen. Es gilt bis heute als das wichtigste Werk des US-Amerikaners. Immerhin habe ich aber zwei noch ältere Romane aus der Zeit gelesen, in der Crowley noch Science Fiction schrieb, "Maschinensommer" und "Geschöpfe". Beide waren auf faszinierende Weise anders als die Romane seiner Zeitgenossen und ich kann sie nur empfehlen. Später wandte sich Crowley verstärkt historischen Themen zu und ich habe ihn aus den Augen verloren.
Geschichte ist auch ein zentrales Element in Crowleys jüngstem Roman; genau genommen müsste man wohl von historiografischer Metafiktion sprechen. "Ka" ist vieles – unter anderem auch ein Außenblick auf die Geschichte der Menschheit aus der Perspektive der Krähen. Der Bogen reicht dabei von der Eisenzeit bis in eine nahe Zukunft, die zugleich das Ende der Geschichte sein dürfte. Wenn darin von einem "Berg am Ende der Welt" die Rede ist, erkennen wir zunächst amüsiert, dass es sich dabei um die glorifizierende Bezeichnung einer Müllhalde handelt – um dann festzustellen, dass diese von "neuen Krankheiten" und Niedergang geprägte Welt der Menschen offenbar tatsächlich ihrem Ende entgegentaumelt.
Von Ka und Ymr
Der erste Abschnitt des Romans ist in einer eher diffusen europäischen Frühgeschichte angesiedelt: Der Anfang liest sich, als würde das Land erstmals von Menschen besiedelt, am Ende – noch in derselben Generation – marschieren bereits die Römer ein. In diesem Abschnitt lernen wir aber vor allem die Krähen-Gesellschaft kennen. Natürlich werden die Vögel – das ist bei Tiergeschichten dieser Art unvermeidlich – bis zu einem gewissen Grad vermenschlicht und vor allem intelligenter dargestellt, als sie sind. Doch gelingt es Crowley, auch unter Einbeziehung zoologischer Fakten, ein recht glaubhaftes Bild der Tiere zu zeichnen.
Crowleys Krähen machen sich gerne über andere lustig, sind neugierig und vor allem äußerst pragmatisch. Aus diesem Grund binden sie sich auch an die menschliche Gesellschaft: Deren Streitereien ebenso wie ihre Bestattungsrituale versorgen sie nämlich laufend mit frischem Aas. Für solche Wesen war es schwer zu begreifen, was die Menschen taten. Es schien ihnen, dass diese Leute den Tod liebten: Sie kümmerten sich um die Leichen und bemühten sich, mehr davon zu schaffen ... Vermeintlich naive Gesellschaftskommentare wie dieser würzen den ganzen Roman. Bis zum Schluss bleiben die Krähen eine spürbar andere Spezies als die Menschen, was sich auch in den Begriffen Ka und Ymr ausdrückt: Das sind nicht einfach die Namen für das Reich der Krähen und das der Menschen im Sinne getrennter geographischer Welten, sondern eher unterschiedliche Weltsichten und gedankliche Koordinatensysteme.
Unser gefiederter Führer durch die Zeit
In diesem Eröffnungsabschnitt lernen wir auch den zentralen Protagonisten kennen, das freigeistige Krähenmännchen Ka Eichling, das zum Innovator der Krähengesellschaft werden wird. "Aber warum machen wir es denn so?", flüsterte Eichling. "Wenn wir es nun anders machten, oder besser? Das ist ..." – "Das ist unser Schicksal", sagte Vater. [...] "Wir haben es so zu tun, und zwar genau auf diese Weise. Wir haben es immer so gemacht, und wir machen es weiter so." Irgendwie schwer, bei solchen Passagen nicht an Richard Bachs "Jonathan Livingston Seagull" zu denken. Seinen Namen erhält Eichling übrigens durch das kommunikative Zusammenspiel mit einer jungen menschlichen Schamanin – ein Ablauf, der sich in der Rahmenhandlung in besagter naher Zukunft wiederholen wird. Dann wird Eichlings Partner ein erkrankter Gelehrter sein, der zugleich der eigentliche Erzähler des Buchs ist.
Da Ka Eichling durch besondere Umstände die Unsterblichkeit erlangt bzw. mehrfach wiedergeboren wird, reisen wir mit ihm in den folgenden Abschnitten durch die Zeit. So freundet er sich im Mittelalter mit einem Mönch an, nimmt an der mythischen Seereise des Heiligen Brendan teil und gelangt schließlich nach Nordamerika, dessen Wandel von der Pionierzeit über den Bürgerkrieg bis in die Gegenwart ein sehr langes Kapitel beschreibt. Am Ende kehren wir wieder in die Zeitebene der Rahmenhandlung zurück.
Neben Ka und Ymr besuchen wir aber noch ein drittes Reich, nämlich das des Mythos (wo sich Eichling auch seine Unsterblichkeit abholt, um nicht zu sagen nach Krähenart stibitzt). Mehrfach besuchen wir die Unterwelt, seien es die Anderen Lande der eisenzeitlichen Europäer aus dem ersten Abschnitt, sei es die christliche Hölle. Nicht zu vergessen auch, dass das Wort "Ka" seinerseits eine mythologische Bedeutung hat, nämlich die den Tod überdauernde seelische Essenz eines Wesens. Oder dass Krähen die klassischen Totenvögel sind. Dazu klingen noch eine ganze Reihe von Mythen – ob Prometheus oder Orpheus und Eurydike – an; oft so subtil eingebaut, dass sie gar nicht namentlich genannt werden müssen und doch erkennbar bleiben. Von unzähligen literarischen Verweisen mit Krähen-Bezug ganz zu schweigen – der Roman hat auch eine stark assoziative Komponente.
Intellektuell erbaulich
Für meinen Geschmack – und es ist wirklich eine reine Geschmacksfrage – ist das alles ein bisschen gar viel. Die Geschichtsbetrachtung durch Außenstehende hätte mir schon gereicht, dazu kommen aber noch die Metaphysik, die zahllosen kulturgeschichtlichen Verweise, der Aspekt, wie sich Geschichte in Geschichten ausdrückt, und und und. Da stellt sich mir die Frage, ob etwas, das alle Geschichte(n) in sich vereint, selbst noch eine Geschichte sein kann.
Noch öfter als das Wort "Alterswerk" taucht in Rezensionen zu "Ka" das Wort "Meisterwerk" auf. Je nun. Ich würde "Ka" am ehesten als schönes Buch bezeichnen und hege den Verdacht, dass es in vielen Regalen neben "Der Name der Rose", "Schlafes Bruder", "Die Entdeckung der Welt" und wie sie alle heißen stehen wird. Alles fraglos meisterlich gemachte und intellektuell erbauliche Werke ... aber dafür bin ich irgendwie nicht das richtige Publikum. Andere können das sicher besser beurteilen, Geschmacksfrage wie gesagt.
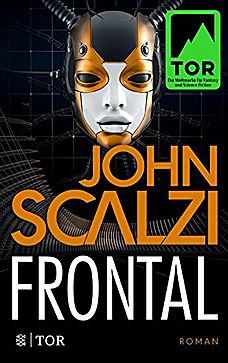
John Scalzi: "Frontal"
Klappenbroschur, 366 Seiten, € 15,50, Fischer Tor 2018 (Original: "Head On", 2018)
Während im englischsprachigen Raum gerade "The Consuming Fire", die Fortsetzung der Weltraumoper "The Collapsing Empire" ("Kollaps"), erschienen ist, bekommen deutschsprachige Leser zeitgleich die Übersetzung des SF-Krimis "Head On" serviert. Auch dessen Original trägt den Zeitstempel 2018. Der Millionendeal, den Scalzi 2015 mit Tor Books abschloss und der die Veröffentlichung von 13 Büchern innerhalb von zehn Jahren vorsah, hält den Schreibtakt also weiter hoch.
Auch "Frontal" ist übrigens ein Sequel, nämlich zum seinerzeit noch von Heyne übersetzten "Das Syndrom". Allerdings handelt es sich in diesem Fall um keine [Irgendwas]logie; sowohl "Syndrom" als auch "Frontal" sind jeweils für sich allein lesbar.
Das Erbe der Seuche
Zur Erinnerung: Die Handlung spielt sich in einer relativ nahen Zukunft ab, die eine Seuche hinter sich gebracht hat. Ein Prozent der Bevölkerung hat durch das sogenannte Haden-Syndrom allerdings gravierende Dauerschäden davongetragen. "Hadens" sind gewissermaßen in ihrem Körper eingesperrt – sie sind wach, können aber ihre Körperfunktionen nicht steuern. Zum Ausgleich hat man ihnen neuronale Netze implantiert: So können sie sich zum einen via Avatar in der virtuellen Welt der Agora versammeln, zum anderen können sie damit Androidenkörper fernsteuern und somit auch am Leben in der realen Welt wieder teilhaben.
Der Name dieser Kunstkörper ist eine der besten Ideen des Szenarios: Threeps, was von C-3PO kommt. Gut vorstellbar, dass sich eine derartige inoffizielle Bezeichnung tatsächlich durchsetzen würde. Denken wir nur an unser für Englisch-Muttersprachler mysteriöses "Handy", das auch in anderen Sprachen unter Spitznamen läuft – süß etwa das "telefonino" in Italien oder "nalle" in Schweden, was wörtlich eigentlich Teddybär bedeutet ...
Das Grundkonzept wird von Scalzi in seinen möglichen Auswirkungen konsequent weitergedacht. Dazu gehören nicht nur Begleiterscheinungen wie Tele-Sex oder das Porten (also blitzschnelles Reisen, indem man ganz einfach einen am Zielort bereitgestellten Threep "beseelt"). Auch auf die vermeintlich banaleren Aspekte vergisst Scalzi nicht. So braucht es im Alltag eine eigene Auflade-Infrastruktur für Threeps analog zu Elektro-Autos, die aber nicht gerade flächendeckend ist, was den Helden von "Frontal" in einem Kapitel vor eine ziemliche Herausforderung stellt. Und natürlich verschlingt diese Infrastruktur Geld – der Vorgängerband schilderte, wie in der Politik langsam die Bereitschaft schwindet, den Hadens weiterhin solche Summen zu "opfern".
Zur Handlung
"Frontal" dreht sich um einen der wenigen gesellschaftlichen Bereiche, in denen Hadens im Vorteil sind: Hilketa ist ein superbrutaler Mannschaftssport im Stil von Rollerball – ausgetragen freilich von Threeps und damit aller Hemmungen enthoben. In jeder Spielrunde gilt es, den Kopf eines zufällig ausgewählten Teammitglieds der gegnerischen Mannschaft mit Hämmern und Schwertern abzutrennen und dann ins Tor zu befördern ...
Trotz neuronalen Feedbacks besteht für den Spieler eigentlich keine Gefahr – als einer mit der Zerstörung seines Threeps aber tatsächlich stirbt, muss wieder FBI-Agent Chris Shane aktiv werden, der schon in "Das Syndrom" die Hauptfigur war. Unterstützt wird er auch diesmal wieder von seiner Partnerin Leslie Vann, der weiblichen Ausgabe eines bissigen, zerknitterten Hardboiled-Ermittlers klassischer Prägung. Nachdem sich kurz nach dem Tod des Spielers auch noch ein Sportfunktionär erhängt, zieht der Fall rasch immer weitere Kreise. Chris und Leslie werden alle Hände voll damit zu tun haben, das Geflecht aus Korruption, Doping, Geldwäsche und nicht zu vergessen Ehebruch zu entwirren, das rings um die nordamerikanische Hilketa-Liga gewachsen ist wie ein parasitischer Pilz.
Der neue Burgerbrater
Wie schon zuvor gesagt, hat John Scalzi einen beträchtlichen Veröffentlichungstakt. Dass er den bisher einhalten kann, liegt auch an seinem ökonomischen Erzählstil. Hier wurde keine Zeit darauf verschwendet, eine eigene epische Sprache auszutüfteln – Scalzi schreibt wie er bloggt wie er spricht, die Tonlage ist munter. Über weite Strecken wird die Handlung zudem von Dialogen getragen (man sollte Scalzi nicht lesen, wenn man auf hohe Konzentrationen des Wortes "sagte" allergisch reagiert). Das erinnert durchaus an SF-Produktionen im Fernsehen, die ihr überschaubares Budget für CGI mit erhöhtem Sprechanteil kompensieren müssen. Allerdings sind die Drehbuchautoren solcher TV-Filme in der Regel mies – Scalzis Dialoge haben wenigstens Witz.
Stephen King tätigte in einem Interview in der Frühphase seiner Karriere einen unvorsichtigen Satz, der ihn über Jahre hinaus verfolgen sollte: Nämlich dass er das literarische Äquivalent eines Big Mac mit Pommes schreiben würde. Das hat sich erledigt, nachdem er im Lauf der folgenden Jahrzehnte sukzessive zum allseits anerkannten Orakel des amerikanischen Unterbewusstseins erhoben wurde. Nun, da King im Olymp residiert, ist seine alte Nische vakant und ich würde sie an John Scalzi weiterreichen: Er liefert SF-Burger. Schnell produziert, schnell konsumiert, sättigend und – nicht immer, aber in Fällen wie diesem hier – auch schmackhaft.

Yoav Blum: "Als der Zufall sich verliebte"
Gebundene Ausgabe, 336 Seiten, € 20,60, Pendo 2018 (Original: "Metsarfe ha-mikrim", 2011)
Cixin Liu: "Die wandernde Erde"
Broschiert, 688 Seiten, € 15,50, Heyne 2018
Na, schau sich einer die Rundschau an. Normalerweise ein Hort der Nüchternheit, hat sich in diese Ausgabe die Romantik gleich zweimal eingeschlichen: Nach Ian McDonalds "Time Was" nun auch noch "Als der Zufall sich verliebte" von Yoav Blum aus Israel. Der Roman wurde hier schon anlässlich seiner ebenfalls heuer erschienenen englischsprachigen Übersetzung besprochen ("The Coincidence Makers"). Inzwischen liegt er auch auf Deutsch vor und bringt ein bisschen Wohlgefühl in die graue Jahreszeit.
Schmetterlingseffekt im Bauch
Die Schmetterlinge am Cover kommen nicht von ungefähr. Wir alle kennen ja das längst abgelutschte Standard-Beispiel für die Chaostheorie: nämlich den Schmetterling, dessen Flügelschlag anderswo auf der Welt einen Wirbelsturm auslöst. Blum nimmt das wörtlich: Zu den Aufgaben seiner Romanhelden gehört es unter anderem, gegebenenfalls ins Flugzeug zu steigen, um auf einem anderen Kontinent genau den richtigen Schmetterling zum Flattern zu überreden ...
Das Ergebnis soll freilich kein zerstörerischer Orkan, sondern eine Brise mit segensreichen Konsequenzen sein. Denn die geheimnisvolle Organisation, die in Blums Mystery-Roman ihre Zufallsstifter in den Einsatz schickt, hat sich zum Ziel gesetzt, dem Glück der Menschen ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. So werden mit höchster Akribie Kausalketten in Gang gesetzt, die erst am Ende des Romans ihren Zweck erkennen lassen – eine in jeder Beziehung liebevolle Konstruktion.
Liu für Liebhaber
Ja, und Neues von Cixin Liu gibt's auch bald wieder. Der ist eine zu große Nummer, um das Erscheinen des Storybands "Die wandernde Erde" mit insgesamt elf Erzählungen unerwähnt zu lassen (Veröffentlichungsdatum: 10. Dezember, Fans bitte vormerken). Aber ganz ehrlich: Mit dem eher durchschnittlichen "Spiegel" und dem unsäglichen "Weltenzerstörer" habe ich inzwischen zwei Beispiele für Cixin Lius Erzählkunst im Kurzformat gelesen und sehe mich nicht unbedingt veranlasst, mir 700 weitere Seiten davon zu Gemüte zu führen. Positive Erfahrungsberichte von Rundschau-Lesern können aber gerne hier gepostet werden!
Und es ist ja nicht so, als gäbe es nicht genug Alternativen – im Gegenteil, ich fürchte, ich werde mal wieder ganze Buchstapel mit ins neue Jahr schleppen. In der letzten Rundschau-Ausgabe für heuer lassen sich aber wenigstens noch ein paar Titel unterbringen. Der Rundschau-Buchclub könnte für etwaige Diskussionsrunden unter anderem Paolo Bacigalupis "Tool" und Ryan Norths Leitfaden für Zeitreisende "How to Invent Everything" in Angriff nehmen. (Josefson, 17. 11. 2018)
________________________________
Weitere Titel
Überblick über sämtliche bisher rezensierten Bücher