
Dennis E. Taylor: "Wir sind Götter (Bobiverse 2)"
Broschiert, 448 Seiten, € 15,50, Heyne 2018 (Original: "For We Are Many", 2017)
Wir beginnen mit einem klassischen SF-Motiv: Eine interstellare Spezies unterstützt die Menschheit dabei, die sterbende Erde zu verlassen und sich auf andere Welten auszubreiten. So weit, so vertraut. Die Mentoren-Spezies in dieser Romanreihe jedoch, die Bobs, kam nicht aus den Weiten der Milchstraße, sondern von einer Science-Fiction-Convention.
Das Bobiverse
Im Vorgängerband "Ich bin viele" schilderte der blitzartig vom Newcomer zum Erfolgsautor aufgestiegene Dennis E. Taylor, wie Bob Johansson, ein Nerd unserer Tage, nach seinem Unfalltod kryokonserviert wird und in der Zukunft aufwacht. Zwar nur als digitale Bewusstseinskopie ohne Körper, aber man kann halt nicht alles haben. Nach diversen Wirrungen wird Bob als Quasi-KI in eine Von-Neumann-Sonde gesteckt und hinaus ins All geschickt. Sein Gefährt kann sich – wie es Von-Neumann-Sonden nun mal tun – replizieren, und mit jeder neuen Ausgabe wird auch eine weitere Kopie von Bob geboren. Diese breiten sich nun in unserer näheren galaktischen Nachbarschaft aus und werden zu Hütern nicht nur der Menschheit, sondern auch einiger anderer bedrohter Zivilisationen.
Band 2 setzt nahtlos am bisher Geschehenen an und schildert die Ereignisse der Jahre 2167 bis 2221 – immerhin gilt es interstellare Distanzen zu überbrücken und Mega-Projekte durchzuführen, das dauert seine Zeit. Umso schneller ist hier dafür der Wechsel zwischen den Kapiteln respektive den diversen Bobs (die sich zwecks Unterscheidbarkeit verschiedene Namen geben). Durch dieses rasante Herumhüpfen wird "Wir sind Götter" niemals zäh, obwohl es das gefürchtete "Middle Book" einer Trilogie ist und sich auch tatsächlich an die Vorgaben für ein solches hält. Soll heißen: Die Handlung von Band 1 wird einfach ein Stückchen ausgebaut und hie und da mit einer Weichenstellung für die großen Entscheidungen versehen, die dann aber erst in Band 3 folgen werden.
Auf allen Bühnen
Eine Menge Bobs werden die diversen Kapitel bestreiten, wobei dreien besondere Bedeutung zukommt. Etwa Riker, der die Evakuierung der Erde leitet, was mitunter ordentlich an seinen digitalen Nerven zehrt. Es gibt zwar nur noch 15 Millionen Menschen, aber die sind so zerstritten wie eh und je. Richtig haarig wird's allerdings erst, als unbekannte Terroristen Rikers Bemühungen zu sabotieren beginnen – da kann selbst jemandem, der mit der grundsätzlichen Gutmütigkeit aller Bobs ausgestattet ist, der Pazifismus vergehen.
Ein anderer Bob, Howard, sitzt gewissermaßen auf der Abnehmerseite: Er leitet die Terraformierung des Planeten Vulkan, auf den die Emigranten der Erde verschifft werden, und bekommt es dort mit allerlei dinosaurierartigem Getier zu tun. Und die Originalausgabe, Bob-1, wacht immer noch über die Welt Eden, deren steinzeitliche Bewohner dank Bob haarscharf an der Auslöschung vorbeikamen. Diese Handlungsebene ist eigentlich die irrelevanteste, abgesehen von einem Aspekt: Bob wird von den Einheimischen als Himmelsgott wahrgenommen (und nicht unbedingt geliebt), was ihn allmählich dazu veranlasst, seine Rolle zu hinterfragen.
Hier zeichnet sich eine der zuvor angesprochenen Weichenstellungen ab, eine Kluft zwischen körperlichen und künstlichen Existenzen. Bob missfällt auch, dass einige seiner jüngeren Kopien sich angewöhnt haben, Menschen und andere organische Lebensformen als Kurzlebige zu bezeichnen. Die Spezies Bob läuft Gefahr, ein bisschen die Bodenhaftung zu verlieren.
Die bösen Anderen
Die offensichtlichere Weichenstellung ist freilich, dass ein weiterer Bob auf Welten stößt, die aussehen, als wäre eine Harvester Queen aus "Independence Day" durchgezogen. Nachdem die "Bobiverse"-Reihe ja nicht zuletzt ein Rundgang durch den Themenpark der Science Fiction ist, kommt nach Zeitreise, drohendem Weltuntergang, Space Opera und Kolonisierung anderer Planeten jetzt auch noch das fast schon überfällige Motiv vom galaktischen Krieg ins Spiel. Denn die Anderen, die ganze Welten verwüsten und deren Bewohner massakrieren, müssen um jeden Preis aufgehalten werden. Obwohl Howard auf Vulkan und Bob auf Eden auch nicht gerade zimperlich sind, was die Auslöschung "schädlicher" Tierarten oder gar ganzer Ökosysteme betrifft, wenn man's genau betrachtet ...
"Wir sind Götter" hat in Sachen Weltraumschlachten schon einiges zu bieten. Auch wenn der ganz große Showdown erst im Abschlussband "Alle diese Welten" kommen wird, der im Juni 2019 erscheint. Bis dahin wird auf den virtuellen Versammlungen der Bobs sicher weiterhin jede Menge gescherzt, gelacht und auf "Star Trek" angespielt werden. Denn so todernst die Probleme auch sind, mit denen sie sich herumschlagen müssen – sie bleiben doch Bob(s). Und ohne den charmanten Optimismus Bobs und dessen ganz spezielle Mischung aus Kindsköpfigkeit und Verantwortungsgefühl wären Taylors Bücher nie so erfolgreich geworden, wie sie sind. Bob mag man eben.

Yoss: "Condomnauts"
Broschiert, 208 Seiten, Restless Books 2018, Sprache: Englisch (Original: "Condonautas", 2013)
Gay for pay war gestern, Josué Valdés ist pansexuell für den Profit. Er arbeitet als Contact Specialist (inoffizieller Ausdruck: Condomnaut) in einer Galaxis, in der die Gepflogenheit herrscht, Erstkontakte zwischen verschiedenen Spezies, aber auch ganz alltägliche Geschäftsabschlüsse mit einer Runde Sex zu besiegeln. Selbst wenn das bedeutet, dass Josué als Quasi-Spermium einem 500 Meter langen außerirdischen "Wal" in die Kloake kriechen muss ...
Eine schrillere Prämisse für eine Space Opera kann man sich kaum ausmalen. Umso mehr ist hier eine Vorwarnung in beide Richtungen angebracht: Allzuviel Einschlägiges braucht man hier weder erhoffen noch fürchten. Weiter hinten in der Rundschau wird ein vollkommen durchschnittliches Fantasy-Buch kommen, in dem der Sex deutlich expliziter geschildert wird als hier. Kurios. Der Autor von "Condomnauts" blendet jedenfalls stets keusch weg, wenn's zur Sache ginge – fast wie in den alten Zeiten von Hollywood.
Yoss und seine Welt
Yoss ist der Künstlername von José Miguel Sánchez Gómez, einem Autor aus Kuba, der vor ein paar Jahren von der englischsprachigen Welt entdeckt wurde und mit punkig hingerotzten Werken wie "A Planet for Rent" oder "Super Extra Grande" zu Übersetzungsehren kam. Seine Selbstinszenierung als unangepasster Rocker – er sieht aus, als hätte Glenn Danzig einen der Ramones befruchtet – hat der Vermarktung sicher auch nicht geschadet.
Und apropos Vermarktung: Die ist in Yoss' Romanwelt das oberste Gebot für every known intelligent species (a tasteful way to say: any species with commercial ambitions). Und davon gibt es zehntausende, entsprechend voll ist die Galaxis. Nur mit Müh und Not konnte sich die Menschheit ein paar Kolonialplaneten leisten – oder wenigstens leere Sternsysteme, in denen man Weltraumhabitate platzieren durfte. Eines davon ist die von Katalanen besiedelte 500-Kilometer-Raumstation Nu Barsa, in deren Auftrag Kondomnaut Josué arbeitet.
Triebe und Triebwerke
Zusammengehalten wird die galaktische Meta-Zivilisation nur von den Hypersprungtriebwerken, die eine längst verschwundene Altvorderen-Spezies entwickelt haben soll. Dieselbe übrigens, die das bis heute gültige Protokoll für obligatorischen Sex etabliert hat. Die nomadischen Qhigarians geben sich zur Romanzeit als Nachlassverwalter dieses mythischen Urvolks und verteilen die Sprungtriebwerke an neue Kunden – mal für Wucherpreise, mal für 'n Appel und 'n Ei. Die Menschheit beispielsweise fand Anschluss an die galaktische Gemeinschaft im Austausch für ein Wörterbuch und eine Katze (plus natürlich eine Runde Sex): Es sind Details wie dieses, die klarmachen, warum Yoss unter anderem Douglas Adams zu seinen Vorbildern zählt.
Der durchaus überschaubare Plot des Romans beruht im Wesentlichen darauf, dass ein lange herbeigesehntes Ereignis eingetreten sein dürfte: Besucher aus einer anderen Galaxis sollen eingetroffen sein. Die müssten ein eigenes Hypersprungtriebwerk haben, und diese Alternative zum Produkt der Qhigarians wäre natürlich die Business-Gelegenheit des Jahrtausends. Kein Wunder also, dass ein gewaltiger Run auf die Besucher einsetzt und die Galaktiker einander auszustechen versuchen. Wobei die schärfste Konkurrenz für Josué & Co allerdings von anderen Crews aus Nu Barsa kommt – so ganz plausibel wird einem das beim Lesen nicht, und mitunter verhalten sich die zerstrittenen Protagonisten in einem Ausmaß unlogisch, das an Idiotie grenzt. Womit wir auch schon bei den Stärken und Schwächen des Romans wären.
Plus ...
Zu den Stärken von "Condomnauts" zählt neben der originellen Grundidee die lockere Verknüpfung des Unterhaltsamen mit dem Gesellschaftskritischen. Josué arbeitet zwar für die reichen Katalanen, stammt aber eigentlich aus einem Ghetto im verstrahlten Kuba. In Rubble City müssen Kinder ab fünf für sich selbst sorgen, was entweder auf Prostitution oder Kriminalität hinausläuft. Sofern man nicht ohnehin auf dem Tisch eines Organhändlers landet.
Ohne Reue oder Heischen um Mitleid lässt Josué in einigen Rückblicken eine Nicht-Kindheit Revue passieren, deren einziges Highlight die regelmäßig abgehaltenen Kakerlaken-Wettrennen waren. Dass die am Ende noch eine Rolle spielen werden, ist übrigens ebenfalls eine Stärke des Romans: Von Josués Vergangenheit über die Sprungtriebwerke bis zum Sex-Ritual werden all die disparaten Motive noch zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Gute Konstruktion.
... und minus
Auf der Minusseite sammelt sich allerdings auch so einiges an. "Condomnauts" wirkt wie eine Beweisführung für den alten Spruch, dass der am wenigsten Sex hat, der am meisten darüber redet: Nichts Explizites geschieht, dafür quasseln Josué und seine Crewmitglieder ohne Unterlass darüber, wer mit wem wie oft und so weiter ... Mit dem ganzen Bettgeschichten-Gelaber ist "Condomnauts" stellenweise nicht weit von Becky-Chambers-Land entfernt.
Nur dass Yoss im Political-Correctness-Seminar, das die Chambers mit Sternchen im Heftchen bestanden hat, sicher mit Pauken und Trompeten durchgefallen ist und prompt ins andere Extrem verfällt. Plumpe nationale Klischees über Katalanen wechseln sich mit noch plumperen über andere ab; seinen deutschstämmigen Konkurrenten Jürgen Schmodt etwa bezeichnet Josué, der im Grunde ein ziemliches Arschloch ist, grundsätzlich als Nazi. Und die Idee, dass Josué eigentlich heterosexuell wäre, durch ein traumatisches Beischlaferlebnis aber schwul wurde, ist auch reichlich ... nun ja. "Nazikrautcyborg" Schmodt rächt sich dafür mit dem herrlich danebenen Kauderwelsch, das immer dann entsteht, wenn ein Autor glaubt, er muss nur kurz in ein Wörterbuch schauen, um eine Fremdsprachenpassage einbauen zu können: "Nein obligation to respect order of Llul, meine Fräulein. Krieg if you mogeln."
Alles in allem erinnert mich "Condomnauts" an meine aktuelle italienische Lieblingsband Baustelle: Die schaffen es, im einen Moment einen Ultraohrwurm zu produzieren, im nächsten ein vergessenswert banales Liedl und gleich danach etwas, bei dem man sich fragt: Was zum Teufel war das denn gerade? Und manchmal all das zusammen in einem einzigen Song. Pop-Art an der Grenze zwischen Genie und Plakativität – ganz so wie Yoss' Variante von Science Fiction.

Paolo Bacigalupi: "Tool"
Broschiert, 382 Seiten, € 10,30, Heyne 2018 (Original: "Tool of War", 2017)
Scheinwerfer an und auf jemanden ausgerichtet, der zweimal eine Nebenrolle spielte und nun endlich selbst die Mitte der Bühne betreten darf: Tool, bekannt aus "Schiffsdiebe" und "Versunkene Städte". Damit kommt Star-Autor Paolo Bacigalupi einem vielfachen Leserwunsch nach, denn Tool hat sich zu einer der beliebtesten Figuren seiner mehrere Romane umfassenden Zukunftswelt nach dem Zeitalter der Beschleunigung gemausert. Offenbar braucht diese unmenschliche Welt so unwahrscheinliche Helden wie ihn.
I Am War
Zur Erinnerung: Tool ist ein sogenanntes Konstrukt, eine genetische Chimäre aus der DNA von Menschen und verschiedenen Raubtierspezies. Zweieinhalb Meter hoch, furchterregend kampfstark und nahezu unverwüstlich – dazu aber auch noch mit Supersinnen, hohem IQ und strategischer Brillanz ausgestattet. Kurz: Er ist eine lebende Superwaffe und gewissermaßen die Verkörperung des Krieges selbst. Niemand ist im Krieg so zuhause wie er, wie uns diese Passage schön vor Augen führt:
Tool lauschte mit gespitzten Ohren auf die fernen Schüsse, das ungezwungene Geplauder der Versunkenen Städte. Es war eine polyglotte Sprache, doch Tool verstand alle Stimmen. Die scharfen Ausrufe von AK-47- und M-16-Sturmgewehren. Das primitive Gebrüll der Kanonen Kaliber 12 und 10. Das gebieterische Knallen der Jagdgewehre Kaliber 30-06 und das Ploppen der .22er. Und natürlich auch das sich nähernde Schrillen der 999er, die Stimme, die alle Sätze mit ihrer dröhnenden Interpunktion abschloss.
Die Kontrahenten
Zu Beginn des Romans hat Tool gerade mit seiner Armee von Kindersoldaten den Großraum Washington unter seine Kontrolle gebracht. In einer Zukunft, in der globale Konzerne das Sagen haben, sind die USA zerfallen, die Ostküste wurde von Überflutungen ebenso wie von endlosen Bürgerkriegen verwüstet. Nachdem Tool endlich alle anderen Warlords der Region ausgeschaltet hat, besteht für einen kurzen Moment die Hoffnung auf Frieden. Doch noch im Augenblick des Triumphs wird sie durch einen Raketenangriff der Mercier Corporation schon wieder zunichtegemacht.
Der skrupellose Konzern gebärdet sich als Weltpolizist in eigener Sache, bombardiert mit seiner Luftschiffflotte militärische ebenso wie zivile Ziele und nimmt keinerlei Rücksicht auf Kollateralschäden. Als starker Arm von Mercier agiert General Caroa, der den Angriff von seinem Flaggschiff "Annapurna" aus geführt hat: einem gigantischen Luftschiff mit 5.000 Mann Besatzung, gewissermaßen dem Todesstern einer Welt, die ohne fossile Brennstoffe auskommen muss.
Der lange, blutige Weg zur Freiheit
Nur mit Mühe und körperlich schwer gezeichnet kann Tool dem Angriff entkommen. Er flüchtet sich nach Seascape, gewissermaßen das Boston 2.0 des Zeitalters nach dem Meeresspiegelanstieg. Es ist ein friedlicher Ort – was für Tool ebenso unnatürlich ist wie der Status als Flüchtling. Doch der wird auch nicht lange anhalten: Tool beginnt seine Rachepläne gegen die Mercier Corporation in Angriff zu nehmen. Im Zuge dessen werden wir endlich seine Vergangenheit erfahren, lernen, was ihn mit Mercier und insbesondere General Caroa verbindet – und welche Eigenschaft neben den bereits genannten von Caroa für so gefährlich gehalten wird, dass er Tool um jeden Preis ausschalten möchte. Denn tatsächlich verfügt Tool über ein Talent, die ihn zum vielleicht gefährlichsten Wesen auf dem Planeten macht; gefährlich zumindest für den Status quo.
Aussehen, Wesen und nicht zuletzt der Umstand, dass er eine Armee aus Kindersoldaten führt, scheinen Tool für die Rolle eines Monsters zu prädestinieren. Doch weit gefehlt: Wir erhalten Eindrücke in einen komplexen Charakter, der gängigen Schemata widerspricht. Tool versucht den Menschen zu helfen, zugleich muss er seine Verachtung für ihre Schwäche unterdrücken. Noch mehr verachtet er sich selbst dafür, dass in ihm immer noch der genetisch verankerte Gehorsam wirkt – immer wieder muss er den Impuls unterdrücken, sich vor seinen verhassten Herren bzw. Konstrukteuren wie ein braver Hund auf den Rücken zu rollen.
Konstrukte (also Tools "Artgenossen"), die dieser Konditionierung uneingeschränkt folgen, verachtet er natürlich auch – zugleich beneidet er sie dafür, dass sie in dem guten Gefühl leben dürfen, ihren Herren zu dienen. Es ist ein Psychogramm mit ebenso vielen Narben und Wunden wie Tools Körper. "Ich bin kein Opfer", lautet Tools Mantra – in einem Roman, der sich letztlich um das Thema Sklaverei dreht und den unendlich mühsamen Weg zur Freiheit beschreibt.
Ein Universum, das den Besuch lohnt
Seit dem fantastischen "The Windup Girl" ("Biokrieg") hat Paolo Bacigalupi in Romanen und Kurzgeschichten immer wieder seine hässliche neue Welt der geschwundenen Ressourcen besucht. Diese Erzählungen werden im Allgemeinen in zwei Gruppen eingeteilt: die "für Erwachsene" wie "Windup Girl" und solche, die unter Young Adult laufen wie "Schiffsdiebe", "Versunkene Städte" und jetzt "Tool". YA bedeutet in Bacigalupis Fall, dass er es sprachlich ein wenig einfacher hält und die Komplexität seiner Welt ein kleines Stück zurückfährt. Zudem sind Gut und Böse leichter voneinander zu unterscheiden. YA steht hier aber definitiv nicht für Schönzeichnung: Grausamkeit in jeder Beziehung und Brutalität bis hin zu Gore werden den Lesern von "Tool" keineswegs erspart.
Zugleich bietet der Roman ein Wiedersehen mit den Hauptfiguren der beiden vorangegangenen Romane, Mahlia und Ocho aus "Versunkene Städte" sowie Nailer und Nita aus "Schiffsdiebe" – die diesmal aber nur als hilfreiche Nebenfiguren auftreten, wie es Tool einst in "ihren" Romanen tat. Dieses Wiederaufgreifen verstärkt den Eindruck, dass hier etwas zu Ende gebracht wird. Der Kreis schließt sich – ohne dass man deswegen von einer Trilogie sprechen könnte, da jeder der Romane für sich selbst steht. Und wenn es keine Trilogie ist ... dann könnten in Zukunft auch noch weitere Romane im Stil dieser drei erscheinen: gerne jederzeit.
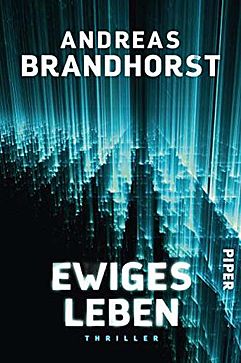
Andreas Brandhorst: "Ewiges Leben"
Klappenbroschur, 700 Seiten, € 17,50, Piper 2018
Manchmal kommt ein Buch genau im richtigen Moment daher: Gerade erst hat der chinesische Forscher He Jiankui die Welt mit der Information überrumpelt, dass er menschliche Embryonen mit der Gen-Schere CRISPR/Cas9 behandelt hat, um sie vor HIV-Infektionen zu schützen – das Tabu der gentechnischen Veränderung von Menschen ist somit gebrochen. In Andreas Brandhorsts jüngstem Roman ist die Entwicklung längst ein paar Schritte weiter. Hier setzt der Konzern Futuria die Gen-Schere routinemäßig ein und hat die Welt damit vom Großteil vormals tödlicher Krankheiten befreit. Doch schon wird der nächste Schritt auf dem Weg der optimierten Menschheit anvisiert: die Unsterblichkeit.
Wir schieben hinaus, was uns wichtig ist, weil wir vorher andere Dinge erledigen müssen und glauben, genug Zeit zu haben. Aber die Zeit genügt nicht, sie genügt nie. Der melancholische Prolog des Romans schildert, wie der Molekularbiologe Pascal Salomon Leclerq seinem Vater die erbetene Sterbehilfe leistet. Es ist der entscheidende Wendepunkt in seinem Leben: Mit dem geerbten Geld treibt er seine Forschungen voran, gründet Futuria und hat schließlich Erfolg.
Die Personen des Geschehens
20 Jahre später – es fällt nie ein Datum, es können aber frühestens die 2030er Jahre sein – ist Futuria längst zum Global Player aufgestiegen. Die Journalistin Sophia Marchetti erhält vom Konzern den Auftrag, zum Gründungsjubiläum eine Reihe von Berichten zu produzieren. Motiviert ist sie nicht nur wegen des Geldes – Sophia leidet an einer schweren Knochenmarkserkrankung und hat es allein den Therapien von Futuria zu verdanken, dass sie noch lebt. Und dennoch: Als sie mit ihrem Recherchepartner Borris die Arbeit aufnimmt, stößt sie bald auf einen Wust von Geheimnissen, die Futuria vor der Welt verbirgt. Informationen erhält sie unter anderem von dem mysteriösen Casper, der auf die Journalistin aufmerksam geworden ist.
Als Antagonisten präsentiert uns Brandhorst den religiösen Spinner Jossul, der glaubt, Sünden riechen zu können, und mit den Cherubim ein globales Terror-Netzwerk aufgebaut hat – als nächstes wird ein Anschlag auf den innovationsfreundlichen Papst geplant. Für eine klassische Schurkenfigur wird Jossul überraschend komplex geschildert. Wir dürfen nicht nur an seinem Innenleben teilhaben, wir müssen uns im Lauf des Romans auch die immer dringlicher werdende Frage stellen, welche Rolle Jossul eigentlich spielt. Er hat eine Reihe von Mordanschlägen auf dem Gewissen, hegt aber langsam den Verdacht, dass er in der Auswahl seiner Ziele manipuliert worden ist. Doch wer sollte einen religiösen Fundamentalisten instrumentalisieren? Und zu welchem Zweck?
Als letzter Protagonist sei noch Pius XIII. genannt. Yep, hier spielt der Papst höchstselbst eine entscheidende Rolle – und er macht dabei gar keine schlechte Figur.
Komplexes Puzzle
"Ewiges Lesen", pardon: "Ewiges Leben" hat das typische Brandhorst-Volumen, darunter macht er's einfach nicht. Allerdings muss man sagen, dass es hier durchaus angemessen wirkt; ich konnte keine wirklichen Füller-Kapitel identifizieren. Spannend ist der Roman nicht deshalb, weil über 700 Seiten einfach dahingeactiont wird, sondern weil sich von Beginn weg jede Menge Rätsel auftun, und die werden im Lauf der Kapitel eher mehr als weniger.
Da ist zum Beispiel die Frage, warum man Futuria-Gründer Leclerq seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Oder der Verdacht, ob die für die Zukunft verheißene Unsterblichkeit nicht schon längst für einige Auserwählte verwirklicht worden ist. Sophia erfährt von ominösen Menagerien und einem noch ominöseren Projekt M, die von Futuria betrieben werden sollen. Und nicht zuletzt ist da noch eine Eden genannte virtuelle Welt von noch nie dagewesener Realitätsnähe, in die Futuria massive Ressourcen investiert. Zusammen mit der bunten Mischung an Protagonisten, die ihrerseits einige Geheimnisse mit sich bringen, ergibt das ein multifaktorielles Puzzle, das den Umfang des Buchs problemlos trägt.
Die richtige zeitliche Mischung
Erwähnt sei auch noch, dass Brandhorst für "Ewiges Leben" ein ausgesprochen günstiges Setting gewählt hat. Der Roman ist gerade so weit in der Zukunft angesiedelt, dass man sich nicht erst ein fremdartiges Worldbuilding samt all seinen Namen und Begriffen erarbeiten muss (anders als bei Brandhorsts Space Operas gibt es daher auch kein angehängtes Glossar). Wir befinden uns in einer Welt, die uns vertraut ist und die unter uns vertrauten Problemen leidet – sie sind lediglich ein Stück weiter vorangeschritten. Als Gradmesser dient im Roman übrigens der Klimawandel.
Aber es ist eben nicht ganz die Gegenwart. Was bedeutet, dass "Ewiges Leben" kein Wissenschaftsthriller, sondern Science Fiction ist. Und das kann nicht zu unterschätzende Auswirkungen auf die Handlung und damit einhergehend den Spannungsfaktor haben. Wissenschaftsthriller neigen stark dazu, dass das mühsam aufgebaute Szenario von Innovation/Revolution/Bedrohung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Ende abgewendet wird und die Welt schön brav die alte bleiben darf. Ist ein bisschen so wie bei Krimis, in denen am Schluss zur allgemeinen Beruhigung der Täter gefasst wird. Bei Science Fiction kann man sich nie so sicher sein, wie's ausgehen wird – und so bleibt "Ewiges Leben" spannend bis zum Schluss.
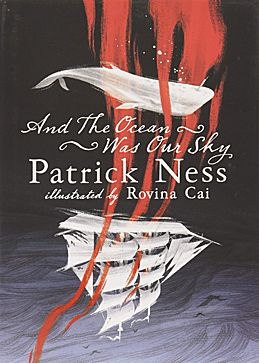
Patrick Ness: "And the Ocean Was Our Sky"
Gebundene Ausgabe, 158 Seiten, Walker Books 2018, Sprache: Englisch
Ich geb es zu, ich habe eine ausgemachte Schwäche für "Moby Dick". Darum ist Herman Melvilles Jahrhundertroman auch schon auf unterschiedlichste Weise in die Rundschau eingeflossen: als True Story hinter dem Epos ("Im Herzen der See" von Nathaniel Philbrick), als phantasmagorische Science-Fantasy-Version ("Das Gleismeer" von China Miéville) oder als gerade noch erkennbares Motiv ("Faith" von John Love). Fehlt eigentlich nur noch die simple Umkehrung: Wale machen Jagd auf Menschen, mit Schiffen, Harpunen und allem Drum und Dran. Das liefert uns nun Patrick Ness, und das Ergebnis ist trotz der plakativen Prämisse alles andere als lächerlich.
Tauchen wir ab – oder auf – in eine andere Welt
Ob ferne Zukunft, alternativer Geschichtsverlauf oder eine andere Erklärung, spielt angesichts des allegorischen Charakters von "And the Ocean Was Our Sky" keine Rolle. Auf jeden Fall befinden wir uns in einer Welt, in der Menschen und Pottwale seit Jahrtausenden aufeinander Jagd machen, ihre Beute dutzendweise abschlachten und die Kadaverteile den verschiedensten Verwendungszwecken zuführen – von Notwendigkeiten bis zu eitlem Luxus. Den Segelschiffen der Menschen setzen die Wale ihre eigene Technologie entgegen, eine wilde Mischung aus im Meer versunkenen Erzeugnissen der Menschen und der waleigenen Biotech in Form von symbiotischen Spezies. Eine ihrer wichtigsten Errungenschaften ist die breather bubble, die die verhasste Notwendigkeit, an die Meeresoberfläche aufzutauchen, stark reduziert hat.
... beziehungsweise an die Oberfläche "abzutauchen", wie es hier heißt. Denn die Wale leben in einer umgekehrten Welt: Die Zone der Luft nennen sie den Abgrund (the Abyss), nach oben bedeutet für sie, in Richtung der tiefen Meeresschichten zu tauchen, wo ihre schwimmenden Städte sind. Es dauert ein bisschen, bis man begriffen hat, was es bedeutet, wenn hier von zwei Welten mit entgegengesetzter Gravitation die Rede ist – inklusive der zwangsläufigen Folgerung, dass die Wale offenbar auf dem Rücken schwimmen. Mehr als alles andere ist es eine Metapher für ihre Autonomie: Sie lassen sich nicht von den Menschen definieren, welchem Koordinatensystem die Welt folgt. Zugleich spiegelt es die Umkehrung wider, die die Handlung des Romans bestimmt.
Call me Bathsheba ...
Hauptfigur von "And the Ocean Was Our Sky" ist das junge Pottwalweibchen Bathsheba, das zum Jagdtrupp der Menschenfänger-Veteranin Captain Alexandra gehört. Sie wird rasch feststellen, dass diese Alexandra eine Getriebene ist: Wie Melvilles Ahab wurde sie einst in einem Gefecht schwer verwundet und hat ihrem Widersacher ewige Rache geschworen. Welcher übrigens auf einem weißen Schiff segeln soll und den Namen Toby Wick trägt (okay, dieses eine Detail finde ich wirklich cheesy ...). Doch ist Toby Wick ein Mensch oder ein Dämon?
Während Alexandras Fangtrupp – inklusive mitgeschleppten Schiffs und ein paar untergeordneter Kleinwale – auf der Suche nach Toby Wick durch den Ozean pflügt, wird die Handlung einige Stationen durchlaufen, die wir von "Moby Dick" wiedererkennen, ohne sie aber 1:1 zu imitieren. Gänzlich neu ist der Direktkontakt mit dem Feind: Die Wale nehmen einen Menschen namens Demetrius gefangen, und von ihm erfahren sie nicht nur, dass Toby Wick auch bei den Menschen als furchterregender Todesbringer gilt. Es baut sich auch ganz langsam eine Art Freundschaft zwischen Bathsheba und Demetrius auf. Der Plot bezieht damit aus zwei Fragen Spannung: Was wird geschehen, wenn Alexandra ihrer Nemesis endlich begegnet? Und wird Bathsheba Demetrius am Ende töten, wie es ihre Pflicht wäre und wie sie es ihm auch immer wieder androht?
Sprachlich ein Genuss
Call me Bathsheba ... diese Eröffnungsworte als Hommage an Melvilles Original waren wohl unvermeidlich. Und wie Ishmael ist auch dies ein Name, den der Erzähler (bzw. hier die Erzählerin) nur für diese Geschichte gewählt hat; eine Geschichte, die zum Zeitpunkt der Wiedergabe längst abgeschlossen ist und sich selbst reflektiert. Ness bleibt zu Beginn noch nahe an Melvilles Ton, um uns in die richtige Stimmung zu -versetzen, findet dann aber schnell und trotzdem sanft den Übergang zu einer heutigeren Ausdrucksweise, die nicht den Eindruck gekünstelter Altertümelei erweckt. "And the Ocean Was Our Sky" punktet mit jener Art von sprachlicher Poesie, die von Schlichtheit und Präzision lebt. Sehr schön etwa, wie Wale einen Hai betrachten: little more than a tube with teeth and a malevolent brainlessness.
Patrick Ness war vor sehr langer Zeit einmal mit seinen "New World"-Romanen in der Rundschau vertreten. Mit dieser Trilogie und späteren Werken wie "A Monster Calls" ("Sieben Minuten nach Mitternacht") hat sich der britisch-amerikanische Doppelstaatsbürger den Ruf eines Spezialisten für anspruchsvolle Young-Adult-Literatur aufgebaut. Und auch sein jüngstes Werk zeigt wieder, was YA zu leisten vermag. Erneut handelt es sich um ein illustriertes Werk. Die Bilder von Rovina Cai (hier ein paar Beispiele) unterstreichen die märchenhafte Stimmung der Erzählung – doch weder sie noch Ness' lyrischer Stil wollen die Grausamkeiten übertünchen, von denen es hier reichlich gibt. Wale und Menschen stehen sich dabei übrigens in nichts nach.
Die (Un-)Vermeidbarkeit des Schicksals
"You will hunt." Mit diesen Worten wird Bathshebas Lebensweg schon im Kindesalter vorgezeichnet. Doch hat ihre Großmutter damit eine Prophezeiung oder einen Befehl ausgesprochen? Demetrius wird Bathsheba einmal vorhalten, wie oft in der Wal-Gesellschaft vom Schicksal die Rede ist, wie selbstverständlich Ausdrücke wie meant to be und prophesied fallen. Bathsheba, die die ganze Geschichte im Rückblick erzählt (I am not who I was then ...), hat dies inzwischen längst verinnerlicht. Sie reflektiert, wie gut solche Worthülsen dafür geeignet sind, Legenden zu bilden, Gräueltaten zu rechtfertigen und den einfacheren, angeblich vorgezeichneten Weg zu gehen.
Melvilles "Moby Dick" hat sich für mannigfaltige Auslegungen angeboten (und es ist in seiner langen Interpretationsgeschichte wohl auch keine davon ausgelassen worden). Auch "And the Ocean Was Our Sky" vereint viele Aspekte in sich, doch sind sie allesamt in eine Richtung kanalisiert: auf das Thema Krieg und die Frage, ob Konflikt ein unvermeidbares Schicksal ist. Kein Wunder also, dass Bathshebas Erzählung in eine Botschaft an ihre Zuhörer – egal, ob sie Flossen oder Füße haben – mündet: If you hear what I say and still wish yourself there, wish yourself a hero, wish yourself a hunter, then either I have failed in my telling or you are a fool.
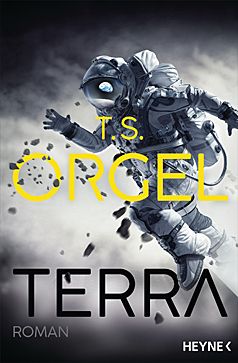
T. S. Orgel: "Terra"
Broschiert, 508 Seiten, € 15,50, Heyne 2018
Einen gewagten Genrewechsel haben Tom und Stephan (alias "T. S.") Orgel hier vollzogen: Das Brüderpaar aus Deutschland begann seine Karriere in der Spätphase der berühmt-berüchtigten "Völkerromane"-Mode in der Fantasy mit der Trilogie "Orks vs. Zwerge"; darauf folgte mit "Die Blausteinkriege" eine weitere Trilogie. Mit "Terra" wechseln sie nun nicht einfach nur von der Fantasy in die Science Fiction, sondern just in die Mundane SF – also jenes Subgenre, in dem nur das zumindest theoretisch Machbare erlaubt ist und auf sämtliche quasi-magische Supertechnologie verzichtet werden muss. Keine leichte Aufgabe, doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und das Risiko hat sich gelohnt.
Ein kurzer Überblick
Ende des 21. Jahrhunderts lebt man auf der Erde zwar nicht im Elend, doch musste dafür der erwartbare Preis bezahlt werden: Umweltzerstörung und Klimawandel sind weit vorangeschritten; nach einer Welle von Katastrophen zeigen sich zur Romanzeit gerade zaghafte Anzeichen dafür, dass es langsam wieder besser wird. Eine maßgebliche Rolle dafür spielen Rohstofflieferungen aus dem Sonnensystem, das man zu erschließen begonnen hat.
Eine zentrale Stellung nimmt dabei der Erdmond ein, der vom Rohstoffboom mitsamt all seinen Folgeerscheinungen geprägt ist. In den lunaren Kuppelstädten und dem sie verbindenden Tunnelsystem – der buchstäblichen Unterwelt von "Chinatown" – wimmelt das Leben, zum Guten wie zum Schlechten. Die Grenzen zwischen Legalität und Illegalität sind in diesem Schmelztiegel äußerst fließend. Wir lernen die zwischen Kreativität und Verbrechen pendelnde Mond-Gesellschaft aus den Augen von Space Marshal Sal Zhao kennen, einer der zwei Hauptfiguren des Romans.
Die Dinge kommen ins Rollen
Im Prolog des Romans hat eine Raumfahrerin entdeckt, dass irgendetwas mit ihrer Fracht nicht stimmt. Kurz darauf wird sie offensichtlich von ihrer eigenen Technik sabotiert und kommt zu Tode. Das gleiche Schicksal könnte nun auch der zweiten Hauptfigur des Romans drohen, Sals Bruder Jak, der sich als Weltraumtrucker verdingt. So nennt man die Einmann-Crews der riesigen Transportschiffe, die die begehrten Rohstoffe zur Erde verfrachten. Trucker sind im Zeitalter der Automatisierung für den letzten Rest an Tätigkeiten zuständig, die man besser von einem flexibel denkenden Menschen als von Software abwickeln lässt. Nichtsdestotrotz stellen sich die Trucker mitunter die Frage, ob sie nicht vielleicht bloß glorifizierte Saftschubsen sind.
Jak hat sich mit anderen Truckern aus aller Herren Länder zu einem interplanetaren Konvoi zusammengeschlossen, als er entdeckt, dass seine Fracht fehldeklariert ist und er sogenannte Darwinsonden an Bord hat. Das sind hochexplosive Pakete aus komprimierten Treibhausgasen und Mikroben, mit denen man den Mars terraformieren möchte. Bei bereits lebensfreundlichen Zielen würden sie sich hingegen verheerend auswirken, sie werden nicht umsonst als "Terraformingbomben" beschrieben. Nun gilt es herauszufinden, wer die Bomben eingeschmuggelt hat, was er damit bezweckt und wie er sich aufhalten lässt.
Sal und Jak gehen der Verschwörung nach, durch Lichtminuten voneinander getrennt. Sal hat dabei noch den Vorteil, dass sie sich mit Fäusten und Schusswaffen ins Gewühl schmeißen kann, wenn ihre Ermittlungen mal wieder einen Twist ins Brisante vollzogen haben. Jak und seine Truckerkollegen hingegen können nur heimlich vorgehen. An Bord der Schiffe herrscht eine Atmosphäre der Beklemmung, die Raumfahrer fühlen sich – zu Recht, wie ihre arme Kollegin aus dem Prolog zeigte – dem unsichtbaren Feind ausgeliefert. Da heißt es erfinderisch sein. Wenn sie die normale Schiffstechnologie umgehen und sich per gutem altem Funk untereinander austauschen, steigen übrigens Erinnerungen an den 70er-Jahre-Film "Convoy" auf ...
Zweiter Bildungsweg
In der Danksagung schreiben die beiden Autoren, dass sie für ihren Wechsel in die SF erst mal recherchiert haben – und das merkt man auch. Fun Facts wie die Frage, warum die Durchschnittsbreite eines Pferdearschs aus der Römerzeit selbst in der Raumfahrtära noch eine Rolle spielt, hätte sicher auch ein Andy Weir gerne in sein "Artemis" eingebaut, das "Terra" von Setting und Feeling her nah verwandt ist.
Mitunter trägt der Roman, was Wissenswertes zur Welt und deren Geschichte betrifft, ein wenig Übergepäck. Beispiel: Als Sal in einem Fluchtwagen aus einer brisanten Situation entkommt, werden Infos über den Trend weg von manuellen Lenksystemen eingestreut, gefolgt von der Auswirkung dieses Trends auf die Unfallstatistik, gefolgt von einer Reminiszenz an Sals erste Fahrstunden. Und gleich auf der nächsten Seite kommt ein zweiter Durchgang: Hintergrundwissen zur Bewaffnung der Space Marshals, gefolgt vom Effekt sogenannter Stun Guns, gefolgt von einer Erinnerung daran, wie Sal mal mit einer Stun Gun fischen ging. Das ist eh alles schön und gut, aber jetzt ist nicht der Moment dafür, wir befinden uns immer noch mitten in einer wilden Verfolgungsjagd.
Die Technik lügt
Aber wie es in Fußball-Talks so schön heißt: Das ist Jammern auf hohem Niveau. In "Terra" sitzt neben der Spannung auch die Plausibilität; ganz, wie man es von Mundane SF erwarten muss. Und darüber hinaus – da sind wir schon im Bereich der Zusatzgratifikationen – hat der Roman auch noch ein schönes Leitmotiv: Trau deinen Augen nicht.
Das schmuggeln die beiden Autoren immer wieder ein. Manchmal in ganz harmlosem Kontext, etwa wenn erwähnt wird, wie den Mondbewohnern für ihr Seelenheil idyllische Landschaften an die Wände projiziert werden. Schon etwas ambivalenter wird's, wenn Jak über die Sensoren und Monitore seines Raumschiffs ein simuliertes Weltraumgefecht laufen lässt (ähnlich der "Star Trek"-Szene, in der Michael Burnham die Verhältnisse an Bord der "USS Discovery" kennenlernt). Und tödliche Brisanz erreicht es, wenn die Trucker argwöhnen müssen, dass die Anzeigen ihrer Bordsysteme von jemandem manipuliert worden sind. Das sind lauter Details, die motivisch auf einen Plot um eine unsichtbare Verschwörung vorbereiten: Geschickt gemacht!
"Terra" kurz zusammengefasst: ein rundum gelungener Genrewechsel von T. S. Orgel.
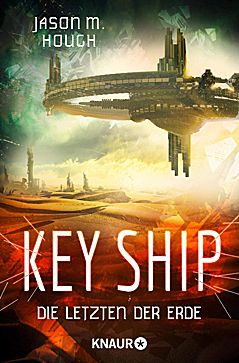
Jason M. Hough: "Key Ship. Die Letzten der Erde"
Broschiert, 510 Seiten, € 13,40, Knaur 2018 (Original: "The Plague Forge", 2013)
Achtung: Ihr, die ihr dieses Buch aufschlagen wollt, ohne vorher Teil 1 ("Darwin City") und Teil 2 ("Exodus Towers") der "Dire Earth"-Reihe gelesen zu haben, lasset alle Hoffnung fahren. "Key Ship" beginnt mitten in einem Kampfeinsatz, ohne jeden erklärenden Rückblick auf das Gesamtszenario, die Beziehungen der Figuren untereinander oder den aktuellen Missionsstand. Es liest sich, als wären es einfach die nächsten Kapitel ein und desselben Romans. Und rückblickend muss man auch sagen, dass Jason M. Hough es tatsächlich besser bei nur einem Buch belassen hätte.
Rückblick
Noch einmal in aller Kürze zum Grundszenario: Im 23. Jahrhundert ist die Erde in einer Nacht- und Nebelaktion von technologisch überlegenen Aliens besucht worden, den Erbauern. Diese haben zwei Weltraumfahrstühle und diverse andere Artefakte zurückgelassen ... aber auch eine Seuche ausgestreut, der fast die ganze Menschheit zum Opfer gefallen ist. Die meisten sind tot, ein kleiner Teil hat sich hingegen in Subhumane – triebgesteuerte Quasi-Zombies – verwandelt, die nun die Gegend unsicher machen. Und nur ein leider noch wesentlich kleinerer Teil ist verschont geblieben – entweder aufgrund natürlicher Immunität, oder wenn sich jemand rechtzeitig in die Nähe von Alien-Artefakten flüchten konnte: Die haben nämlich ein Aura genanntes Schutzfeld um sich, in dem die Seuche nicht virulent wird.
Wie bei Post-Apokalypsen üblich, haben die Überlebenden bald mehr mit rivalisierenden Menschen als mit dem "eigentlichen Ding" zu ringen. Und so ist Hauptfigur Skyler Luiken zusammen mit einigen Getreuen aus dem australischen Darwin – seit der Pandemie der Nabel der Welt – ins brasilianische Belém gewechselt. Dort steht ebenfalls ein Weltraumfahrstuhl, aber einer ohne örtlichen Diktator. Von dieser neugegründeten Kolonie aus sind Skyler & Co auf der Spur von Alien-Artefakten um den Globus gezogen, haben beim Betreten außerirdischer Konstrukte seltsame Effekte erlebt und jede Menge Kämpfe gegen Subhumane ausgetragen.
... so war's in "Exodus Towers", und so ist's nun auch in "Key Ship". Skyler & Co ziehen auf der Spur von Alien-Artefakten in Teams um den Globus, erleben beim Betreten außerirdischer Konstrukte seltsame Effekte und tragen jede Menge Kämpfe gegen Subhumane aus. Wieder und immer wieder.
Eine Buchreihe auf Talfahrt
Nach dem wirklich beachtlichen ersten Band ging's in den Fortsetzungen leider sukzessive bergab. Hough ist offenbar der süßen Versuchung erlegen, seine Schöpfung bis zum Anschlag zu melken. Das Ergebnis entspricht einer TV-Serie à la "Falling Skies" oder "Walking Dead", die eine Staffel zu viel eingeschoben hat. Teil 2 und 3 seiner Reihe hätte Hough l-o-c-k-e-r-s-t zu einem Band zusammenfassen können, und der könnte schmäler sein als jeder der beiden. Immerhin definiert sich ein Plot irgendwie schon über Handlungsfortschritte, und hier herrscht diesbezüglich über viele hundert Seiten hinweg Stillstand.
Die Parallelhandlung um Skylers alte Weggefährtin Samantha in Darwin hätte man sogar zur Gänze aus "Key Ship" herausstreichen können. Bis Samantha wieder mit Skyler vereint wird, hat dieser Handlungsfaden fürs Gesamte keinerlei Relevanz und ist in all seiner Ausführlichkeit nur noch eine Soap, die um ihrer selbst willen weiterläuft.
Völlig losgelöst von der Erde
Nüchtern betrachtet muss man sagen, dass Hough die Kontrolle über den Aufbau seiner Geschichte verloren hat. Angesichts der repetitiven Abläufe im laaangen Hauptteil von "Key Ship" ist es umso befremdlicher, dass sich der Autor keine Zeit genommen hat für 1) einen einordnenden Rückblick zu Beginn und 2) einen gut ausgearbeiteten Schluss. Denn nach hunderten Seiten vom immer selben kommt's dann plötzlich doch noch zu einem gewaltigen Handlungsfortschritt. In aller Hast wird dann eine Weichenstellung für den abschließenden vierten Band vollzogen, und die so lange ersehnte Antwort auf die Frage, warum die außerirdischen Erbauer der Erde so übel mitgespielt haben, wird auch noch schnell hineingestopft. (Und kann keineswegs rundum befriedigen.) Solche Gerafftheit ginge vielleicht am Ende einer Novelle, steht aber in krassem Missverhältnis zum vollgeschriebenen Volumen davor.
Immerhin – Achtung, "Spoiler"!!! – kann man Hough dazu gratulieren, dass er mit seiner "Dire Earth"-Reihe etwas geschafft hat, das Roland Emmerich nach dem Misserfolg von "Independence Day 2" wohl verwehrt bleiben wird: Im 2017 auf Englisch erschienenen Abschlussband verlegt Hough den Mensch-Alien-Konflikt nach dem Hinspiel auf den Platz des Gegners. Das wäre der natürliche dritte Band einer schönen Trilogie geworden, wenn sie organisch wachsen hätte dürfen und Hough nicht dem fatalen Trieb gefolgt wäre, den Mittelteil auf zwei Schinken zu strecken. Schade!
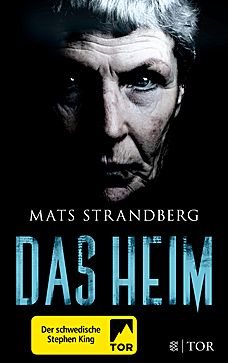
Mats Strandberg: "Das Heim"
Klappenbroschur, 448 Seiten, € 15,50, Fischer Tor 2018 (Original: "Hemmet", 2017)
Weihnachten, Zeit der Schuldgefühle. Jetzt bekommen selbst die diejenigen ihren Pflichtbesuch, die sonst das ganze Jahr über allein im Altersheim hocken. Damit sind Stimmung und Schauplatz des neuen Horror-Romans von Mats Strandberg auch schon genannt. In "Das Heim" tritt der schwedische Erfolgsautor im Vergleich zum aberwitzigen Blutbad des Vorgänger-Romans "Die Überfahrt" zwar kräftig auf die Action-Bremse, bleibt aber 1) beim Übernatürlichen und 2) schonungslos.
Schuld ...
Ausgangspunkt der Handlung ist die widerwillig getroffene Entscheidung des 39-jährigen Joel Edlund, seine dement gewordene Mutter Monika in ein Pflegeheim zu bringen. Obwohl er tatsächlich keine andere Wahl hat, ist damit das Thema Schuldgefühle etabliert. In der Folge wird es in verschiedensten Kontexten immer wieder auftauchen: ob in Joels Ringen mit seiner jahrelangen Drogensucht oder im Wiedersehen mit seiner ehemaligen Schulfreundin Nina, die nun als Pflegekraft im Heim arbeitet.
Was genau die gemeinsame Vergangenheit von Joel und Nina überschattet, sei hier nicht verraten, weil es zu den originelleren Einfällen des Romans zählt. Doch selbst wenn Joel nicht wieder in ihrem Leben aufgetaucht wäre, hätte Nina eine Last zu tragen. Eine Kollegin beschreibt sie einmal so: Nina scheint der Typ zu sein, der sich mit Kernseife wäscht, denkt Johanna. Ist porentief rein. Hat kurzgeschnittene Nägel und einen praktischen Kurzhaarschnitt. Riecht völlig neutral. Wir werden noch sehen, dass es sich dabei weniger um Ninas ureigentliches Wesen als um eine Persona handelt, die sie aus Selbstschutz konstruiert hat.
... und Schonungslosigkeit
Wie schon in "Die Überfahrt" nimmt sich Strandberg wieder reichlich Zeit, sein Setting und seine Figuren aufzubauen. Das im Südwesten Schwedens gelegene Heim Nebelfenn (klingt schlimmer als die legendäre Schattige Pinie aus den "Golden Girls") ist zwar eine propere Einrichtung mit allen menschenmöglichen Pflegekapazitäten. Aber es bleibt eben, was es ist: ein extrem trister Mikrokosmos.
Der Reihe nach lernen wir dessen Bewohner kennen: Dagmar, die ständig ihr Essen ausspuckt. Wiborg, die immer wieder ihre seit Jahrzehnten toten Eltern anrufen will und weint, weil die Telefonnummer ins Leere führt. Petrus, der nicht mehr bei Sinnen ist und gegenüber den Pflegerinnen übergriffig wird. Oder Edit, die stets nur einen einzigen Satz wiederholt wie eine hängengebliebene Schallplatte (ist abzusehen, dass Strandberg diese Schleife früher oder später einmal für einen Schreckmoment durchbrechen wird, ist schließlich ein Horror-Roman ...).
Wir lesen von Menschen, die sich einnässen, ihren Kot verschmieren ... Strandberg erspart uns wirklich nichts. "Ich glaube, der Apfel ist wieder rausgeflutscht", erklärt Anna, als sie eintreten. Tatsächlich hängt ihr stark geröteter Darm wieder aus dem Anus heraus. Sie leidet an einem Rektumprolaps, bei dem bisher keine Operation geholfen hat.
Die Genre-Elemente
Die Beschreibung des Alltags im Heim geht beim Lesen ziemlich an die Nieren. Sie wird mit vergleichbarer Konsequenz durchgezogen wie die Gore-Passagen in "Die Überfahrt" und stellt damit die eigentlichen Genre-Elemente über lange Zeit hinweg in den Schatten. Letztere zeichnen sich erst ganz allmählich ab, wie Menetekel an der Wand: Eine Heimbewohnerin lässt eine – leider überhörte – Bemerkung fallen, dass mit Monika noch jemand in Nebelfenn eingezogen sei. Eine Schwester sieht einen Schatten am Gang, und Joel findet einen seltsamen Fettfleck am Kopfende von Monikas Bett, der sich einfach nicht wegwischen lassen will.
Weil Strandberg diesmal stark auf die realistischen Anteile seiner Erzählung fokussiert, dauert es, bis es tatsächlich zu dem kommt, was bereits im Klappentext angedeutet wird. Auch dazu seien natürlich keine Details verraten. So viel aber kann man nach zwei Romanen sagen: Überraschungen darf man sich von Mats Strandberg offenbar keine erwarten. Er pickt sich ein bestehendes Horror-Subgenre heraus, um dann dessen Anforderungen zu erfüllen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Beim nächsten Mal wird das offenbar der Weltuntergangsroman sein: "Slutet" (wörtlich "Der Schluss") ist vor kurzem auf Schwedisch erschienen.
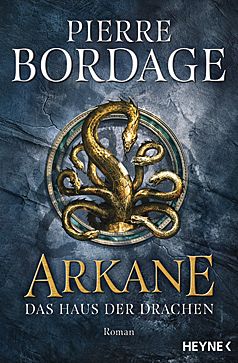
Pierre Bordage: "Arkane"
Broschiert, 608 Seiten, € 17,50, Heyne 2018 (Original: "Arkane: La Désolation", 2017)
Killersätze wie "Einzig seine Gabe und sein Wissen können Arkane noch retten" im Klappentext sind für mich normalerweise ein hundertprozentiger Ausschlussgrund, ein Buch zu lesen. Das Fantasy-Ultraklischee von der einen auserwählten Person, an der das Heil der Welt hängt, ist derart bis auf den Knochen abgelutscht, dass ich es wirklich nicht mehr ertragen kann. Allein der Umstand, dass der Franzose Pierre Bordage mit "Die Krieger der Stille" und "Die Sphären" schon einige wirklich originelle SF-Romane abgeliefert hat, hat mich eine Ausnahme machen lassen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. So richtig gesund hat sie nach der Lektüre aber nicht mehr ausgesehen.
Das Szenario
Vor langer Zeit wurde die an einem Fluss gelegene Stadt Arkane durch eine Flut verwüstet. Nur sieben Familien wurden von ebensovielen Flussgöttinnen gerettet – die stellen im Arkane der Romangegenwart nun die Adelshäuser, jedes davon nach einem der mythologischen Tiere benannt, die die Göttinnen einst als Retter entsandt haben sollen. Zugleich ist Arkane streng hierarchisch in die Höheren und Niederen Ebenen unterteilt, in denen Adel und Anhang respektive der Pöbel leben. Wie die Stadt dies architektonisch widerspiegelt und wie sie nun tatsächlich aussieht, erschließt sich einem erst im Lauf der Lektüre.
Diese Faktoren ergeben ein reißbrett- oder auch spielbrettartiges Grundszenario von hoher Symmetrie. Die wird allerdings gestört, als sich sechs der Adelshäuser gegen das (natürlich positiv gezeichnete) Haus des Drachen verschwören und dessen Mitglieder abschlachten. Der Verlust des jahrtausendealten Gleichgewichts ist die erste Stufe einer Verschwörung durch dunkle Kräfte, die vermutlich von außerhalb Arkanes kommen. Weitere Eskalation ist absehbar – und am Ende droht der Untergang der Stadt, wie es allerlei düstere Prophezeiungen bereits vor sich hinmunkeln.
Im Zentrum des Geschehens
Die junge Oziel du Drac ist die einzige, die das Massaker am Haus des Drachen überlebt hat. Nur in den Tiefen unter der Stadt soll noch einer ihrer Brüder in der Verbannung leben. Oziel schwört sich, ihn zu finden und Rache an den Mördern zu nehmen. Dieses Vorhaben wird ihr allerdings Ungeahntes abverlangen – unter anderem muss sie sich zwecks Tarnung mit einer entstellenden Krankheit infizieren lassen, das ist mal ein neuer Einfall.
Fernab von Arkane sieht derweil der Teenager Renn einer ganz anderen Queste entgegen. Er ist ein Bauernbub, den seine Eltern als Lehrling bei einem Magier abgeladen haben, weil sie ihn als unnützen Fresser betrachten. Doch just an dem Tag, an dem Renn bemerkt, dass er tatsächlich über eine Gabe verfügt, muss er seine Lehrstelle verlassen: Orik, ein alter Haudegen aus einem benachbarten Königreich, das von Invasoren überrannt wurde, schnappt ihn sich als landeskundigen Guide. Gemeinsam wollen sie sich nach Arkane durchschlagen, um die Stadt vor den Invasoren zu warnen.
Oziel und Renn sind zwei jugendliche Fantasyhelden klassischen Typs. Dazu kommen aber noch andere (ebenfalls junge) Protagonisten, die sich nicht ganz so leicht einordnen lassen. So erhält Oziel Unterstützung von Arjo, obwohl der dem Bund der Verwüstung angehört, der doch eigentlich an der Verschwörung in Arkane entscheidend mitbeteiligt ist. Kann man ihm trauen? Noch wesentlich ambivalenter kommt Noy aus dem Haus des Corridan daher. Er schwärmt für Oziel und gerät in Konflikt mit den Machenschaften seiner Familie – strahlender Held ist er allerdings keiner, schon eher ein Fall für #metoo: Dass er in eine Sexfalle tappt, nachdem er reihenweise Dienerinnen missbraucht hat, wirkt nur gerecht – die Zukunft wird zeigen, wohin es mit dieser ungewöhnlichen Figur geht.
Die Machart
Gleich auf den ersten Seiten bringt Pierre Bordage so ganz nebenher einige Infos unter, bei denen (US-)Leser, die nicht gerne aus ihrer Komfort-Blase geholt werden, mit Sicherheit sofort nach "Trigger-Warnungen" schreien würden. So erfahren wir etwa, dass den Angehörigen der Adelshäuser im zarten Kindesalter Brandzeichen auf die Geschlechtsteile gedrückt werden. Oder dass Oziel mit einem ihrer Brüder in einem inzestuösen Verhältnis lebte, bei dem sie nur den allerletzten Schritt noch nicht vollzogen hatten. Und das alles, während Oziel durch die Leichenberge ihrer Angehörigen stolpert. Heftige Ladung!
Andererseits kennen wir derartige Drastik schon. Es gibt sie in der Fantasy seit vielen Jahren, und mit George R. R. Martin ist der ungeschönte Blick auch im Mainstream angekommen. Nicht, dass "Arkane" schlecht wäre, keineswegs – es bietet nur einfach nichts Neues. In Kontrast zur Originalität von Bordages SF-Werken hat man es hier eher mit Sollerfüllung in Sachen Fantasy-Epos zu tun. Wozu auch gehört, dass läppische 600 Seiten selbstverständlich nicht ausreichen, um es zu erzählen. Nach allerlei Mikro-Abenteuern reißt "Arkane" einfach mittendrin ab; die letzten Seiten sind nicht einmal ansatzweise als Abschlussteil gestaltet. Teil 2 ("La Résurrection") ist übrigens erst vor einem Monat auf Französisch erschienen.
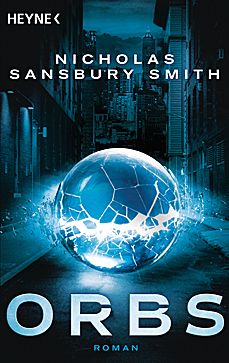
Nicholas Sansbury Smith: "Orbs"
Broschiert, 398 Seiten, € 10,30, Heyne 2018 (Original: "Orbs", 2013)
Eine echte Schreibfabrik hat hiermit ihre deutschsprachige Dependance eröffnet. Immerhin hat der US-Amerikaner Nicholas Sansbury Smith in seiner noch kurzen Autorenkarriere schon mehr Bücher auf den Markt gebracht als so mancher anerkannte Klassiker des Genres in seinem ganzen Leben: Seit 2013 hat Sansbury Smith an die zwei Dutzend(!) Romane veröffentlicht. Und genau so sind die dann auch.
Heißer Hintergrund
Ausgangspunkt von "Orbs" ist eine in der Science Fiction gerne verwendete, wenn auch nie so wirklich plausible Prämisse: Der Mars soll besiedelt werden, weil die Erde unbewohnbar geworden ist – obwohl strenggenommen schon gewaltig viel passieren muss, bis es leichter ist, den Mars zu terraformieren als die Erde wieder zu restaurieren. Sansbury Smith bietet immerhin Sonnenstürme auf, die weite Teile der Erdoberfläche versengt haben. Ein paar Jahre nach der Katastrophe – wir schreiben nun 2061 – geht daher das Mars-Projekt in den ersten Praxistest.
Analog zu Experimenten aus der realen Welt wie "MARS-500" oder "Biosphere 2" soll ein Grüppchen von Forschern längerfristig in einer vollkommen von der Außenwelt abgeschotteten Anlage eingesperrt werden, um die Bedingungen in einer Marskolonie zu simulieren. Schauplatz ist übrigens eine nicht ganz unbekannte Einrichtung in den Rocky Mountains: NORAD. In Sansbury Smiths Zukunftswelt befindet sich dieses längst in privater Hand, Zeichen der Zeit.
Beine in die Hand und Feuer frei
Die Crew der Mini-Biosphäre umfasst, die KI Alexia miteingerechnet, ein halbes Dutzend Personen rings um Hauptfigur Sophie Winston, Teilchenphysikerin und Leiterin des Experiments. Und schon nach wenigen Tagen sieht man sich mit dem ersten Problem konfrontiert: Die tierischen Bewohner der Anlage sind tot, offenbar haben sie sich beim Versuch zu fliehen buchstäblich die Schädel an den Käfigwänden eingerannt. Kurz danach reißt auch noch der Kontakt zur Außenwelt ab. Als sich Sophie & Co nach einigem Hin und Her schließlich hinauswagen, erwartet sie das Grauen: Die Menschen und anscheinend auch sämtliches Wasser sind verschwunden.
Dafür wimmelt es plötzlich überall vor blau leuchtenden Kugeln aus Flüssigkeit. Warum der Roman "Orbs" heißt, wird dennoch nicht so ganz klar. Viel mehr als eine Pausennummer sind die Kugeln nämlich nicht. Da tummelt sich bald noch allerhand Anderes und wesentlich Gefährlicheres auf Erden. Was genau, sei hier nicht verraten – nur die daraus folgende Konsequenz: Nachdem der anfängliche Mystery-Faktor verpufft ist und die Monster losgelassen wurden, ist der beträchtliche Rest des Romans nur noch ein einziges Laufen und Schießen nach Schema F. Man könnte "Orbs" locker für ein Videospiel der einfacheren Machart adaptieren.
Das Fließband läuft
Der Roman kommt in typischer Heyne-Aufmachung daher: ein dunkel getöntes Cover mit SF-mäßig aufgejazzten geometrischen Formen, wie es auch schon Werke von beispielsweise Robert Charles Wilson oder Dan Simmons geziert hat. Das nivellierende Corporate Design sollte aber nicht für eine Sekunde zur Annahme verführen, dass Sansbury Smith in derselben Liga spielt. Stilistisch unauffällig und inhaltlich unausgegoren, ist "Orbs" purer Pulp von einem Fließbandautor der fastfoodigsten Sorte. Und die Bücher kommen schneller nach, als man sie weglesen kann: Im Original gibt es zu "Orbs" bereits drei Fortsetzungen, ein Prequel und einen Storyband – alles wie gesagt im Zeitraum seit 2013 und parallel zu weiteren Serien geschrieben. Da fragt man sich doch, was andere Autoren eigentlich den lieben langen Tag tun ...
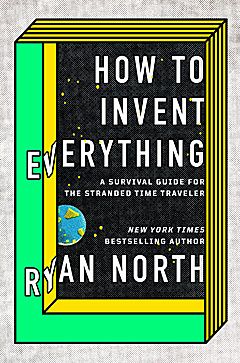
Ryan North: "How to Invent Everything: A Survival Guide for the Stranded Time Traveler"
Gebundene Ausgabe, 464 Seiten, Riverhead Books 2018, Sprache: Englisch
Hach, man kennt das ja: Da quetscht sich die ganze Familie zum Muttertag in die Zeitmaschine, um Dinosaurier schauen zu gehen, dann schmiert das blöde Ding ab und man sitzt in der Kreidezeit fest. Wer von uns ist noch nicht in dieser Lage gewesen? Um nicht in Barbarei zu versinken, hilft dann nur mehr eines: die Zivilisation von null auf neu zu gründen. Dieser Survival Guide zeigt, wie es geht.
Der Kanadier Ryan North ist vor allem aus dem Comic-Bereich bekannt (unter anderem schuf er für Marvel "The Unbeatable Squirrel Girl"). Seine Fähigkeit querzudenken demonstrierte er bereits mit einer skurrilen Aktion gegen Wikipedia-Vandalismus, indem er dazu aufrief, nur noch den Artikel über das Haushuhn zu verunstalten und den Rest der Online-Enzyklopädie in Ruhe zu lassen. "How to Invent Everything" nun ist seine individuelle Verschmelzung zweier etablierter Genres: des herkömmlichen Survival-Guides einerseits und des Sachbuchs über die – mitunter verkannten – Grundlagen unserer Zivilisation andererseits. Für Letzteres standen Werke wie Jared Diamonds "Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies" oder diverse Titel aus Eric Chalines Reihe "Fifty Things that Changed the Course of History" Pate. Präsentiert wird das Ganze im vergnügten Tonfall eines Quasi-Sachbuchs von Terry Pratchett.
Überlebensfragen
Das mit der Zeitmaschine ist letztlich natürlich nichts anderes als ein gelungener Aufhänger, mit dem sich das Buch gut verkaufen lässt. Nachdem in der Einleitung erwähnt worden ist, dass dieses Buch in präkambrischem Gestein eingeschlossen gefunden wurde, geht's recht schnell in die Praxis über. Zum Beispiel zum Universal Edibility Test, mit dem man giftige von ungiftiger Nahrung unterscheiden kann. Gefolgt von Tipps zur Herstellung von Holzkohle und Penicillin, zur Destillation von Wasser oder zur Salzgewinnung.
Das ist Survival-Guide-Content pur – anders als die Unzahl von Titeln, mit denen sich Doomsday Preppers auf ihr Überleben nach der Apokalypse vorbereiten, findet man hier allerdings weder politische Verschwörungstheorien noch Düsternis. Stattdessen ist der Ton durchgehend positiv und humorvoll gehalten, was von der Ironie – Great news: you can eat anything once! – bis zum bezaubernden Understatement reicht: Mit Blick auf die unscheinbaren natürlichen Ahnen unseres heutigen Obstes und Gemüses gibt North in der Vergangenheit Gestrandeten den guten Tipp "Prepare for disappointing salads" mit.
Science is Fun
Aber natürlich ist die Landwirtschaft nur der Anfang. Es folgen Anleitungen zum Aufbau von Bergbau und Technologie sowie Einführungen in die Naturwissenschaften, Mathematik und Semiotik samt einem Plädoyer für vernünftige Maßeinheiten (inklusive galliger Kritik an der Weigerung der USA, sich dem metrischen System anzuschließen). Später zeigt uns North dann auch noch, wie sich Logik, Philosophie, Musik (Zeitreisenden ist jedes schamlose Plagiat erlaubt!) und bildende Kunst aus dem Boden stampfen lassen. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Buch freilich längst in einem "Science is Fun"-Erklärmodus. An die Phantastik-Prämisse mit der Zeitmaschine erinnern dann höchstens noch die pratchettesken Fußnoten, von denen es allerdings reichlich gibt.
Garniert wird der Rundgang durch die Grundlagen unserer Zivilisation mit jeder Menge Fun Facts: etwa zur Frage, welche nützliche Substanz sich aus Bibern gewinnen lässt, wie man sich einst mit der – ausgefeilten, aber leider total falschen – Phlogiston-Theorie Verbrennungsprozesse erklärte, weil man die Rolle von Sauerstoff noch nicht erkannt hatte, oder wie es zu dem peinlichen Umstand kam, dass man in Europa Vitamin-C-reiche Nahrung als Mittel gegen Skorbut entdeckte. Dann wieder vergaß. Dann wiederentdeckte. Und es erneut vergaß – bis das Wissen irgendwann endlich doch dauerhaft hängen blieb.
Zeit sparen, Zeitreisende!
Womit wir auch schon bei der zentralen Aussage des Buchs angekommen wären: Vieles von dem, was wir heute für selbstverständlich halten, ist erst unerklärlich spät entdeckt worden – sei es die Dreifelderwirtschaft, sei es die Idee, einen Bewusstlosen in stabile Seitenlage zu bringen, damit er nicht an seiner Zunge erstickt. North verweist drauf, dass sich die menschliche Anatomie – einschließlich der des Gehirns – in den vergangenen 200.000 Jahren praktisch nicht verändert hat. Es gäbe also keinen logischen Grund, warum so viele fundamentale Ideen nicht schon viel früher geboren werden hätten können. Der Guide bietet Zeitreisenden damit die Möglichkeit, unter Umgehung der überlangen Trial-and-Error-Phase viel schneller eine Zivilisation aufzubauen – und, wie es zu Beginn heißt, "mit 96 Prozent weniger Katastrophen".
Ein abschließender Tipp von mir noch: Wer sich das Buch zulegen will, sollte besser zur Papier-Version greifen. Zum einen, weil es neben einigen Illustrationen eine sehr große Zahl von Tabellen und Flowcharts enthält, deren Formatierung einem E-Reader Probleme bereitet. Und zum anderen natürlich, weil der Akku eines solchen Readers irgendwann leer ist – und dann hilft er einem herzlich wenig, wenn man in der Urgeschichte gestrandet ist.
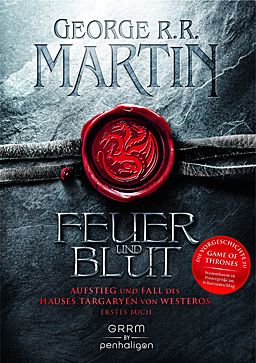
George R. R. Martin: "Feuer und Blut. Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros. Erstes Buch"
Gebundene Ausgabe, 890 Seiten, € 26,80, Penhaligon 2018 (Original: "Fire & Blood: 300 Years Before a Game of Thrones [A Targaryen History]", 2018)
Ein wahrlich monströses Buch – und nicht nur, weil Drachen darin vorkommen – lässt George R. R. Martin kurz vor Weihnachten bei uns aufschlagen wie einen Asteroiden. Auf 890 großformatigen Seiten schildert der Großmeister der modernen Fantasy die Vorgeschichte seines "Lieds von Eis und Feuer". Es sind die Jahrhunderte ab dem Zeitpunkt, da Aegon I. aus dem Haus Targaryen (die Familie, in der möglichst jeder einen Namen mit -ae- haben sollte) den Kontinent Westeros erobert und jene Königsdynastie etabliert, die erst unmittelbar vor der Handlung der Original-Romane mit einem Tritt in den Arsch verabschiedet worden ist.
Und so wie Asteroideneinschläge in der Regel Massensterben auslösen, gestaltet sich auch die Handlung von "Feuer und Blut": Munter reiht sich hier Massaker an Massaker, wir lesen von Massenverbrennungen, Meuchelmord und Kastration, es wird verstümmelt, vergewaltigt und vergiftet, dass die Schwarte kracht – und die Atempausen dazwischen nutzt man in Westeros lediglich, um Intrigen zu spinnen und die nächste Fortsetzung der Diplomatie mit anderen Mitteln zu planen. Man gönnt sich ja sonst nichts!
Hat man nicht in einer Nacht durch
"Feuer und Blut" ist einer der äußerst seltenen Fälle, in denen ich ein Buch in der Rundschau vorstelle, das ich noch nicht bis zum Ende gelesen habe. In einem kann man diese unfassbare Textmenge ohnehin nicht konsumieren, das Buch entspricht dem Stoff von einem Jahr Geschichtsunterricht in der Oberstufe. Und das ist nur der erste von zwei Bänden! Aktuell befinde ich mich übrigens gerade mitten in der Regentschaft von Jaehaerys I., die sich über 55 Jahre und mehrere hundert Seiten erstreckt (mit der Kraft von gleich zwei -ae- im Namen ist es ja kein Wunder, dass er sich so lange halten konnte).
Ein unvollständig gelesenes Buch kann man freilich auch nur in Ausnahmefällen wie diesem beurteilen: Der Plot ist bekannt, Auszüge daraus wurden in kürzerer Form auch bereits veröffentlicht (z.B. im üppigen Bildband "Westeros" aus dem Jahr 2015). Für die Bewertung zählt dann hauptsächlich die Machart, und die ist schnell erfasst: George R. R. Martin lässt die Handlung formal vom Erzmaester Gyldayn erzählen, alle Erklärungen sind also "in-universe" und erfordern ein zumindest minimales Vorwissen der Leser über die Welt von "Game of Thrones".
Immersion wie bei einem Roman gibt es hier nicht, das Buch ist strikt im Ton einer Chronik gehalten. Martin/Gyldayn lockert seine Schilderungen zwar gelegentlich mit ironischen Seitenhieben oder Anmerkungen zu einander widersprechenden historischen Quellen auf, im Großen und Ganzen ist der Stil aber sehr sachlich gehalten. Ein weiteres Auflockerungselement bilden die zahlreichen Schwarz-Weiß-Illustrationen von Doug Wheatley. Als Draufgabe enthält der Umschlag auf der Innenseite dann noch eine großflächige Ahnentafel des Hauses Targaryen. Insgesamt ein beeindruckendes und trotz einer Textmenge, die einen förmlich erschlägt, tatsächlich vergnüglich zu lesendes Buch ... solange man nicht zartbesaitet ist.
Vorlage für ein Prequel?
Nach dem Welterfolg der TV-Serie "Game of Thrones" war schon von bis zu fünf Ablegern die Rede, allesamt übrigens Prequels. Einigermaßen konkret ist davon bislang aber nur eines, das einige tausend Jahre vor dem "Lied von Eis und Feuer" spielen würde. Die hier geschilderte Geschichte des Hauses Targaryen ist hingegen noch nicht für eine TV-Adaption unter Dach und Fach – auch wenn man beim Lesen den Eindruck gewinnt, dass sich "Blut und Feuer" mit seiner Unzahl von Personen und Ereignissen geradezu als Vorlage aufdrängen möchte. Ein paar verwertbare Zitate würden die wenigen Stellen, an denen direkte Rede vorkommt, auch gleich mitliefern: "Ich habe Eure Töchter gesehen. Sie haben kein Kinn, keine Brüste und keinen Verstand." Brautschau nach Westeros-Etikette ...
Wälzer wie dieser und der Bildband "Westeros" sind nur die Prunkstücke in einer Fülle an Begleit- und Sekundärliteratur zum "Lied von Eis und Feuer". Einer Fülle, die längst dieselben Ausmaße angenommen hat wie die Verwertung all dessen, was J. R. R. Tolkien jemals rund um Mittelerde geschrieben hat. Der Vorteil im Fall G. R. R. Martins ist freilich, dass hier nicht ein begrenzter Nachlass immer wieder neu aufbereitet wird, sondern tatsächlich Neues geschaffen wird. Martin muss nur aufpassen, dass dieser Vorteil nicht irgendwann zum theoretischen wird und er sich mit solchen Titeln buchstäblich verzettelt (ich würde gerne mal sein Namensregister sehen, das muss mittlerweile tausende von Personen umfassen). Immerhin ist immer noch der Abschluss seines Kernwerks ausständig: Das ist der einzige Wermutstropfen, der die Freude über Nebenschöpfungen wie diese hier trübt.
Byebye, 2018
Die nächste Rundschau, irgendwann im Jänner, wird das traditionelle Jahres-Best-of sein. Zu bereits Vorgestelltem gesellen sich dann wie immer einige Titel, die noch nicht besprochen wurden und die ich mir in der Hoffnung beiseite gelegt habe, dass sie ung'schaut zu den besten zählen. Die nächsten Lesewochen werden zeigen, ob ich mich bei dem einen oder anderen Titel verpokert habe. Der Rundschau-Lesezirkel kann jedenfalls schon mal Neal Stephensons "Der Aufstieg und Fall des D.O.D.O." und Hannu Rajaniemis "Summerland" ins Visier nehmen. (Josefson, 22. 12. 2018)
________________________________
Weitere Titel
Überblick über sämtliche bisher rezensierten Bücher