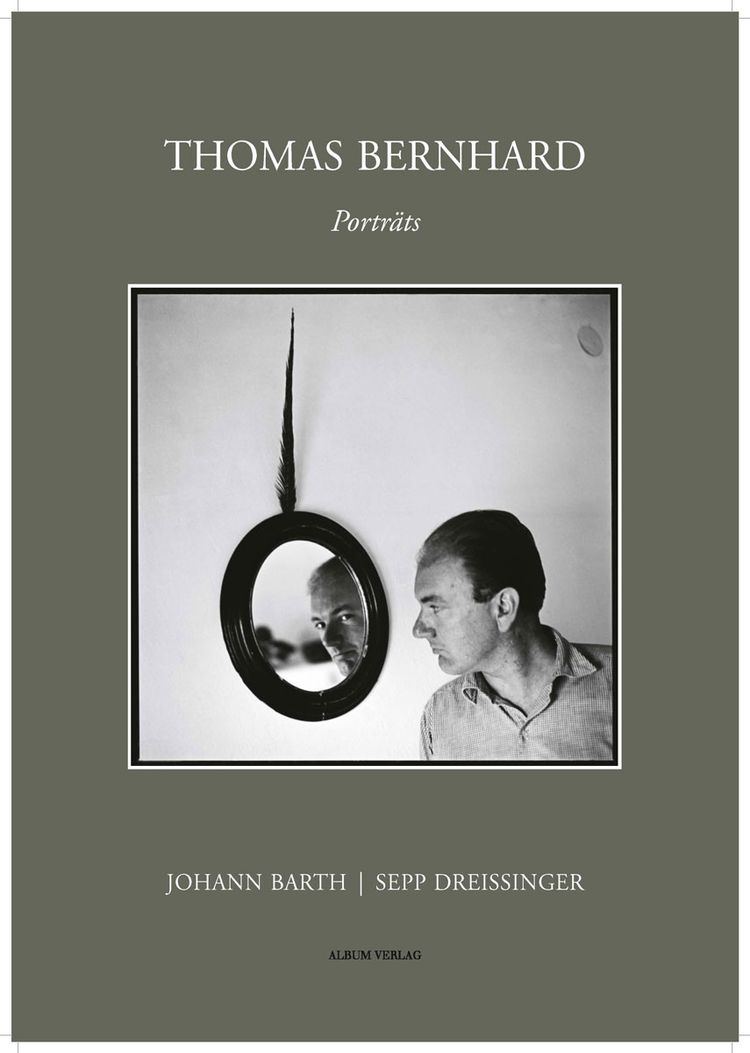
Sepp Dreissinger, geb. 1946 in Vorarlberg, lebt als Fotograf und Autor in Wien. Von ihm erschien u. a. "Was reden die Leute. 58 Begegnungen mit Thomas Bernhard" (Müry Salzmann, 2011) und jetzt "Immer noch Frost" (Album-Verlag, 2019).
Thomas Bernhard über Thomas Bernhard
Aus einem Gespräch mit Kurt Hofmann und Sepp Dreissinger in Obernathal 1981
Ich habe nie an Form gedacht. Die hat sich ganz normal ergeben, wie ich halt bin und schreibe. Vor dem Frost hat es in dieser Art im Grunde wirklich nichts gegeben, das war damals so eine erstmalige Art, so zu schreiben. Die Literatur nach dem Krieg, also bis dahin, die war ja orientiert an der berühmten Literatur quasi, die aus Amerika und England und Frankreich gekommen ist. Und damals haben die bekannten Schriftsteller ja, außer Nazidichtern, Nazidichter unter Anführungszeichen, immer Romane geschrieben, die in Oklahoma gespielt haben oder in New York. Kein Mensch ist auf die Idee gekommen, dass er das beschreibt, wo er lebt und wo er aufgewachsen ist und wovon er wirklich etwas weiß.
Die Hauptfiguren in den Romanen damals waren immer irgendein Joe oder eine Miss Temple oder Plemple oder Plample, und damit war die Literatur, die damals in den ersten 15 Jahren nach dem Krieg geschrieben worden ist, ein völliger Scheißdreck, nichts wert und nur eine blinde, billige Nachäffung der Amerikaner, die man halt da bei uns gelesen hat. Und nachdem die Riesenauflagen gehabt haben und weltberühmt waren, haben die anderen Schriftsteller hier geglaubt, sie müssen auch so schreiben, damit sie dann mit einem Cadillac herumfahren können, aber sie haben nur die Literatur beschmutzt und haben auch nie einen Cadillac besessen.
Es war also völlig sinnlos. Ich habe schon auch Formen benützt, die ich mir angelesen hatte, aber nicht auf Joe und Miss Temple, sondern zum Beispiel von französischen Surrealisten. Da war ich so begeistert von dem Julien Gracq und solchen Leuten, die damals berühmt waren, die aber heute völlig von der Bildfläche verschwunden sind.

Ich hab dann den Frost geschrieben, und so ist es. Schluss. Ohne viel Denken. Habe aber doch, als es dann fertig war, das Gefühl gehabt, dass das etwas ist, was noch niemand gemacht hat und das mir auch keiner nachmachen wird. Es ist ganz sicher ganz bewusst in einer Art so geschrieben, dass man das in hundert Jahren auch noch lesen kann, weil die Sprache so ist, dass sie im Grunde nicht veralten kann.
Die Themen veralten, das weiß man ja, sie sind einmal vorne und einmal hinten. Dass jahrzehntelang die Leute halt keinen Hamsun oder was lesen, aber dann kommen sie doch irgendwann wieder. Das passiert ja mit allen Leuten. Das kennen Sie ja auch aus dem persönlichen Gebrauch, dass man eine Zeitlang Kaviar isst und nach drei Wochen dem ein Ende macht, ein jähes, und dann Speckwurst isst, jahrelang. Kaviar kommt aber doch immer wieder, wenn auch nur kurz.

Und wie das Buch dann erschienen ist, ist es ja hier sowieso völlig abgelehnt worden, und da weiß ich noch: Leute, die heute noch fest drauflosschreiben, haben alle geschrieben: Das ist eine Talentprobe, da werden wir nie mehr wieder etwas hören von diesem Jüngling da aus Salzburg oder so ähnlich. Na ja, könnte auch sein, ist ja egal, jeder kann ja schreiben, was er will. Auf jeden Fall, ermutigend war es nicht, wenn nicht draußen in Deutschland ein paar Kritiken erschienen wären, die in sich auch blöd waren, aber groß aufgemacht, wäre das ja vielleicht schiefgegangen.
Das Ganze war ja auch ins Blaue geschrieben. Ich kann mich noch erinnern, in der Zeit war eine ganze Seite – das gibt es ja heute gar nicht mehr –, eine Kritik vom Zuckmayer, aber verkauft haben sie, glaube ich, nur 3000 Stück. Also das hat ja auch überhaupt keinen Einfluss im Grunde. Und der Chef beim Insel-Verlag hat nachher zum Wieland Schmied gesagt – der hat ihm so ein Loch in den Bauch geredet, dass er das Manuskript unbedingt annehmen muss: "Na, aber so gut, wie Sie mir das damals geschildert haben, ist das Ganze ja gar nicht." Also so Scherze halt. Und dann sitzt man da und sieht diese Kritiken und das Buch, und dann weiß man auch nicht mehr: Wie ist das Buch? Ist das überhaupt etwas?
Dann hab ich jahrelang gar nichts mehr geschrieben. Ich hab mir gedacht, das gehört alles vergessen und weggeschmissen, und das ist alles nix.

Halbbruder Peter Fabjan über Bernhard
Aus einem Gespräch mit Sepp Dreissinger in Obernathal, 2012
Ich selber habe mit der Entstehung von Frost ja, wenn überhaupt, nur insofern etwas zu tun, als ich im Februar 1962, wie auch die Jahre davor, zur Famulatur im Krankenhaus Schwarzach war. Thomas Bernhard war zu dieser Zeit ebenfalls in St. Veit – einem Ort, den er immer wieder nach seinen jahrelangen Behandlungen in den Heilstätten da oben besucht hat –, und wir haben uns öfter im Café Haller getroffen, einem Kaffeehaus unmittelbar neben dem Krankenhaus von Schwarzach im Pongau.
Dort habe ich ihm dann meine Erlebnisse erzählt. Ich habe einfach drauflosberichtet, was ich auf der Chirurgie beim Bauchaufschneiden erlebt habe, was dort überwiegend meine Beschäftigung war, der Primarius war ja Bauchchirurg. Mich hat das damals enorm beeindruckt, so wie immer jungen Menschen Dinge, die vielleicht auch schrecklich sind, wie zum Beispiel Kriegserlebnisse, als ein Abenteuer erscheinen.
Für uns Kinder waren die Erzählungen unseres Onkels von seinen Kriegserlebnissen in Norwegen, selten auch vom Vater, seinerseits wiederum in Jugoslawien, hochspannende Abenteuergeschichten. Und dieses Bauchaufschneiden war für mich, so ähnlich wie eben im Studium die Anatomie, die Pathologie, sehr aufregend, aber auch belastend. Es war natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir die ganzen Jahre zuvor – wir, da meine ich jetzt vor allem auch meine Schwester und eben den Thomas, der ja doch sieben Jahre älter war als ich und das noch einmal ganz anders erlebt hat – in der Familie erfahren haben.
Unsere Familie hat ja in einer Fantasiewelt gelebt. Wir waren absolut keine normale Familie. Wenn man dann in diese Realität, wie eben zum Beispiel in die Medizin, hineingestoßen wird, dann ist das ein unglaublicher Kontrast, der einen auch sehr beeindruckt wie ein riesiges Abenteuer. Das waren dann Tage und Stunden, die man im Operationssaal neben dem Chirurgen und seinem Assistenten stehen und dort den Bauch offen halten und absaugen musste.
Viel durfte man ja nicht tun, man war ja eine statische Figur dort, aber auch wichtig, damit der Operateur seine Arbeit machen konnte. Und das hat meinem Bruder dann in diese Konstruktion, in diese Komposition von Frost, als Beginn gepasst. Aber was bei ihm dann herauskommt, also wie meine Erzählung wiederum auf ihn gewirkt hat, dabei ist nicht das Detail interessant, sondern die Situation. Wenn er schreibt, dass ein amputiertes Bein, oder was auch immer, über den Rücken in den Kübel geworfen wird, das ist eben dazu da, um die Drastik darzustellen. So läuft etwas Derartiges natürlich nie ab, allenfalls vielleicht unter Kriegsverhältnissen.
Das war mein Anteil. Wobei ich mich erinnere, dass Thomas, als er einmal darauf angesprochen wurde, dass das, was der Bruder, also ich, ihm erzählt hätte, ja offensichtlich der Anlass für diesen Beginn von Frost gewesen wäre, dies heftig bestritten hat. Dies sei Unsinn, weil er ja immer aus der Realität etwas Fiktives mache und er als kreative Persönlichkeit es als seine Sache sehe und nicht als etwas, wo er von jemand anderem etwas übernehme und das so hinschreibe. Insofern stimmt seine Version, aber natürlich haben ihn meine Erzählungen angeregt.

Bürgermeister Richard Donauer über Bernhard
Aus einem Gespräch mit Sepp Dreissinger in St. Veit, 2012
Thomas Bernhard ist in unsere Pension Dopplerhof in St. Veit durch Hedwig Stavianicek gekommen, die ihn Mitte der 1950er-Jahre als Gast mitgebracht hat. Vorher war mir der Name Bernhard nicht bekannt. Er war aber schon früher eine Zeitlang als Patient in der Lungenheilanstalt Grafenhof in St. Veit. Für mich war das Verhältnis zwischen beiden immer wie ein Verhältnis zwischen Ziehsohn und Ziehmutter. Frau Stavianicek war eine vermögende, kinderlose Ministerialratswitwe aus Wien, die Thomas Bernhard als Patient in der Lungenheilanstalt Grafenhof in St. Veit über Anna Janka kennengelernt hat.
Anna Janka, gebürtig aus Görz, heutiges Gorizia, kam wegen ihrer TBC-Erkrankung 1944 nach Grafenhof, wo zur selben Zeit auch Hedwig Stavianicek Patientin war. Anna Janka ist wegen ihres Lungenleidens in St. Veit hängengeblieben und hat die Stelle der Organistin in der Pfarrkirche St. Veit angenommen. Sie hat Thomas Bernhard schon bei seinem ersten Aufenthalt in der Lungenheilstätte Grafenhof Gesangsunterricht gegeben. Über Anna Janka kam schließlich auch die Bekanntschaft von Frau Hedwig Stavianicek mit Thomas Bernhard zustande.
Er kam bis Ende der 1970er-Jahre jedes Jahr, manchmal auch zweimal im Jahr zu uns nach St. Veit auf Besuch; zuerst hat er sich bei meinen Eltern, später dann hier bei mir und meiner Frau im Dopplerhof einquartiert. Bernhard und Stavianicek haben immer im Zimmer gefrühstückt, was eher ungewöhnlich war. Normalerweise sind alle unsere Gäste immer in den Frühstücksraum gekommen und haben sich dort unterhalten. In dieser Hinsicht haben sich die beiden immer abgesondert. Das ging aber, glaube ich, weniger von Bernhard als von Frau Stavianicek aus. Bei uns in der Pension hatten sie mit den anderen Gästen kaum Kontakt. Bernhard hat aber wenigstens gegrüßt. Über Stavianicek haben sich die anderen Gäste oft beschwert: Die Dame sei so unfreundlich und hochnäsig und sage nichts.
Bis Anfang der 1970er-Jahre waren sie miteinander per Sie und haben meistens in der dritten Person miteinander gesprochen. Sie hat gesagt: "Thomas, komme Er endlich! Was macht Er denn so lange? Warum geht Er nicht schneller?" Hedwig Stavianicek war 1894 geboren, und damals war diese Anrede in besseren Kreisen üblich. Sie hat auch ihren Mann gesiezt. Uns Jungen ist das damals natürlich eigenartig vorgekommen.
Sie hat ihn auch finanziell gefördert, da bin ich mir ganz sicher. Womit hätte er sonst das Studium am Mozarteum bezahlt? Er hat zwar als Reporter bei der Zeitung gearbeitet, wurde aber dadurch nicht so vermögend, dass er viel auf die Seite legen und studieren hätte können. Wenn Frau Stavianicek in St. Veit war, ist Bernhard jeden Tag ins Altenheim gegangen, um dort Anna Janka zu treffen. Dort hat sich Bernhard auch oft mit den Leuten unterhalten, obwohl das ganz einfache, zum Teil grenzdebile Leute waren. Der Maler Rudolf Holz und Anna Janka, die übrigens auch eine ausgebildete Klavierlehrerin war, waren die Ausnahme. Sie waren die einzig "halbwegs Gebildeten" dort.
Wenn er mit seinem Bruder Peter Fabjan und Hedwig Stavianicek bei uns auf der Terrasse Kaffee getrunken hat, hat er Witze erzählt wie jeder andere auch. Da wäre man nie auf den Gedanken gekommen, dass das der Gleiche ist, der Frost schreibt oder Auslöschung oder Heldenplatz. Fast jedes Theaterstück oder jeder Roman endet ja mit einem Suizid. Wenn er besonders gut aufgelegt war, hat er auch das Duett von Papagena und Papageno aus der Zauberflöte gesungen, und zwar beide Rollen, die Papagena mit der Kopfstimme.
In seiner Zeit als Urlaubsgast, von Mitte der 1950er-Jahre bis 1979, hat Bernhard auch in der Pfarrkirche von St. Veit regelmäßig im Kirchenchor gesungen. Frau Stavianicek war meist hier als Gast zwischen drei und sechs Wochen. Bernhard war in etwa gleich lang hier, allerdings, wenn er ein Telegramm oder einen Anruf bekommen hat, fuhr er wieder für eine Woche weg. Durchgehend war er etwa 14 Tage hier. Zu den Weihnachtsfeiertagen waren sie auch fast immer da, und dann hat er auch gesungen. Er hat vorher in Einzelstunden mit Anna Janka geprobt. Stimmmäßig und ausbildungsmäßig war er uns natürlich weit überlegen. Für den Gottesdienst war das sicher eine Bereicherung. Er hat einen wunderschönen Bass gehabt. Er hat oft ein Solo in der Kirche gesungen.

Schriftsteller Peter Henisch über Bernhard
Aus einem Gespräch mit Sepp Dreissinger in Wien, 2017
Im Jahre 1963, als Frost erschienen ist, war ich zwanzig und Lokalreporter bei der Arbeiter-Zeitung. In der Auslage einer Buchhandlung auf der Wiedner Hauptstraße, gegenüber der Paulanerkirche – das weiß ich noch genau –, hab ich das Buch, erschienen im Insel-Verlag, das erste Mal gesehen. Schon das Cover hat mich sofort angesprochen, und dieses einzige Wort als Titel, Frost, das war sehr suggestiv. Zu diesem Zeitpunkt war mir der Name Thomas Bernhard noch kein Begriff, aber es war ein gut klingender Name. Ich bin in die Buchhandlung gegangen und habe mir das Buch gekauft.
Ich hab mich damit auf eine Bank im Resselpark gesetzt, obwohl es kalt war. Und kaum hatte ich es aufgeschlagen, war ich in dieses Buch hineingefallen. In Frost findet man schon die Atmosphäre, den Ton, den Duktus vieler weiterer Bücher von Thomas Bernhard. Aber hier war das alles noch frisch, noch nicht – wie später – Manier. Bernhard hat sich später öfter selbst kopiert – aber okay, der konnte das. Viele Autoren, die anfingen so zu schreiben wie Thomas Bernhard, konnten das nicht ganz so gut, und selbst wenn sie es sehr gut konnten, wirkten ihre Texte eben wie Kopien.
Wenn man Bernhard liest, ist es sehr schwer, diesen Tonfall nicht zu übernehmen. Es geht einem dann ein bisschen so, wie wenn man eine Zeitlang in einem anderen Land ist und die dort gesprochene Sprache noch nicht perfekt beherrscht. Man assimiliert sich, man übernimmt den Akzent, den Rhythmus und den Tonfall der Region, in der man sich aufhält. Naturgemäß, hätte Thomas Bernhard gesagt. So ergeht es einem nicht nur bei der Lektüre von Bernhard, sondern auch bei der Lektüre von Thomas Mann oder Heimito von Doderer. Die ziehen einen in ihre Sprache hinein.
Man kann sich ihrer Sprache schwer entziehen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich vom Einfluss Thomas Bernhards lösen konnte. Ich hab also Frost mit glühenden Wangen gelesen, und dann, glaube ich, Amras. Und dann wurde meine Faszination für diese Texte noch durch einen italienischen Literaturwissenschafter bestätigt, den Professore Villari, der einen Italienischkurs im österreichischen Fern sehen gemacht hat. Von der Arbeiter-Zeitung hab ich den Auftrag bekommen, ihn und seine nette junge Assistentin zu interviewen. Und nach dem Interview haben wir noch ein bisschen geplaudert, und da fragt er mich, ob ich Bernhard kenne, von dem er gerade ein Buch übersetzt, nämlich Frost, und kommt richtig ins Schwärmen. Was dieser Autor schafft, sagt er, ist eine eigentümliche Annäherung von Literatur und Philosophie – und ich hab damals noch Philosophie studiert, also hat mich dieser Aspekt interessiert.
Persönlich begegnet bin ich Bernhard erst ein paar Jahre später, da war meine Faszination für seine Bücher schon etwas abgeklungen. Das war vor dem Handelsgericht. Da ging es um den Prozess zur Premiere von Der Ignorant und der Wahnsinnige bei den Salzburger Festspielen. Das Licht wurde nicht abgedreht, so wie es in der Regieanweisung steht – es sollte totale Finsternis herrschen, da hätte auch das Notlicht im Saal nicht brennen dürfen. Bernhard hat geklagt, hat die Klage dann wieder zurückgezogen. Die Salzburger Festspiele aber haben sich dadurch geschädigt gefühlt.
Ich habe damals gelegentlich fürs Profil geschrieben, und die haben mich zum Prozess im Handelsgericht geschickt. Und da war auch die Hilde Spiel, die hat mich dem Thomas Bernhard vorgestellt. Und da, als wir uns die Hände geschüttelt und uns in die Augen gesehen haben, war ich überrascht. Da hatte ich nämlich das Gefühl, dass dieser Bernhard nicht oder jedenfalls nicht nur der tragikumwitterte Typ war, den ich mir nach der Lektüre von Frost und dann Verstörung vorgestellt hab. Er hat dreingeschaut wie jemand, der unter der Haut lächelt oder schmunzelt, in seinem Blick war etwas Schalkhaftes. Später habe ich auch in seinen Büchern einiges von dieser Schalkhaftigkeit entdeckt. In Frost ist allerdings nichts davon, in Frost gibt es nichts zu lachen. Es ist ein unglaublicher Wurf, dieses frühe Buch. (Sepp Dreissinger, Album, 11.2.2019)