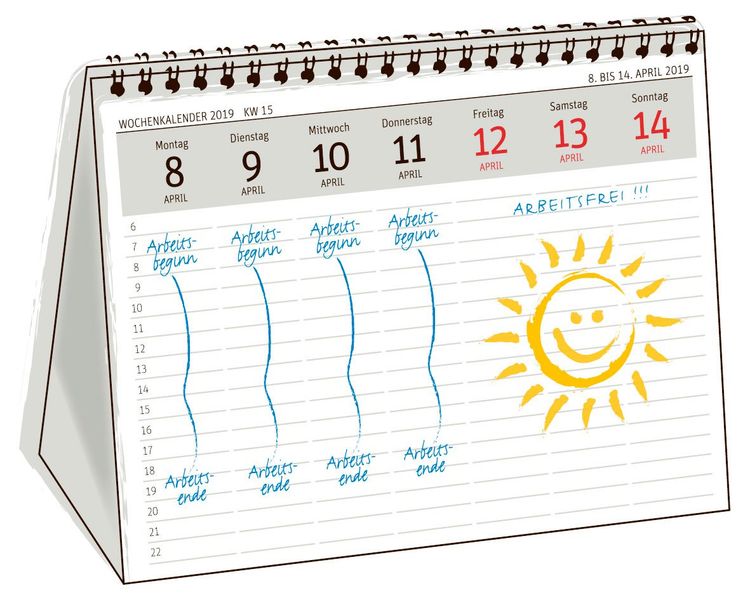
Die Viertagewoche birgt juristische Stolpersteine.
Es war ein zentrales Verkaufsargument im letzten Herbst: Mit den neuen Höchstarbeitszeitgrenzen – zwölf Stunden pro Tag und 60 Stunden pro Woche – hätten Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre gesamte wöchentliche Arbeitszeit an vier Tagen zu verbrauchen.
Das war freilich schon vor der Novelle möglich, und zwar auf Basis einer Betriebs- oder Einzelvereinbarung. Bei einer solchen Verteilung der Arbeitsstunden auf vier Tage fallen erst ab zehn Stunden pro Tag Überstunden an.
Die Flexibilisierung der Arbeitszeit bewirkte allerdings, dass durch neue Gleitzeitvereinbarungen die (überstundenfreie!) Normalarbeitszeit von zehn auf zwölf Stunden pro Tag ausgedehnt werden kann. Dadurch wird das Versprechen einer Viertagewoche sogar überfüllt – die neue Gleitzeitregelung ermöglicht sogar eine überstundenfreie 3,5-Tage-Woche, zum Beispiel Montag bis Mittwoch jeweils zwölf Stunden, am Donnerstag nur mehr vier Stunden.
Voraussetzung für ein solches Modell ist lediglich, dass die neue Gleitzeitvereinbarung den Verbrauch ganzer Gleittage im Zusammenhang mit der wöchentlichen Ruhezeit zulässt.
Innovationen aus der betrieblichen Praxis
Die Bedeutung der Viertagewoche wurde in diesem Jahr auch durch den neuen Handelskollektivvertrag weiter gestärkt: Dieser sieht für die ca. 400.000 Handelsangestellten vor, dass diese eine Viertagewoche außer bei Gefährdung von Betriebsabläufen oder des Geschäftsbetriebs einseitig durchsetzen können. In allen anderen Branchen hängt die Einführung einer Viertagewoche nach wie vor von der Zustimmung des Arbeitgebers ab.
Wirklich innovative Ansätze für eine Viertagewoche ergeben sich allerdings nicht aus dem neuen Arbeitszeitgesetz, sondern aus der betrieblichen Praxis. In letzter Zeit haben etliche Unternehmen auf sich aufmerksam gemacht, indem sie die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter erheblich verkürzt haben – etwa auf 30 Stunden – und dafür vollen Lohnausgleich gewähren. Im Gegenzug verpflichten sich die Mitarbeiter zu einer deutlich fokussierteren Arbeitsweise.
Niedrigeres Mindestgehalt
Auch wenn ein derartiges Vorhaben auf den ersten Blick verlockend klingt, liegt auch hier der Teufel im Detail. Wenn nämlich Mitarbeiter zwar das Gehalt eines Vollzeitbeschäftigten (den "Lohnausgleich") erhalten, die wöchentliche Normalarbeitszeit aber vertraglich herabgesetzt wird, macht sie dies juristisch zu Teilzeitbeschäftigten.
Und das bedeutet, dass sich trotz gleichbleibenden Ist-Gehalts das kollektivvertragliche Mindestgehalt entsprechend reduziert. Wenn fallweise doch länger gearbeitet werden muss, fallen damit aber keine "Überstunden", sondern bloß "Mehrarbeitsstunden" mit einem niedrigeren Zuschlag (25 statt 50 Prozent) an.
Zumindest so lange, als die – für Teil- und Vollzeitbeschäftigte gleichermaßen geltende – überstundenrelevante Grenze von 40 Stunden pro Woche nicht überschritten wird.
Bei All-in-Verträgen würde das niedrigere Mindestgehalt zusätzlich dazu führen, dass bei der jährlich durchzuführenden Deckungsprüfung ein wesentlich höherer Gehaltsanteil zur Abdeckung von Mehrleistungen zur Verfügung stünde und entsprechende Nachzahlungen für Mitarbeiter in (noch) weitere Ferne als bisher rückten.
Im Extremfall könnte dieses Modell also dazu führen, dass Mitarbeiter, die (zumindest zeitweise) gleich viel wie Vollzeitbeschäftigte arbeiten, insgesamt weniger Geld bekommen.
Eine arbeitnehmerfreundlichere Gestaltung wäre es, Mitarbeiter auf dem zeitlichen Status der Vollzeitbeschäftigung zu belassen, die verbleibende Arbeitszeit auf vier Tage zu verteilen und den Mitarbeitern in einem bestimmten Ausmaß bezahlte Freizeit zu gewähren – zum Beispiel zehn Stunden pro Woche.
Bedenken sollten Arbeitgeber allerdings, dass bei diesem Modell Mitarbeitern der volle Urlaubsanspruch von 25 Arbeitstagen zusteht. Da die Mitarbeiter aber aufgrund der bezahlten Freizeit nur vier Urlaubstage für eine volle Woche Urlaub benötigen, käme es faktisch zu einer Urlaubsverlängerung.
Minusstunden verfallen
Juristisch ließe sich die Ausdehnung der Freizeit in vielen Fällen einfach abbilden: Bei Gleitzeitverträgen oder anderen Durchrechnungsmodellen müsste lediglich vereinbart werden, dass eine bestimmte Anzahl von Minusstunden am Ende einer Durchrechnungsperiode verfällt – und somit nicht zu einem Gehaltsabzug führen. So wären die Mitarbeiter in allen Belangen als Vollzeitbeschäftigte zu behandeln.
Wie auch immer Unternehmen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter reduzieren: Bei vollem Lohnausgleich handelt es sich um eine kostspielige Variante, die wahrscheinlich nicht in allen Branchen realistisch ist und sicherlich nur bei besonders motivierten Mitarbeitern auf lange Sicht eine Erfolgsstory sein kann. (Philipp Maier, 8.4.2019)