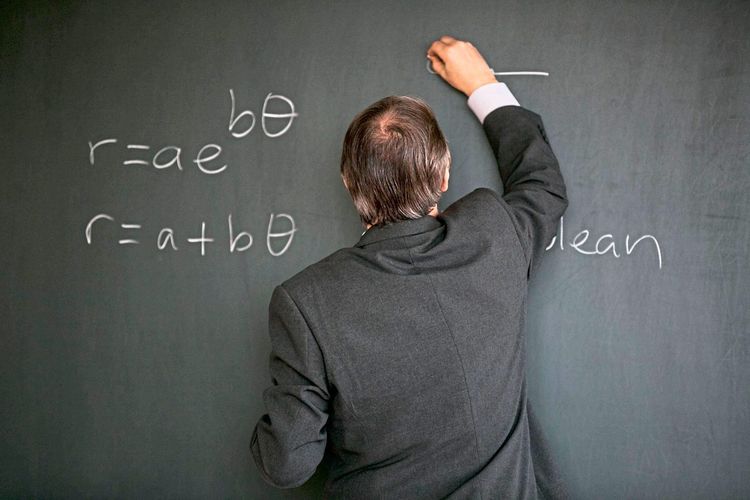
- Viel Gewalt in Frankreichs Schulen, kaum eine Reaktion
Gewalt in der Schule ist in Frankreich ein Alltagsthema. Die Zahl der einzelnen Akte nimmt zwar statistisch gesehen nicht zu; die Vorkommnisse werden aber aufsehenerregender und gewalttätiger – und zudem häufiger publik. So war es im Herbst 2018, als im Pariser Vorort Créteil ein Mittelschüler einer Lehrerin eine Pistolenattrappe an den Kopf hielt, um sie zu zwingen, ihn trotz seines Zuspätkommens ins Präsenzheft einzutragen – DER STANDARD berichtete.
Der über Handys verbreitete Vorfall bewirkte mehrere Zehntausend Reaktionen von Lehrern, die ihrerseits Fälle von Belästigung, verbaler oder physischer Gewalt beschrieben.
Lehrer an Berufsmittelschulen sind dabei am stärksten betroffen. Sie werden auch von Eltern angegriffen. In Béziers stürzte sich ein Ehepaar dieses Jahr in einem Schulkorridor auf einen Lehrer und malträtierte den am Boden Liegenden mit Faustschlägen und Fußtritten, weil er ihren Sohn bestrafen wollte.
Die Regierung in Paris stellte nach der Pistolenattacke einen Plan gegen Schulgewalt in Aussicht. Seit vergangenem Oktober musste Bildungsminister Jean-Michel Blanquer die Präsentation aber schon viermal vertagen. Der Entzug der Sozialhilfe für Eltern gewalttätiger Schüler – der Hauptpunkt des Plans – ist auch im Regierungslager der Macron-Partei LRM äußerst umstritten.
Die Streichung der Sozialhilfe war in Frankreich schon 1959 erstmals – damals gegen chronische Schulschwänzer – versucht worden. Richtig durchgesetzt hat sich die Maßnahme bis heute nicht.
Viel weniger thematisiert sind in Frankreich Fälle von Lehrergewalt. Auf der Webseite Magicmaman berichten aber auch Eltern über sadistische Pädagogen. Eine Lehrerin legte zum Beispiel einer Schülerin mit Spinnenphobie eine tote Spinne hin und sprach dann, als die Schülerin in Tränen ausbrach, eine Strafe wegen Störung des Unterrichts aus. Eine andere erniedrigte eine Schülerin bis zu Tränen und verordnete darauf eine "Weinminute" für die amüsierte Klasse. (brä)
- Der "Problemschüler", den es in Schweden nicht gibt
Klagen über Respekt- und Disziplinlosigkeit im Klassenzimmer prägen Schwedens Schuldebatte seit langem. Was in den 1960er-Jahren mit der Betonung von Schülerrechten hoffnungsvoll begann, liest sich in einer OECD-Studie von 2015 so: Schwedische Schüler überschätzen systematisch die eigene Leistung, und im OECD-Vergleich gehören sie zu den Schlusslichtern in Sachen Disziplin.
So kommen nirgendwo anders Kinder und Jugendliche so häufig zu spät zum Unterricht. Eine Studie der schwedischen Schulaufsicht von diesem Frühjahr belegt wachsendes Unbehagen in einem unruhigen Lernumfeld. Betroffen sind vor allem Mädchen: Nur noch vier von zehn befragten Schülerinnen empfinden die Schule als "sicheren Ort".
Trotz politischer Einigkeit über entsprechenden Handlungsbedarf sei ein Ende der Misere nicht absehbar, kommentierte der Gymnasiallehrer Isak Skogstad den Behördenbericht in Göteborgs-Posten. In Schwedens Schule mit ihrer "destruktiven Kultur des Beleidigtseins", in der Zurechtweisungen als Kränkung empfunden und teils gar mit Anzeigen geahndet würden, fehle den Erwachsenen nämlich oft der Mut, das Problem an der Wurzel zu packen, sprich: Störenfriede als solche zu benennen und in die Schranken zu weisen.
Auch in der öffentlichen Debatte glänzt "der Problemschüler" im Wesentlichen durch Abwesenheit. "Schuld ist per definitionem niemals der Schüler, sondern immer die Schule", umreißt Expressen ein Problem, das Gesamtgesellschaftliches widerspiegelt: Persönliche Verantwortung einzufordern ist in Schweden nicht populär und gegenüber Heranwachsenden fast tabu.
Im Zuge von Reformen in den 1990er-Jahren hat der Staat die Verantwortung für die Schule an die Kommunen abgetreten. Mit dem Entstehen vieler aus öffentlichen Mitteln finanzierter Schulunternehmen sind Lehrer zu Dienstleistern und Schüler und Eltern zu Kunden geworden. Dies reduziere die Lehrerautorität zusätzlich, so Kritiker. (ren)
- In Berlin sollen Lehrer auch mal zur Trillerpfeife greifen
In Berlin ist die Zahl der gemeldeten Gewalttaten stark gestiegen: von 1468 im Schuljahr 2010/2011 auf 3975 im Schuljahr 2016/17. Vor allem aus Grundschulen (Volksschulen) werden immer mehr Vorfälle angezeigt.
Politiker und Experten gehen aber davon aus, dass nicht die Gewalt selbst so sehr zugenommen hat, sondern dass die Schulen bei diesem Thema achtsamer geworden sind und mehr informieren als früher.
Bildungssenatorin Sanda Scheers (SPD) hat die Gründe, warum Lehrer in Berlin Meldung von ihren Schulen machen, abfragen lassen. Am häufigsten wurde genannt: "Schulen benötigen mehr Unterstützung als früher." Und: "Wir sind in Bezug auf Gewaltvorfälle sensibler geworden."
Scheers will jetzt das Meldeverfahren verbessern. Derzeit ist Cybermobbing nicht ausreichend erfasst, zudem ist oft nicht klar, wer zuständig ist – das Jugendamt, die Schulaufsicht oder Schulpsychologen. In Deutschland ist Bildung Ländersache, daher schauen die Bundesländer auch über den eigenen Tellerrand, in diesem Fall von Berlin nach Hamburg. Dort gibt es eine zentrale Stelle für Gewaltmeldungen. Und in Berlin will man nun auch das Online-Meldeverfahren einführen. Bisher mussten die Schulen faxen.
Wie die Schulen reagieren sollen, wenn Schüler über die Maßen aggressiv sind, wird in Berlin in einem eigenen Notfallplan geregelt. Als allererste Maßnahme wird "Polizei verständigen" genannt. Wenn es dem Lehrpersonal möglich ist, soll es auch selbst eingreifen und dazu "deutliche Stoppsignale" aussenden.
Dazu gehört gemäß dem Leitfaden nicht nur die Aufforderung "Hört sofort auf! Auseinander!", sondern es wird zudem geraten: "Auch Trillerpfeife benutzen". Des Weiteren wird den Lehrerinnen und Lehrern die Schlichtung aufgetragen. Sie sollen Zuschauer wegweisen, Sichtkontakt zwischen den Kontrahenten unterbinden und klare und deutliche Anweisungen geben. Eine davon lautet: "Geht sofort in eure Klassenzimmer!" (bau)
- Japans Schüler treten vermehrt den Rückzug an
Japan geht auf schwierige Kinder mit einer gänzlich anderen Erziehungskultur ein: Während westliche Länder Kinder ermutigen, ihren Willen auszudrücken und durchzusetzen, werden Japaner früh dazu erzogen, sich zurückzunehmen und mit ihren individuellen Bedürfnissen niemanden zu belästigen. In der Schule lernen die Kinder, sich nicht zu melden, damit der Unterricht glatt läuft. Das oberste Gebot fürs Miteinander lautet Harmonie.
Doch einige Kinder schaffen es nicht, ihr Selbst zu unterdrücken und sich in ihre Gruppe einzufügen. Sie fühlen sich als Außenseiter und fallen häufig dem Mobbing ihrer Mitschüler zum Opfer. Viele dieser Kinder stören den Unterricht nicht aktiv, sondern boykottieren ihn still.
Für ihre spezielle Betreuung fehlt den Pädagogen bei Klassengrößen von oft mehr als 30 Schülern die Zeit. "Das ist einfach nicht zu schaffen", berichtete die Lehrerin Sayuri Hatsumoto. Ihr eigenes Versagen nahm sie so stark mit, dass sie ihre Lehrerstelle kündigte.
Einige Problemkinder haben eine Lese- und Rechenschwäche, zeigen autistische Symptome oder sind hyperaktiv. Mädchen ritzen sich, Jungs verlieren sich oft in Videospielen. Viele solcher Kinder brechen die Schule ab und schließen sich als sogenannte Hikikomori in ihrem Zimmer zu Hause ein. Bei 40 Prozent der 541.000 Hikikomori im Alter unter 39 begann der Rückzug aus der Gesellschaft während der Schulzeit. Eine wachsende Zahl von Kindern reagiert mit Suizid. 2017 waren es 250 Schüler, in Relation zur gesamten Schülerzahl gesehen so viele wie noch nie.
Seit drei Jahren verlangt ein neues Gesetz von den öffentlichen Schulen, dass sie mit "vernünftiger Überlegung" auf Kinder mit Entwicklungsstörungen eingehen. Aber bisher hat sich dieser Gedanke noch nicht richtig verbreitet. Als häufigste Lösung steckt man die Kinder in eine andere Klasse und spricht mit den Eltern. Als letzte Antwort bleibt die Sonderschule für Menschen mit Behinderung. Das stempelt Problemkinder für den Rest ihres Lebens ab. (maf, 15.5.2019)