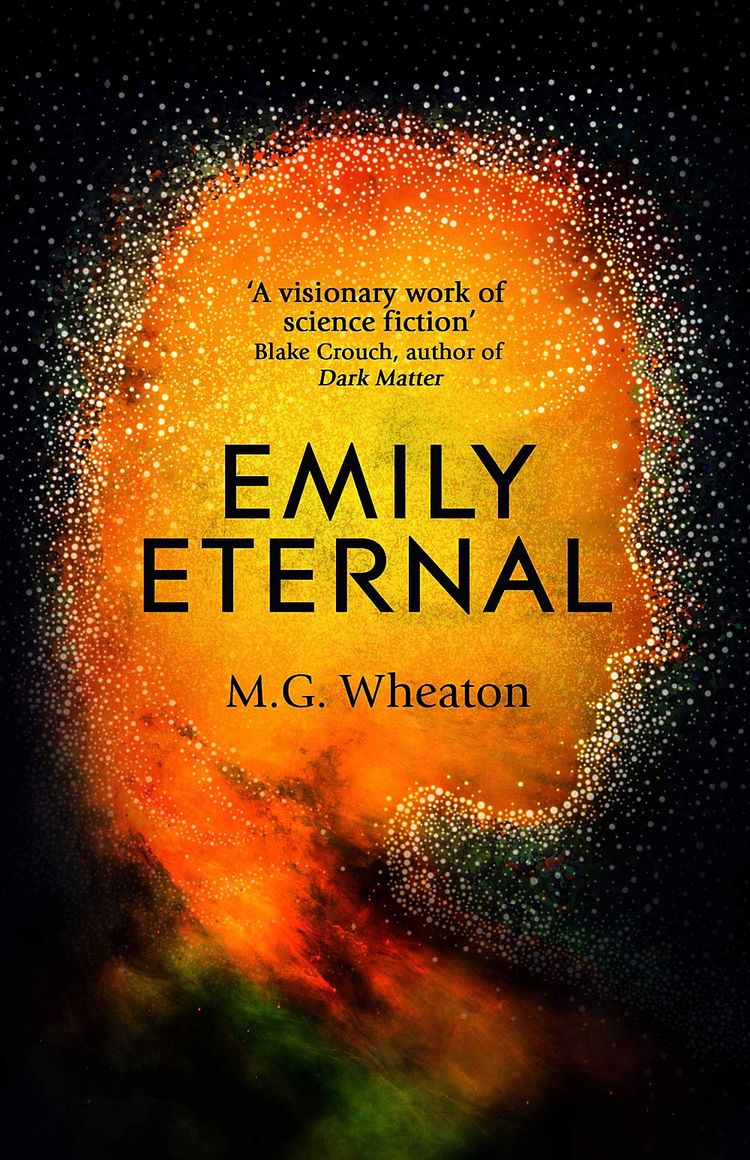
Einige interessante Ideen, und diese nicht richtig durchdacht: So könnte man "Emily Eternal" zusammenfassen, mit dem sich der Texaner Mark G. Wheaton nach Game-Writing und Drehbüchern auch mal mit einem Roman versucht hat.
Der Plot
Kurz zur Handlung: Der Erde bleiben nur noch einige Monate, denn die Sonne hat sich angeschickt, Milliarden Jahre früher als gedacht und mit dem Tempo einer Emmerich'schen Eiszeit ins Stadium des Roten Riesen überzugehen. Für die Menschheit gibt es keine Hoffnung – bis jemand auf die Idee kommt, die Künstliche Intelligenz Emily gleichsam als digitalen Noah einzusetzen.
Die am MIT geschaffene Emily – wir lernen sie mitten in einer Therapie-Session kennen – erkundet die digitalen Repräsentationen der Bewusstseine von Psychiatriepatienten. Von da ist es doch eigentlich nur ein kleiner Schritt bis zur Anfertigung dauerhafter Kopien, so der Plan. Emily soll also nun die Erinnerungen respektive die Ichs aller Menschen sammeln und sie in den Speicherbänken einer Weltraumarche aus dem Bannkreis der Sonne evakuieren. Eine KI, die die Menschheit zur Abwechslung mal nicht vernichten, sondern retten will, ist ein reizvoller Gedanke – ebenso wie Wheatons Entscheidung, eine KI zur Ich-Erzählerin zu machen. Aber wie schon gesagt: Leider hat er seine Ideen nicht ausreichend durchdacht.
Who the f*** is Emily?
Trotz konventioneller Action-Elemente (auf das Digitalisierungsprojekt wird ein Terroranschlag verübt, hinter dem ein politisches Machtspiel steckt) kreist der Roman ganz um die Frage: Was ist Emily? Und er tut das auf zwei Weisen, von denen aber nur eine vom Autor gewollt ist. Emily ist eine noch junge KI, die mitten in der Selbstfindung steckt und sich plötzlich mit der Verantwortung für die gesamte Menschheit konfrontiert sieht. So that's me? A new god who will lead the people of Earth into an afterlife they never anticipated? Auch die moralischen Implikationen des Rettungsplans bereiten ihr Gewissensbisse: They're asking me to steal souls.
So weit, so gut. Leider war ich bei der Lektüre aber zunehmend von der Frage "Was ist Emily?" in dem Sinne, den der Autor nicht beabsichtigt hat, abgelenkt. Nämlich: Wie funktioniert Emily eigentlich? Ihr Bewusstsein soll in den Servern des Universitätscampus gespeichert sein. Interagieren kann man mit ihr, indem man ein tragbares Interface benutzt, das Emilys "körperliche" Präsenz via Augmented Reality einspielt. Zugleich kann sie sich aber irgendwie direkt "in den Kopf" einschalten und im Extremfall sogar den Körper ihres Wirts übernehmen. Also wo ist sie nun? Und hat dann jeder seine eigene Emily von unbegrenzt vielen oder ist es nur eine einzige, die vielgleisig fährt? Dass diese simple Frage vom Autor nicht eindeutig geklärt wird, ist nur die erste von vielen, vielen Unklarheiten und Widersprüchen.
Viele Fragezeichen
Anderes Beispiel: Einmal muss Emily ernüchtert zur Kenntnis nehmen, dass ihre Geistessubstanz viel weniger Umfang hat als die eines echten Menschen – unser Mitleid für eine Hauptfigur, die sich als nicht vollwertig betrachten muss, ist wie vom Autor gewünscht geweckt. Später heißt es allerdings, dass Emily wohl auf der Erde zurückbleiben wird müssen, weil für sie "kein Platz" auf der Arche sei. Für Milliarden menschliche Bewusstseine, von denen jedes mehr Speicherplatz braucht als sie, aber schon?
Und so geht es immer weiter. Bis hin zum überhaupt nicht mehr erklärbaren Umstand, dass Emily aus dem Dialog mit den Informationsströmen eines menschlichen Gehirns offenbar erkennen kann, wo im Körper des betreffenden Menschen Krebszellen wuchern. Und wenn sie dann von Körper zu Körper gleitet, hat ihr Wirken eher den Charakter einer dämonischen Besessenheit oder auch einer Leih-Superkraft als den von etwas, das noch unter Science Fiction fiele.
So weit die technische Seite – auch als Charakter bleibt Emily aber widersprüchlich. Flapsige Kommentare wie "Thanks a lot, Sun!" passen vielleicht zu Martha Wells' "Murderbot", aber nicht zu der für maximale Empathie designten Therapie-KI, als die wir Emily zu Beginn kennenlernen. Wheaton dachte sich wohl, dass so etwas die Leser unterhält – aber leider geht es auf Kosten der Kohärenz. Und dass sich Emily zu allem Überfluss auch noch in einen Studenten verliebt, trägt ebenfalls nicht dazu bei, sie als Figur glaubwürdiger zu machen. Der Roman ist offenbar darauf angelegt, an die Gefühle der Leser zu appellieren. Pech, wenn er am Weg zum Herz nicht am Hirn vorbeikommt.
Überzeugt mich nicht.
Geplapper ist der Lektüre Tod
Aber wenigstens habe ich "Emily Eternal" fertig gelesen. Nicht gelungen ist mir das mit dem ebenfalls brandneuen Roman "Ancestral Night" von Elizabeth Bear, auf den ich eigentlich große Stücke gesetzt hatte. Immerhin war von der vielseitigen US-Autorin eine waschechte Space Opera angekündigt – angesiedelt in einer Zukunft nach dem Zeitalter der Entdeckungen, in der die Milchstraße mit ihrer komplexen Gemeinschaft von Spezies und ihrem Verkehrsreichtum wie eine vergrößerte Ausgabe der heutigen globalisierten Erde wirkt. Nur an den Rändern der Galaxis findet man noch Unbekanntes. Eine solche Entdeckung gelingt der Ich-Erzählerin des Romans, der auf Bergungen spezialisierten Raumschiffkapitänin Haimey: ein Stück uralter außerirdischer Technologie, die das Potenzial dazu hat, die Verhältnisse in der Milchstraße auf den Kopf zu stellen. Klingt ein bisschen nach Alastair Reynolds. Eigentlich.
Grund für den Abbruch: Haimey hat mir zu viel Dieter Nuhr in der Stimme. Wie ein Stand-up-Comedian versucht sie – wink wink nudge nudge – ständig, sich dem Leser mit einer ironischen Bemerkung anzubiedern, was mir auf Dauer ziemlich auf die Nerven geht. Zudem haben ihre inneren Monologe nicht immer sonderlich viel Substanz. Banales Geplapper ist ohnehin ein Trend in der aktuellen SF; zum Glück aber nicht der einzige und hoffentlich der, der als erster wieder verschwindet. Ich gehe davon aus, dass Bear sich bewusst dafür entschieden hat, auf dieser Welle zu surfen. Denn dass sie auch ganz anders kann, haben ihre früheren Werke gezeigt, unter anderem "All the Windwracked Stars", das mich seinerzeit auch sprachlich beeindruckt hat. Umso größer die Enttäuschung hierüber.