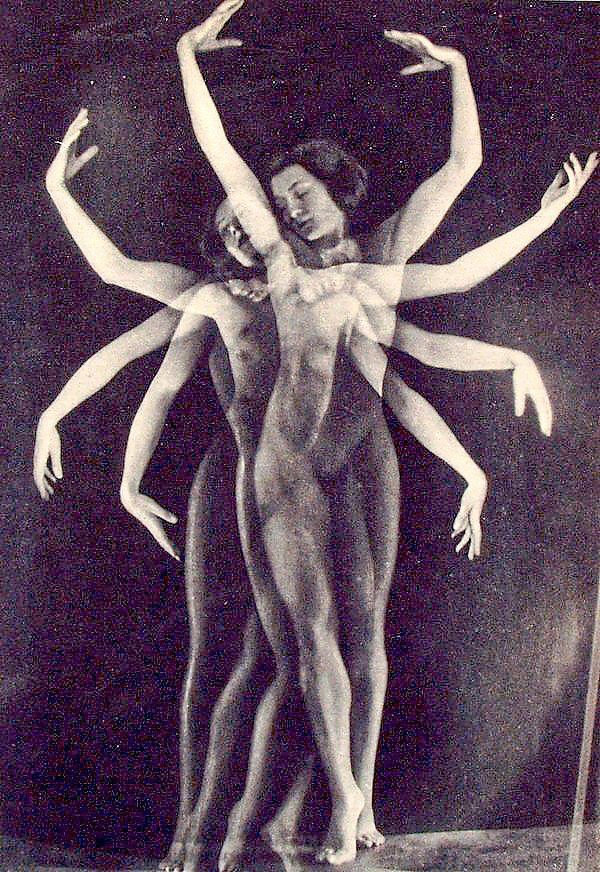
Claire Bauroff war eine der großen Tänzerinnen Wiens der Zwanzigerjahre. Lange herrschte ein verzerrtes Bild der Epoche.
Das kollektive Gedächtnis ist manchmal löchrig wie ein Sieb. Daher ist Kulturwissenschaft auch immer eine Form von Erinnerungsarbeit: Versunkene Schätze müssen gehoben werden, bevor sie gänzlich dem Vergessen anheimfallen. Für Primus-Heinz Kucher vom Institut für Germanistik der Universität Klagenfurt ist in dieser Hinsicht die Zwischenkriegszeit Österreichs von 1918 bis 1938 eine wahre Fundgrube.
Es war eine in vielerlei Hinsicht einschneidende Zeit: Wien war plötzlich nicht mehr Hauptstadt eines Kaiserreichs, blieb aber im Zentrum Europas ein Anziehungspunkt für Intellektuelle, Künstler und Literaten. Mit der von Kucher geleiteten Untersuchung "Transdisziplinäre Konstellationen in der österreichischen Zwischenkriegszeit", die der Wissenschaftsfonds FWF finanziert hat, soll das Wirken der Protagonistinnen und Protagonisten dieser Zeit erhalten werden.
Demnächst wird die umfangreiche Forschungsanstrengung, die eine Reihe von österreichischen Wissenschaftern in Kooperation mit Forschern aus Deutschland, Frankreich und den USA seit nunmehr rund 15 Jahren betrieben hat, abgeschlossen.
Kontinuitäten nach der NS-Zeit
Aber gab und gibt es auf diesem Feld tatsächlich noch so viel zu beackern? Rund 80 Jahre nach ihrem Ende müsste eine Epoche doch eigentlich bereits ausgiebig erforscht sein?
Die Verdrängung in der österreichischen Nachkriegsgesellschaft machte auch vor den Universitäten nicht halt, wie Kucher betont: "Die Zwischenkriegszeit war aus Sicht der Generation meiner germanistischen Lehrer, um es neutral zu sagen, eine umstrittene Periode und ideologisch umstellt." Schließlich kehrten zahlreiche politisch vorbelastete Professoren auf ihre Lehrstühle zurück – eines der bekanntesten Beispiele war Heinz Kindermann.
Der Theaterwissenschafter, der Philologie als "biologische Bewertung des Schrifttums infolge rassenhygienischer Einsichten" verstand und das Fach ganz im nationalsozialistischen Sinne betrieben hatte, wirkte nach dem Krieg bald wieder an alter Stätte: 1959 wurde er Direktor des Wiener Instituts für Theaterwissenschaft.
So unverhohlen wie zuvor konnte er jetzt nicht mehr hetzen, aber auch nun wollten er und viele Kollegen die überwiegend von jüdischen und linken Künstlern geprägten Kulturerzeugnisse der 1920er und 1930er nicht ernsthaft würdigen.
Jüdischer Einfluss
So etablierte sich ein äußerst verzerrtes Bild von dieser Epoche: "Nehmen Sie nur das Beispiel Operette", erläutert Kucher. "In diesem Genre herrschte damals ja nicht nur Walzerseligkeit, wie man heute vielleicht meint.
Die Revuetendenzen aus Berlin machten sich auch hier zunehmend bemerkbar. Die in der Mehrheit jüdischen Komponisten und Librettisten beschäftigen sich fast alle mit moderner Unterhaltungsmusik." Das hatte zur Folge, dass Ende der 20er-Jahre in Wien vermehrt sogenannte Jazzoperetten aufgeführt werden – heute ein völlig in Vergessenheit geratenes Genre.
Um solche verschütteten Blüten jener Zeit freizulegen, sichteten Kucher und sein Team die umfangreiche Publizistik von damals – angefangen bei der Neuen Freien Presse über Die Bühne bis zur Arbeiter-Zeitung. Dort las man dann auch von einem kulturellen Wiener Großereignis, an das sich heute so gut wie keiner erinnert: Die schlicht betitelte "Internationale Ausstellung neuer Theatertechnik" im Konzerthaus bildete den Höhepunkt zahlreicher Aktivitäten, die 1924 im Laufe eines halben Jahres zum Besten gegeben wurden: Konzerte, Aufführungen, Diskussionen und Ausstellungen feierten monatelang den Status quo der Moderne.
Von den italienischen Futuristen bis zum russischen Avantgardetheater gaben sich die Künstler des Kontinents die Klinke in die Hand, die inspiriert in ihre Heimatländer zurückkehrten. Kucher: "Hier fand ein europäisches Ereignis statt, das vor wenigen Jahren noch nicht einmal theatergeschichtlich dokumentiert war und dessen Einfluss noch längst nicht gänzlich ermittelt worden ist."
Onlinearchiv für vergessene Namen
Kultur wird von Menschen gemacht und daher werden mit dem Projekt auch zahlreiche Biografien vieler heute unbekannter Beteiligter wieder in Erinnerung gerufen. Diese zusammengetragenen Lebensdaten sind ein Kernstück des digitalen Archivs, in dem die Wissenschafter ihre Funde öffentlich machen. In Summe wurden bereits rund 500 Einträge erstellt, die derzeit knapp 300 Biografien umfassen, zusätzlich wird ein Onlinetextarchiv aufgebaut.
Hier stößt man zwar auch auf viele prominente Namen, findet aber auch eine Menge inzwischen unbekannter Personen, die noch einer neuen Aufarbeitung harren: Da wäre etwa Arthur Rundt, der entgegen der Mode der Zeit mit "Marylin" einen wenig euphorischen Amerika-Roman verfasste, der aufgrund der Forschungsarbeit auch wieder aufgelegt wurde.
Oder Leo Lania, der, bevor er Bertolt Brecht als Drehbuchautor bei dessen "Dreigroschenoper"-Film half, als Undercoverjournalist die heimliche Wiederaufrüstung der Reichswehr aufdeckte und eines der ersten großen Interviews mit Adolf Hitler führte. Der spätere Emigrant ahnte schon früh, wohin der Marsch der Rechtsradikalen führen sollte, wie einer seiner Buchtitel von 1924 zeigt: "Die Totengräber Deutschlands".
Zu Grabe getragen wurden danach noch Millionen, wobei sich zahlreiche Spuren verwischten. Manche Biografie mussten die Forscher daher von Grund auf neu erstellen. Den einzigen Hinweis, den etwa die äußerst umtriebige Feuilletonistin Elsa Tauber auf ihre Existenz hinterließ, waren ihre Artikel über das damalige Leben der modernen Frau.
Erst in Jerusalem konnte herausgefunden werden, was mit ihr später geschehen ist: Dem Archiv der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zufolge wurde sie 1941 in Wien erschlagen. Dass man daran nun erinnern kann, auch das ist ein Verdienst dieses Projekts. (Johannes Lau, 6.10.2019)