Es gibt Lebenslagen, auf die sollte einen ein eigenes Fach in der Schule vorbereiten. Die erste Steuererklärung. Bunte Wäsche nicht mit heller Wäsche waschen. Den eigenen Vater beim Sterben begleiten, jahrelang. Die Organisation seines Begräbnisses. Dinge eben, mit denen im Laufe eines Menschenlebens mit großer Wahrscheinlichkeit fast alle konfrontiert sind. Bei denen man sich in absurder Gleichzeitigkeit trotzdem wie der erste Mensch fühlt.
Wenn also ein Elternteil stirbt, passiert zuerst das Naheliegende: der Schmerz, die bodenlose Trauer, der sprichwörtlich verlorene Boden unter den Füßen, eines der drastischsten Gefühle überhaupt, das gnadenlos in jede Ritze des Seins eindringt. Das Niemehrwieder. Das Daswirdabjetztimmersosein. Ein Zustand extremer emotionaler Verwundbarkeit bei gleichzeitiger völliger Überlastung, der dann auch noch (das verrät einer vorher ja niemand) erstaunlich unangenehme Nebengefühle mit sich bringen kann: Zorn, Wut, das Gefühl, völlig anleitungslos mit einer schier unbewältigbaren Aufgabe allein gelassen worden zu sein, mit dem Ende jener Beziehung, mit der doch alles im Leben – auch die Gefühlswelt – ihren Anfang nahm, im Positiven wie im Negativen.

Zurück auf den Boden der Tatsachen holt einen die Bürokratie des Sterbens, die teils winzigen, teils bedeutsamen Entscheidungen, die nach einem Todesfall zu fällen sind – auch wenn man oft die einen mit den anderen verwechselt, bevor man letztlich feststellt, vieles ist gar nicht so wichtig. Sarg oder Urne? Welche Musik beim Begräbnis? Ist es die, die er heimlich gehört hat, wenn niemand da war? Oder doch die für die anderen? Und was zur Hölle, man muss manchmal auch für Sterbende und Tote noch eine Steuererklärung machen? Aber auch: Welchen Vater soll ich mir merken? Den Kettenraucher, dem ich sechsjährig den Aschenbecher ausleerte, oder den radikalen Nichtraucher ab 40?
Entsprechen will man den Verstorbenen, beim Begräbnis wie beim Umgang mit der Verlassenschaft. Ihrer Haltung, ihrem Leben, beruflich, privat. Rückwirkend weiß man, wie man hinterher immer alles besser weiß, dass man dabei auch sich selbst entsprechen muss – und darf. Man kann und muss nicht jedes Detail in Ehren halten, man darf Dinge und Geschichten mit dem Tod ihr natürliches Ende finden lassen. Man muss nicht hauptberuflich Hüterin der Vergangenheit werden.

Der einzige Weg ist mittendurch
Es ist eine seltsame Zeit, in der man nicht viel zusammenbringt, außer neben der sich rücksichtslos weiterdrehenden Welt des Alltags einen Fuß vor den anderen zu setzen. Die Reihenfolge der Notwendigkeiten ist vorgegeben. Zuerst ist der Sarg auszusuchen, dann ein Foto zu finden, dann das Gedicht fürs Begräbnis, erst Monate später folgen andere Amtswege. Wenn man Glück hat, hilft einem jemand bei viel zu viel Wein mit der Liste der Partezettel-Empfänger und erzählt dabei Geschichten von verjährtem besserem und weniger gutem Sex.
Das Motto, das erkennt man bald, ist: Der einzige Weg raus ist der mittendurch. Es gibt keine Abkürzungen. Es ist tatsächlich erst vorbei, wenn es vorbei ist – und dann erstaunlich plötzlich. Durch all die fürchterlichen Gänge und Erledigungen hat man auch selbst einen Schlusspunkt erreicht, nach dem endlich eine ruhigere Trauer ihren Platz hat. Wie ein unerwartetes Geschenk kommt die Erinnerung an die Toten zurück, als sie noch lebendig waren, schlechte und gute Witze rissen, Meinungen hatten, die einem gefielen, und welche, die nicht, und ersetzen ganz plötzlich die belastenden heftigen Erinnerungen daran, als man ihnen während des letzten Atemzugs die Hand hielt, diesem Schatten ihrer selbst, als man heulend die Kleidung für den Leichnam aussuchte.

Viele Menschen habe ich bei diesem Unterfangen scheitern sehen. Erbschaftsstreitigkeiten, die Familien auf Jahrzehnte zerrüttet haben. Angemietete Möbellager, die das Problem nur zeitlich verschoben haben. Leute, die mit Halbgeschwistern, die sie kaum kannten, Wohnungen von Vätern, die sie zuletzt vor Jahren gesehen hatten, in einem anderen Land in drei Tagen ausräumen mussten. Mir selbst habe ich beim Versuch zu funktionieren zugesehen, obwohl ich nur richtungslos zwischen den Zeiten taumelte.
Von allen Biografien bleibt je nach Einkommen und Sammelwut im Moment des Todes zuerst einmal eines: Gegenstände. Arbeitsmaterial, Wäsche, Fotos. Tatsächlich ist es nicht deren Geldwert, der die Entscheidungen schwer macht, sondern der emotionale. Der Mensch, sobald er es sich leisten kann, erzählt sich mithilfe von Dingen. Vom Band-T-Shirt bis zur Wahl des Autos zeigen wir, wer wir sein wollen, wie wir wahrgenommen, gelesen werden wollen. Aber was, wenn der Mensch, der sich damit ausdrückte, nur mehr in der Erinnerung da ist? Der das rote Poloshirt trug? Oder das karierte Sakko? Wenn niemand mehr die Urgroßtante kennt, von der die leere, immer noch duftende Parfumflasche stammt? Wenn die Einzige, die alles wüsste, sich nur mehr an guten Tagen und bei den richtigen Fragen erinnern kann? Und was sind schon die richtigen Fragen?
Wer war der Mensch? Wer wirklich?
Was tun also mit den Dingen ohne den Menschen, der die Geschichte dazu erzählt? Seltsame Gleichzeitigkeiten ergeben sich schon wieder in dieser aberwitzigen Zeit der Durchlässigkeit von Leben, Schicksalen und Generationen, es ist, als wäre man in mehreren selbsterlebten Menschenaltern zwischen Kind und Erwachsener gleichzeitig anwesend, aber es sind auch die Toten, die man rückwirkend anders kennenlernt – neue Leute sind sie plötzlich durch ihre Hinterlassenschaft, die ganz eigene Schlüsse zulässt, ohne den Filter einer geordneten Erzählung einer konkreten Person, die dominant bestimmt, was die Geschichte ist und war.
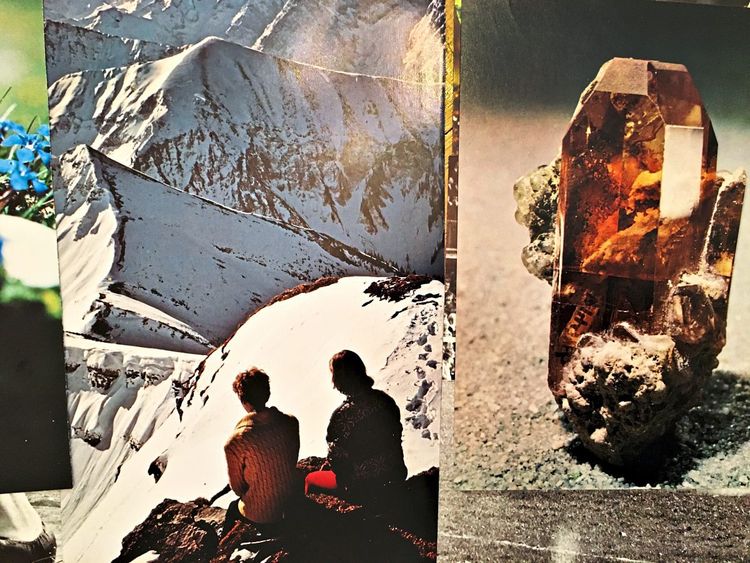
Da blitzt plötzlich dieser einem als Kind immer unbekannt bleibende rätselhafte Mensch durch, der der Vater war, als man selbst noch nicht auf der Welt war. Wenn er 16-jährig jungenhaft und leicht abenteuerlich von einem Foto lächelt, auf dem definitiv nicht die Mutter an seiner Seite ist. Er hat es aufgehoben, all die Jahre, und beim letzten Aufräumen sogar weit nach oben gelegt, und völlig wider Erwarten hat die eigene Mutter gelächelt, als sie es sah, weil sie diesen 16-Jährigen ja kannte und sehr von ihm beeindruckt war. Es sind verwirrende Zeiten für ein Kind, auch wenn es inzwischen über vierzig Jahre alt ist.
Und wie so viele Erkenntnisse in dieser Zeit ist auch diese zuerst erschreckend und dann beruhigend: Wir haben gar kein Recht auf alles aus dem Leben unserer Eltern. Sie müssen uns nicht alles erzählen. Wir haben ihnen auch nie alles erzählt. Das Leben darf unvollständig bleiben für andere.
Gerade anfangs würde man am liebsten jeden Beweis der Existenz eines geliebten Menschen festhalten. Aber zum Glück muss man kapitulieren. Und genau mitten in diesem handfesten Ichkannnichtmehr bekommt man magische Superkräfte, die einem bleiben. Diese ungeahnten Fähigkeiten, die ausschließlich in Zeiten großer Umbrüche und Dramen freigesetzt werden, weil man sie zwangsläufig entwickeln muss. Bei diesem Ausmisten und entscheiden, was bleibt, was wegmuss, räumen wir also vordergründig die Toten weg, aber gleichzeitig sortieren wir uns selbst und unsere eigenen Geschichten neu. Deshalb ist diese Arbeit so heftig – nicht wegen der Gegenstände oder der Lebensumstände der Verstorbenen. Sondern weil wir lernen müssen, uns selbst zu erzählen, auch was wichtig ist und was nicht. Und daraus eine neue Macht entsteht, die alleine uns gehört.
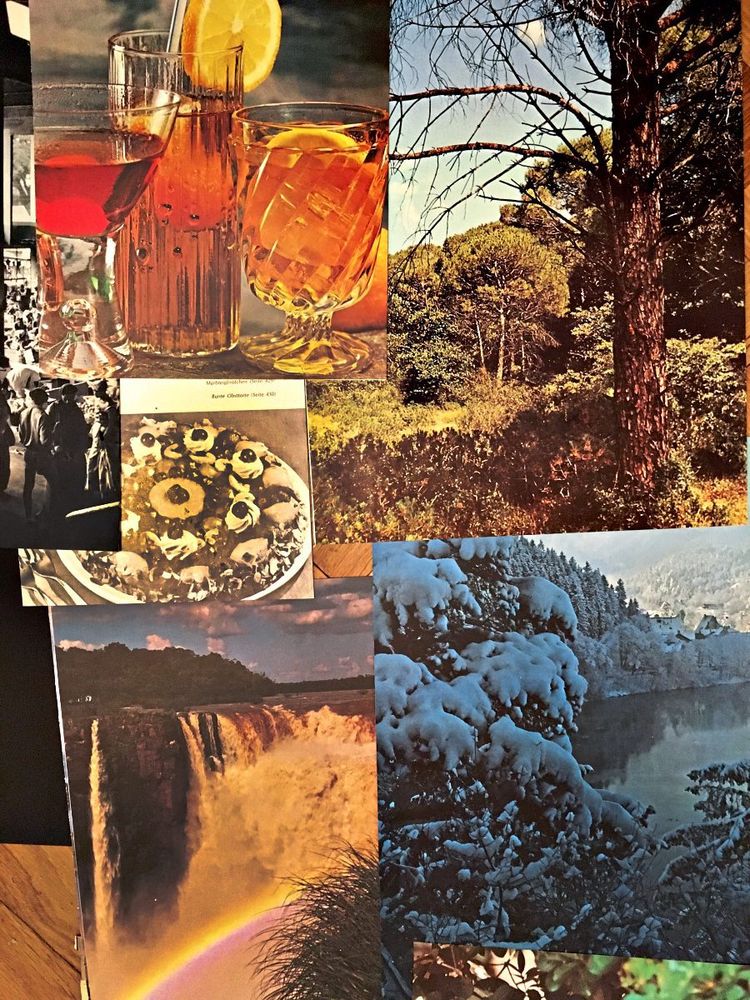
Andenken an holprige Abschiede
Wenn man Hinterbliebene wird, dann erkennt man (oder auch bereits in den Übergängen langer Krankheiten), wie Menschen ticken, wie sie gebaut waren. Wie bei Ruinen sieht man, wo die Stiegenhäuser waren, wo die stabilen Wände, wo die weniger belastbaren. Bei diesem schmerzhaften Prozess lernt man, wie man selbst gefertigt ist. Wo man Wände verstärken sollte. Welche man einreißen könnte, weil man sie selbst dort gar nicht braucht. Und wo man eigentlich lieber einen Balkon hätte. Beraubt der letzten Zeugen der eigenen Kindheit, verabschieden wir uns nicht nur von den Toten, sondern auch von den Menschen, die wir selbst früher waren. "Du sitzt jetzt erste Reihe fußfrei", hat mir eine Freundin damals gesagt, und das klang knallhart, aber gut. Denn erste Reihe fußfrei bedeutet auch, dass es die eigenen Entscheidungen sind, die zählen und gelten, und das Bild von einem selbst, das man hat, nicht das, das ein anderer hatte, dem man womöglich lange zu entsprechen suchte. Und plötzlich erkennt man, ganz versöhnt, dass selbst dieser Mensch einmal versucht hat, jemand anderem zu entsprechen. Es ist die simple Erkenntnis: Auch die Eltern sind nur Menschen.
Die schönsten geerbten Gegenstände habe ich übrigens von Leuten, die sie mir als Nachlass zu Lebzeiten gegeben haben. Die uralte Taufpatin, die mir mit Mitte 90 eine Kette meiner Großmutter in die Hand gedrückt hat. Ich hatte damals das Baby mit, und es war bei dieser Übergabe plötzlich sonnenklar, dass wir uns vielleicht nie mehr wiedersehen werden. Es war wieder so ein Moment der Durchlässigkeit, schön, völlig undramatisch, gar nicht sentimental, sonnenbestrahlt im Winter. Die Dinge enden, und andere gehen weiter, dazwischen gibt eine alte Frau, die einmal jung war, einer anderen eine Kette von einer Frau, die diese nur aus Erzählungen kannte.

Eine andere schmale goldene Kette, die sich meine lässige Tante, die Heldin meiner Jugend, als junge Frau beim besseren Juwelier gekauft hat, obwohl sie es sich nicht leisten konnte, bekam ich mit folgenden Worten in die Hand gedrückt: "Nimm sie und trag sie, sie steht dir, mir passt sie nicht, und überhaupt, mein alter Hals, wie schaut das aus, und ich werde dich ewig lieben, auch über den Tod hinaus." Das sagt sie mir seit 20 Jahren, sicherheitshalber, meine Reaktion schwankt jedes Mal zwischen Rührung und Genervtheit, aber wir wissen beide, der Moment wird kommen, in dem ich diesen Satz brauche.
Vom letzten gemeinsamen Urlaub mit meinen Eltern, der altersbedingt eine etwas holprige Verabschiedung war, brachte ich ein paar alberne Andenken mit. Innert Wochen zerfielen sie mir unter der Hand. Als mein Vater eine Woche später durch eine schwere Krankheit zu einem kaum wiedererkennbaren Menschen geworden war, hatte ich das Gefühl, er würde mir bleiben, wären die Andenken intakt. Bis mir klar wurde, dass es nicht Dinge sind, die ihn mir bewahren können, sondern nur ich selbst und meine Erinnerung. Die Sinnstiftung im eigenen Kopf.
Eure Verantwortung
Die Vergänglichkeit ist ein Hund und "die Sterblichkeit ein Skandal", wie eine Freundin einst meinte. Aber: Sie ist auch eine Emanzipation. Neue Generationen müssen die Dinge im tatsächlichen und im übertragenen Sinne nicht mehr so handhaben wie die Generation davor. Es sind die schweren Zeiten, die große Fragen aufwerfen, große Entscheidungen aber auch leichter machen. "Wird es mir am Totenbett Sorgen machen?", frage ich mich seither, um herauszufinden, wie es um die Größenordnung eines Problems tatsächlich bestellt ist. Da bleibt erstaunlich wenig übrig. "Wir werden alle sterben" nicht als Tragödie, sondern als Befreiungsschlag.

Und doch: Ja, Menschen haben Verantwortung ihrer Nachwelt gegenüber. Es soll nicht an der nächsten Generation sein, den Müll rauszubringen, nicht weltanschaulich und nicht im Wortsinn. Dinge lassen sich noch zu Lebzeiten verschenken, vereinbaren. Vorsorgevollmachten abschließen, Erbschaften besprechen, auch wo und wie man begraben werden will. Gespräche kann man führen über die Dinge und ihre Herkunft, auch die eigene. Es sind wilde Gespräche, in denen man übergangslos bei den Dingen landet, die vorher oft unausgesprochen blieben. Man merkt sie sich lange. Und greift, wenn es so weit ist, mit einem lachenden Auge darauf zurück.
Also ja, Mama, dein Titel kommt auf deinen Grabstein, und was vom Papa übrig ist, werde ich dir nachschütten. Und dann werde ich weitergehen, einen Schritt vor den anderen setzen und versuchen, ich selbst zu sein, und manches davon, was ich dann brauchen werde, werde ich von euch gelernt haben. Aber nein, nicht alles. Ich hab dich lieb.
Deine Julia