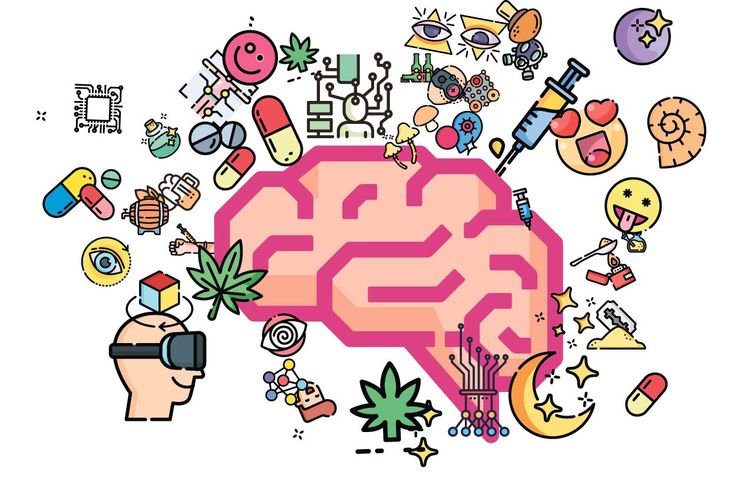Die Jugend säuft nicht mehr. Nüchterner ist unsere Welt aber keinesfalls geworden. Klar: Wenn jeder zehnte deutsche Teenager mindestens einmal pro Woche zum Glas greift, dann ist das immer noch eine ganze Menge. Aber vor 15 Jahren waren es noch mehr als doppelt so viele, die sich wöchentlich ein Bier oder Vergleichbares gönnten.
Die Rauschgewohnheiten wandeln sich. Eine Erklärung könnte sein, dass immer mehr Menschen erkennen, dass Alkohol dumm, dick und träge macht. Das ist mit den Beauty-Standards des 21. Jahrhunderts nicht kompatibel. Die unzähligen Familien, die durch Alkohol zerstört wurden, tragen sicher das Ihre zum schlechten Image des Trinkens bei. Vielleicht ist Alkohol aber auch einfach nur langweilig geworden, so wie Marihuana vielerorts zu einer unspektakulären, fast gewöhnlichen Alltagsdroge mutiert ist. Dagegen wirkt das breite Angebot im Internet geradezu augenöffnend. Vom nebenwirkungsfreien Rausch bis zum High per Elektrostimulation scheint in Zukunft alles möglich.
Hat das Internet die Drogen härter gemacht?
Das erste online gekaufte Produkt war ein Baggy Weed. 1972 vertickten ein paar Studenten der Eliteuniversität Stanford ihren Kollegen vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) ein paar Gramm Marihuana über den Vorläufer des heutigen Internets – das Arpanet. Knapp ein halbes Jahrhundert später macht der Verkauf von Drogen 85 Prozent aller Geschäfte im sogenannten Darknet aus, dem anonymen Seitenarm des Internets.
Die illegalen Marktplätze im Darknet sind Amazon und Ebay nachempfunden, mit dem Unterschied, dass dort statt Büchern und Smartphones eben Waffen und Drogen verkauft werden. Die gefährliche Übergabe auf der Straße entfällt. Das Angebot ist groß.
Kunden können Stoff und Händler sogar bewerten. Eine negative Bewertung schadet dem Geschäft, deshalb verkaufen die Darknet-Dealer eher starke und ungestreckte Substanzen. Das fällt auch Rainer Schmid auf. Der Toxikologe hat vor Jahren das Wiener Check-it-Labor mitbegründet, wo Besucher von Partys und Festivals ihre Drogen kostenlos und anonym testen lassen können. Die Substanzen aus dem Darknet seien tendenziell reiner, was grundsätzlich eine gute Entwicklung sei, wie Schmid findet. Aber es wird schwieriger, richtig zu dosieren, der Konsum wird damit riskanter. Das bestätigt auch der Österreichische Drogenbericht aus dem Jahr 2018. "Die Leute müssen erst lernen, mit den hochpotenten Substanzen aus dem Darknet umzugehen", sagt Schmid.
In welche Richtung entwickeln sich Drogen?
Doch nicht nur die Vertriebswege, auch die Drogen selbst verändern sich. Neben den Klassikern gibt es – online wie offline – eine immer größere Palette an extrem gefährlichen Designerdrogen. Das sind Substanzen, die im Labor auf maximalen Rausch hin entwickelt werden und oft nicht unter Suchtmittelgesetze fallen. Wird eine Substanz verboten, modifizieren die Entwickler das Molekül oft nur geringfügig. Die langsamen Mühlen der Gesetzgebung setzen sich dann von Neuem in Bewegung.
Die DNA-verändernde Crispr-Genschere für daheim dürfte die Experimentierfreude in den Garagen weiter fördern. Manch Bio-Hacker träumt schon heute von Drogen, die für die jeweilige DNA maßgeschneidert sind und immer speziellere Highs versprechen.
Neue psychoaktive Substanzen, wie sie Fachleute nennen, sind in Österreich ein Randphänomen. Viele würden sich vor dem Konsum über Wirkung und mögliche Nebenwirkungen informieren, über die neuen Substanzen findet man aber oft wenig. Wer in Österreich Freizeitdrogen konsumiert, greift deshalb zu den All-Time-Highs: Auf Alkohol und Cannabis folgen mit deutlichem Abstand MDMA und Kokain – Substanzen, die relativ gut erforscht sind. Schmid erkennt aber einen Trend zum Aufputschenden. Woran das liegt? "Na ja, langsamer ist die Welt nicht geworden."
Sind wir alle zugedröhnt?
Berauschende Substanzen sind allgegenwärtig – legale wie illegale. Erst recht, wenn man die Wachmachertasse Kaffee oder die tägliche Schmerztablette gegen das chronische Rückenleiden mitrechnet. Die Trennlinien sind dabei nicht scharf. Was vor einigen Jahren noch illegal war, ist heute vielerorts in der Apotheke oder in eigens dafür gemachten Shops erhältlich – Stichwort Cannabis.
Für den menschlichen Körper extrem schädliche Substanzen wie Alkohol sind in vielen islamisch geprägten Ländern verpönt und deren Konsum manchmal sogar mit der Todesstrafe bedroht. In den meisten Staaten ist Alkohol aber weiterhin allgegenwärtig, Volksdroge Nummer eins und würde wohl sofort auf der Liste verbotener Substanzen landen, wenn er heute erfunden würde.
Obwohl in den Industrieländern die Menschen immer weniger Alkohol trinken, wird es noch lange dauern, bis er von anderen Drogen eingeholt wird. In vielen Weltregionen existieren zudem Naturprodukte mit aufputschender Wirkung, die schon seit Jahrhunderten konsumiert werden. In Ostafrika kauen die Menschen etwa das berauschende Kath, das manche europäischen Staaten künftig verbieten wollen. Auch andere Legal Highs kommen zunehmend ins Visier der Gesetzeshüter. Was legal und was illegal ist, entscheiden am Ende nicht Ärzte sondern Politiker – mit teils unwissenschaftlichen Argumenten, getrieben von Lobbygruppen.
Für den deutlichen Anstieg der Zahl global konsumierter Drogen sorgen aber nicht die pflanzlichen und natürlichen Rauschmittel dieser Welt. Es sind die synthetisch hergestellten Amphetamine, Opioide und Cannabinoide, die die Sinne der Menschen wechselweise schärfen oder vernebeln. 730 Substanzen überwacht die europäische Beobachtungsbehörde mittlerweile. Jedes Jahr kommen neue dazu.
Ist Gras schon normal?
Laut dem aktuellen Weltdrogenbericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung konsumierten 2017 weltweit ähnlich viele Menschen Cannabis wie zehn Jahre davor – knapp 190 Millionen. Und das, obwohl immer mehr Staaten den Konsum straffrei stellen und die Bevölkerung seither deutlich angewachsen ist. Im Gegensatz dazu stieg der Opioidkonsum in nur einem Jahr um mehr als 50 Prozent an.
Die Opioidkrise wütet dabei längst nicht nur in den USA. Besondere Aufmerksamkeit habe auch der rasante Anstieg an Opioidopfern in Afrika verdient, warnt die Uno. Und ihre Zahlen gelten dabei noch als vorsichtige Schätzung, insbesondere weil in sogenannten Schwellenländern die Regierungen erst jetzt damit beginnen, Zahlen zum Drogenkonsum zu erheben. In europäischen Großstädten findet sich indes von Jahr zu Jahr mehr Kokain im Abwasser.
Ist Rausch ohne Nebenwirkungen möglich?
Die teils zerstörerische Wirkung mancher Drogen – für einen selbst und für das unmittelbare Umfeld – nährt regelmäßig den Wunsch nach der nebenwirkungsfreien Droge. Saufen ohne Kater; bewusstseinserweitert raven und dennoch tags darauf emotional stabil sein; stundenlang fokussiert arbeiten oder lernen, ohne körperlich und geistig von irgendetwas abhängig zu werden – wie kann das gehen?
Die Forschung dazu steckt noch in den Kinderschuhen, aber es gibt sie. Zumindest gegen den Kater will David Nutt ein Mittel gefunden haben. Der Psychopharmakologe hat früher die britische Regierung in Drogenfragen beraten. Bis er öffentlich sagte, dass Ecstasy und LSD weniger schädlich seien als Alkohol. Die britische Regierung sah darin einen Affront gegenüber ihrer Drogenpolitik und beendete die Zusammenarbeit.
Heute arbeitet Nutt an einer Substanz, die wie Alkohol berauscht, aber keinen Kater hinterlässt. Alcarelle soll das neue Getränk heißen, das dem Körper weder schadet noch einen richtigen Vollrausch verursacht. Möglich wird das, indem der Stoff genau jene Rezeptoren im Gehirn stimuliert, die für die angenehmen Effekte von Alkohol verantwortlich sind. Nutt will die Formel für diese Substanz gefunden haben, mehr verrät er nicht. Mit seinem Start-up hat er jedenfalls schon 20 Millionen Pfund eingesammelt.
Andere Forscher schwören hingegen auf Ampelopsin, das etwa im japanischen Rosinenbaum vorkommt und Laborratten schneller wieder nüchtern werden ließ. Ebenso wurden die Tiere dank des Wirkstoffs weniger schnell süchtig. Die schädliche Wirkung des Alkohols konnte damit jedoch nicht eingedämmt werden.
Kann ich mich gegen Sucht impfen lassen?
Eine Impfung gegen Drogensucht – davon träumt die Wissenschaft schon lange. Die Idee: Der Körper soll selbst Antikörper gegen bestimmte Substanzen bilden, damit das Gift gar nicht erst ins Gehirn gelangt. Immer öfter gelingen Versuche bei Mäusen, die nach so einer Impfung mehrere Wochen lang keine Wirkung durch Drogen mehr verspüren. Ein Schuss gegen den goldenen Schuss? Ganz so einfach ist es nicht. Denn die Impfung funktioniert immer nur für eine bestimmte Substanz, es gibt aber tausende psychoaktive Stoffe. So viele Spritzen will sich niemand setzen lassen und die Industrie nicht finanzieren.
Tiefe Hirnstimulation könnte helfen, Menschen von ihrer Sucht zu heilen. Als allerletzte Option, wenn sonst nichts mehr hilft – schließlich ist es heikel, direkt ins Hirn einzugreifen. Mehr als 180.000 Menschen weltweit tragen bereits Gehirnstimulatoren. Sie dienen der Behandlung von Parkinson, Dystonie, Epilepsie, chronischen Krämpfen, Schmerzen und immer öfter von Depressionen. Ob sie irgendwann auch als sanfte Droge eingesetzt werden, ist fraglich: Die Kosten sind relativ hoch, die Operation kompliziert. Möglich ist es allemal.
Ende Oktober wurde erstmals auch in den USA einem Patienten mit schwerer Opioidsucht ein Gehirnstimulator eingesetzt. Österreichische und deutsche Neurochirurgen machen solche Entwöhnungstherapien seit den 1990ern. "Das kann man locker machen", sagt Wilhelm Eisner von der Universitätsklinik Innsbruck. Der Neurowissenschafter und Schmerzmediziner gilt als einer der führenden Forscher auf dem Gebiet, hat selbst bereits hunderten Patienten Gehirnstimulatoren eingesetzt und damit etliche Krankheiten behandelt. "Völlig nebenwirkungsfrei", wie er sagt. "Alles, was früher die stinkende Allzwecksalbe der Oma angeblich lösen sollte, macht heute die Neurostimulation." Sie sei eine Universalwaffe, sagt Eisner.
Im Grunde gehe es bei der Therapie von Drogensucht darum, das Belohnungszentrum im Hirn so weit zu stimulieren und zu besetzen, bis es keine Lust mehr auf etwas anderes hat. Der Körper bekommt seinen Schub des Glückshormons Dopamin, ohne von einer schädlichen Sub stanz dazu gedrängt worden zu sein. Grundsätzlich ließe sich so ein Gehirnstimulator natürlich auch für den privaten Gebrauch einsetzen – der schnelle Rausch per Klick auf der Smartphone-App könnte eines Tages tatsächlich Realität werden. Alles nur eine Frage des Geldes und der ethischen Prinzipien.
Wahrscheinlicher ist aber, dass die Methode für sogenanntes Neuro-Enhancement und Gehirnboosting verwendet und missbraucht wird. Durch die Aktivierung bestimmter Gehirnregionen kann beispielsweise das Erinnerungsvermögen, die Aufmerksamkeit oder die Reaktionsfähigkeit enorm gesteigert werden. Allesamt Fähigkeiten, die etwa Soldaten gut brauchen können. Nicht zufällig ist die Militärgeschichte voll von aufputschenden Substanzen. Was dem Nazi die Panzerschokolade, ist den russischen, chinesischen und US-amerikanischen Soldaten vielleicht schon bald der Gehirnstimulator. Psychische Traumata ließen sich dann auch gleich behandeln.
Doch nicht nur bei Soldaten, auch in Banken, Rechtsanwaltskanzleien und Universitäten wird immer öfter das Hirn fit gemacht und gepusht. Zwischen drei und fünf Prozent der Menschen in den Industriestaaten betreiben unter dem Druck der Leistungsgesellschaft bereits regelmäßig Gehirndoping. In Deutschland sollen es sogar fünf Millionen Menschen sein, die mit Pillen ihre Arbeitsleistung steigern, ihre Ängste dämpfen und ihre Laune heben.
Kommt bald der Kick per Klick?
Die Technologie kann also nicht nur dabei helfen, von Drogen loszukommen, sondern sie teilweise sogar ersetzen. Das Start-up Thync aus dem Silicon Valley verspricht den ungefährlichen Rausch per App – je nach Geschmack stimulierend oder sedierend. Um 300 Dollar bekommt man ein Gadget, das man sich über der Augenbraue auf die Stirn klebt. Es soll genau dieselben Gehirnregionen stimulieren wie klassische Drogen, nur eben ohne Nebenwirkungen – und auf Dauer günstiger.
Die ersten Testerinnen und Tester sind aber enttäuscht: Statt des Endorphinschubs bekamen die meisten nur Kopfweh. Das bestätigt auch die These von Neurowissenschafter Eisner, wonach für die korrekte Stimulation die Elektroden punktgenau platziert werden müssen. Das bedürfe jahrelanger Erfahrung von Profis. So schnell dürften die Neurochirurgen die Onlinedealer im Darknet also nicht ersetzen. (Fabian Sommavilla, Philip Pramer, Illustrationen: Fatih Aydogdu, 21.11.2019)