Uniqa zählt zu den führenden Versicherungen in Österreich sowie in Zentral- und Osteuropa. Doch immer mehr vermarkten Onlineplattformen wie Google und Amazon den Kundenzugang zu Versicherungsportalen. Um den Versicherungsprofit zu bekommen, muss man heute kein Versicherer sein.
STANDARD: Für Versicherer ist es überproportional teuer, einen Kunden über Google für eine Polizze zu gewinnen. Eine Autoversicherung über die Suchmaschine zu verkaufen kostet den klassischen Versicherer bis zu 100 Euro. Über einen angeschlossenen Vertreter sind es im Schnitt nur 70 bis 80 Euro. Google holt sich schon jetzt einen Großteil der Wertschöpfung ab, weil Google viel über die Kunden weiß. Wie reagiert Uniqa darauf?
Brandstetter: Wir arbeiten derzeit für ungefähr zehn Millionen Kunden von der Schweiz bis nach Russland. Die meisten unserer Retail-Kunden kaufen auch bei Netflix, Spotify, Amazon oder Google ein. Dort erleben sie an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Convenience und Geschwindigkeit. Wollen sie dort deshalb auch ihre Versicherungen kaufen? Nicht unbedingt, und schon gar nicht beratungsintensive Produkte wie solche für Altersvorsorge oder Gesundheit – dafür gibt’s bei uns ja gut ausgebildete Kundenberater, Generalagenten, Mitarbeiter in Banken oder Makler. Aber sie erwarten von uns auch täglich mehr an Einfachheit und Schnelligkeit – und dass wir nicht stillstehen, sondern uns weiterentwickeln. Ein Beispiel: 44 Prozent aller Schäden erledigen wir in Österreich binnen zweier Tage. Das ist gut, aber wir wollen hier noch effektiver werden. Oder: Damit eine Lebensversicherung gültig ist, müssen wir dem Kunden eine bis zu 70-seitige Dokumentation in Papierformen zuschicken – das muss sich im digitalen Zeitalter ändern.
STANDARD: Planen Sie eine eigene Digitaltochter, um sich von Google und Amazon unabhängig zu machen?
Brandstetter: Eine eigene Digitaltochter bauen wir nicht, allerdings können unsere Privatkunden schon heute alle digitalen Services nutzen: sich per Chatbot beraten lassen, online einkaufen oder uns Rechnungen per App und Smartphone unkompliziert zur Refundierung schicken.
STANDARD: Sie haben jüngst die Fusion dreier Gesellschaften angekündigt, was wird das den Kunden bringen?
Brandstetter: Niedrigzins, hohe Kosten für Regulatorik, rasend schnelle technologische Innovationen und vor allem das sich rasch verändernde Kundenverhalten erhöhen das Tempo. Darauf antworten wir, indem wir bei uns selbst sparen und uns schlanker, kundenzentrierter organisieren. Also mehr Kundennutzen und weniger Kosten.
STANDARD: Poster des STANDARD kritisierten, dass im verkleinerten Uniqa-Vorstand keine Frau sitzt. Warum ist das so?
Brandstetter: Der Aufsichtsrat hat sich nach langer und intensiver Beratung für dieses Team entschieden – auf Basis von fachlicher und führungstechnischer Qualifikation. Insgesamt haben wir in unseren 18 Ländern derzeit 15 Frauen in Vorstandsfunktionen – und sechs weibliche Vorstandsvorsitzende. Der Frauenanteil an Vorstandsmandaten beträgt 27 Prozent.

STANDARD: Uniqa ist die führende private Krankenversicherung in Österreich. In der Praxis gibt es überfüllte Ambulanzen, lange Wartezeiten für nicht akute Operationen (etwa grauer Star), einen Mangel an Landärzten und bedingt durch die anstehenden Pensionierungen sehr bald zu wenige niedergelassene Ärzte. Was läuft aus Ihrer Sicht schief in der heimischen Gesundheitspolitik?
Brandstetter: Es gibt einige Baustellen in der Gesundheitspolitik, aber die Materie ist auch wirklich komplex: Studienzulassung, Ausbildungsplätze, Abwanderung der ausgebildeten Ärzte ins Ausland, Landflucht, alternde Bevölkerung. Eines ist klar: Die private Krankenversicherung trägt zur Verbesserung des überlasteten Systems insofern bei, weil Zusatzversicherte, die Privatärzte und Privatspitäler konsultieren, das öffentliche Gesundheitssystem dadurch natürlich entlasten. Außerdem dürfen wir nicht vergessen: Auch Kunden mit Zusatzversicherung zahlen in vollem Umfang in das gesetzliche Sozialversicherungssystem ein.
STANDARD: Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker sagte jüngst im STANDARD-Interview, dass, wenn wir mehr Ärzte ausbilden, die meisten ins Ausland gehen. Wie sehen Sie das?
Brandstetter: Ich sehe das ähnlich. Wir müssen die Studienplätze nicht groß ausbauen. Wir haben in Österreich eine hervorragende Ausbildung im medizinischen Bereich und müssen Absolventen wieder so attraktive Arbeitsbedingungen anbieten, dass sie gerne in Österreich bleiben. Wir brauchen ausreichendes, erstklassiges und flächendeckend präsentes medizinisches Spitzenpersonal, weil die Bevölkerung Österreichs wächst. Verschärft wird die Zukunft zusätzlich durch die demografische Entwicklung, da Österreich immer älter wird und wir allein dadurch mehr medizinische Betreuung brauchen.
STANDARD: Mehr als drei Millionen Österreicher haben bereits eine private Krankenversicherung, Tendenz steigend. Wohin fließt das meiste Geld: in öffentliche Spitäler, zu Privatärzten oder in Privatspitäler?
Brandstetter: In öffentliche Spitäler. Von allen Leistungen, die wir für unsere Kunden erbringen, fallen rund 65 Prozent für Krankenhauskosten an und nur ein Drittel geht an private Spitäler. Aber schauen wir uns doch an, woher generell das Geld für die Gesundheitsversorgung kommt: Die öffentliche Hand übernimmt rund drei Viertel der Gesundheitskosten, wobei das Geld dafür zu 40 Prozent über Steuern finanziert wird und der Rest aus den Sozialversicherungsbeiträgen stammt. Seit Jahren unverändert, entfallen nur rund fünf Prozent der Gesundheitsversorgung auf private Krankenversicherungen. Und 19 Prozent haben die Österreicher direkt aus der eigenen Tasche bezahlt.
STANDARD: Uniqa ist mit ihrer PremiQaMed-Gruppe (Privatklink Döbling, Confraternität, Goldenes Kreuz etc.) der größte Betreiber von Privatspitälern in Österreich, inklusive privater Ambulanzen und eines Reha-Zentrums. Neben der Privatklinik Döbling wurde ein neues Grundstück erworben, das zur Modernisierung des Standorts oder der Erneuerung des OP-Bereichs genutzt werden soll. Woran liegt es, dass es in Privatspitälern offenbar keine Not an Pflegepersonal gibt?

Brandstetter: Das ist ein Irrtum. Privatspitälern geht es hier nicht anders als öffentlichen. Überall herrscht ein Mangel an Pflegepersonal, und überall wird laufend nach gut ausgebildeten Mitarbeitern gesucht.
STANDARD: Könnten Sie sich vorstellen, auch Pflegeheime zu finanzieren, eventuell gekoppelt mit einer privaten Pflegeversicherung?
Brandstetter: Pflege ist eines der großen Themen, das uns beschäftigt. Eine "Stand-alone-Pflegeversicherung" macht wenig Sinn, aber in Kombination mit bestehenden, bewährten Vorsorgeprodukten für das Alter könnte ein Teil der Rentenzahlungen für die Pflege – so man sie benötigt – ausbezahlt werden. Konkret könnte eine Pflegeversicherung also ein Baustein in der Lebensversicherung sein: Braucht man im Alter Pflege, dann leistet dafür die Versicherung. Braucht man aber keine Pflege, bekommt man stattdessen eine Zusatzpension. Eingezahltes Geld wäre für Kunden nicht verloren. Auch das Thema Pflegeheime schauen wir uns an.
STANDARD: Was heißt es für Uniqa, wenn die deutschen Autobauer quasi per Gesetz dazu verdonnert werden, künftig nur noch Elektroautos herzustellen. Steigen Sie als Versicherung dann ins Kraftwerksgeschäft oder ins Strombusiness ein, oder betreiben Sie Ladestationen?
Brandstetter: Wir sind ein Versicherer von Mobilität und nicht von bestimmten Antriebsformen. Gleichzeitig investieren wir seit Jahren auch in Infrastruktur – bisher bereits mehr als 500 Millionen Euro. Wir haben zum Beispiel auch Windparks im Portfolio.
STANDARD: Macht es für den Kunden preislich einen Unterschied, ob er ein E-Auto versichert oder eines mit Verbrennungsmotor?
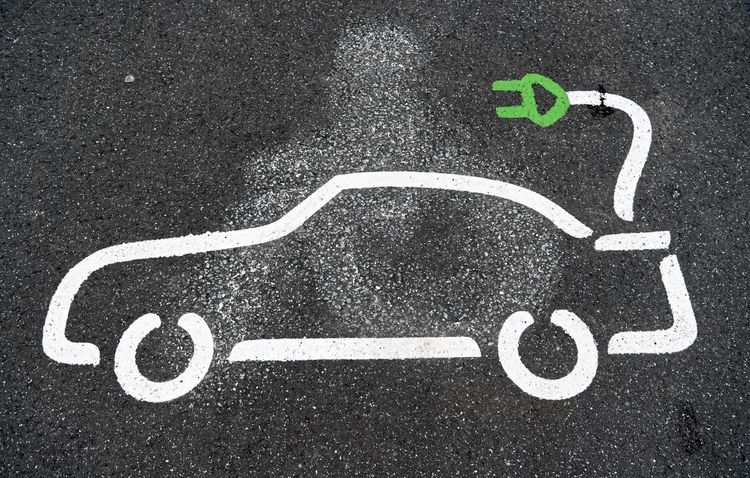
Brandstetter: Ja. Wir wollen umweltfreundliche Technologien unterstützen und aktiv fördern. Daher bieten wir bei der Kfz-Haftpflichtprämie einen Nachlass von 25 Prozent bei E-Autos an. Wir haben die Zahl der versicherten Elektroautos in den ersten neun Monaten 2019 um mehr als 20 Prozent gesteigert. Oder Eigenheimversicherung: In Österreich schenkt Uniqa Neukunden bei Nutzung von Solar- und Fotovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Wohnraumlüftungen die ersten beiden Monatsraten der Versicherungsprämie.
STANDARD: In Deutschland werden den Sparern Negativzinsen verrechnet. Erwarten Sie einen Einlagenboom deutscher Anleger bei Ihren Anlageprodukten?
Brandstetter: Nein. Die Situation in Österreich unterscheidet sich nicht wirklich von der deutschen, denn wir sind genauso vom Niedrigzinsumfeld betroffen. Aber natürlich freuen wir uns auch über jeden Anleger aus Deutschland. Und für Anleger, die eine gute Dividende suchen, ist unsere Aktie ein attraktives Angebot – sechs Prozent Dividendenrendite ist nicht schlecht.
STANDARD: Was raten Sie jungen Leuten, die für die Zukunft vorsorgen wollen?
Brandstetter: Die besten drei Vorsorgemodelle sind immer noch Bildung, Bildung und nochmals Bildung. Aber gleich danach kommt die private Vorsorge, und da gibt es eine Vielzahl von Modellen, die Vorsorge auch mit kleinen finanziellen Mitteln ermöglicht. Die Binsenweisheit ist nicht neu: Je früher man beginnt, desto mehr kommt am Ende raus. Jungen Menschen empfehle ich deshalb, sich in Ruhe umfassend zu informieren und erst dann zu entscheiden, welches Modell für sie ganz persönlich das beste ist. Eine allgemeingültige Antwort, die für jeden passt, gibt es nicht.
STANDARD: Sie waren von 1993 bis 1994 Mitarbeiter im Büro von VP-Vizekanzler Erhard Busek, 1994 bis 1995 Hauptgeschäftsführer der ÖVP. Gefällt Ihnen die kommende schwarz/türkis-grüne Regierungskonstellation?
Brandstetter: Wichtiger als parteipolitische Farben sind gesellschaftspolitische Inhalte: Bildung, Forschung und Innovation, Klimaschutz, Pensionsreform gegen Altersarmut, Strukturreformen und Kapitalmarkt.
STANDARD: Ihr einstiger Österreich-Chef Hartwig Löger erlag dem Ruf der Politik, war Finanzminister und Kurzzeitkanzler unter Schwarz-Blau. Warum reizt Sie kein politisches Amt?
Brandstetter: Weil ich die Fähigkeiten, die man dazu braucht, nicht besitze. (Claudia Ruff, 2.1.2020)