Der Psalm 44 zählt zu den Klageliedern, in einem seiner Verse heißt es, an Gott gerichtet: "Du gibst uns preis wie Schlachtvieh, und unter die Völker hast du uns zerstreut." Auch wenn es sinnlos ist, dem Holocaust eine religiöse Dimension zuzuschreiben, bleibt die unverrückbare literarische Kraft des Textes, der im 20. Jahrhundert erschreckende Aktualität erfahren hat – man sollte sich mit ihm vertraut machen, wenn man sich auf die Lektüre des Romans Psalm 44 von Danilo Kiš einlässt, der nun, reichlich verspätet, dafür beeindruckend übersetzt, Eingang in die deutschsprachige Literaturöffentlichkeit findet.

Dass das 1962 in Belgrad erschienene Buch für deutsche Verlage damals kein Thema gewesen wäre, trifft gewiss nicht zu, denn nur ein Jahr später begannen in Deutschland die Auschwitz-Prozesse, die Vorbereitungen dazu samt öffentlichen Diskussionen liefen bereits seit den Fünfzigerjahren.
Unbekannte Zurückhaltung
Aber ist dieses Frühwerk überhaupt ein Auschwitz-Roman? In Psalm 44, dieser kleinen, fragmentarischen Geschichte, erzählt Danilo Kiš von einer jungen Frau, die das Lager mit bewundernswerter Kraft überwindet. Nichts steht hier von Gaskammern oder maschinellem Töten, nichts von mehr als einer Million Ermordeter. Der Roman kommt vielmehr ohne die bekannten Koordinaten aus, lediglich am Rande wird er mit "Birkenau" verortet. Das mag überraschen, zum einen, weil die damalige Holocaustliteratur die Wirklichkeit ganz anders abzubilden trachtete.
Zum anderen überrascht die Zurückhaltung, die sich Kiš in Psalm 44 auferlegt, zumal er selbst ein familiär Betroffener war: Sein Vater wurde 1944 als ungarischer Jude in Auschwitz ermordet. Darüber hat Kiš erst viel später geschrieben, vielmehr: Er hat von der Erfahrung berichtet, wie sich für den Überlebenden, den Hinterbliebenen, die Welt nach Auschwitz verändert hat.
Die Zurückhaltung in diesem Roman – in der Perspektive, im Erzählton – ist geradezu eine literarische Leistung. Kiš entwickelt ganz konsequent die Innenperspektive einer jungen Frau, die im Lager von einem jüdischen Arzt schwanger wird und nach der Geburt ihres Kindes gemeinsam mit ihrer Kameradin Jeanne einen Ausbruchsversuch unternimmt. Da ist bereits der Geschützdonner der heranrückenden Roten Armee zu hören.
Von dieser äußeren Welt, den alltäglichen Gräueln, dem Programm der Vernichtung eines ganzen Volkes wird nicht erzählt, stattdessen erlebt der Leser ein Kammerstück aus Reflexionen, die tief in die Seele der Protagonistin Maria und in die Zeit, bevor sie ins Lager kam, zurückführen. Diese Vorgeschichte, die nicht zufällig auch die Familiengeschichte von Danilo Kiš abbildet, spielt in Novi Sad: der Vater Jude, die Mutter Katholikin. Schon als Kind erfährt Maria, was es mit der "Botschaft des Blutes" auf sich hat. Im Januar 1942 wird sie schließlich Zeugin eines Massakers, wie Juden erschossen, zerstückelt und ihre Körper unter das Eis der Donau gestoßen werden. Es ist die eigentliche Erfahrung von Gewalt, und es sind nur wenige Seiten – erzähltechnisch grandios! –, die die abscheuliche Brutalität beschreiben.
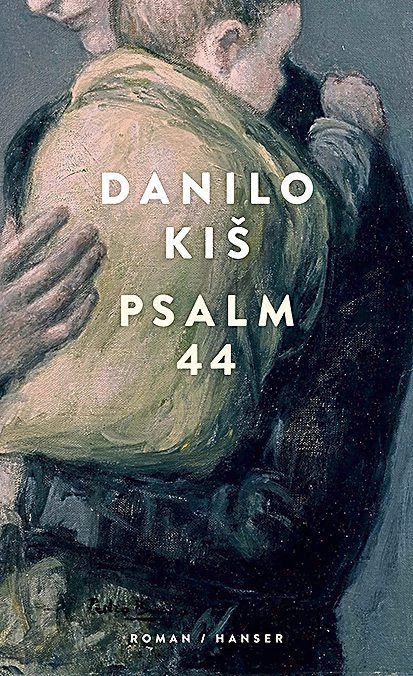
Da braucht es dann keine Beschreibungen mehr von mordlüsternen SS-Männern und Kapos in Auschwitz. Kiš beschränkt sich vielmehr auf die abgründige Weltsicht eines SS-Arztes, der die Ergebnisse seiner medizinischen Versuche über den Krieg retten will, konkret: eine "wertvolle" Sammlung jüdischer Skelette und Schädel. Die müsse doch erhalten werden, sagt der Arzt (der wohl für Josef Mengele steht) zu Marias Geliebtem, dem jüdischen Arzt Jakob.
Das Ende versöhnt
Da mag sich der Leser den Psalm in Erinnerung rufen, der die verzweifelte Auseinandersetzung mit dem biblischen Gott, ja, eine erbitterte Anklage formuliert: Darf ein Gott so zynisch mit seinen Menschen umgehen? Im Lager würde Maria gerne an einen Gott der Liebe, der Hoffnung, der Barmherzigkeit glauben, aber es ist auch ein Gott des Hasses – so deutlich sagt es Marias Kameradin Jeanne, und sie sagt es nicht einmal wütend.
Das Ende versöhnt, aber nur in diesem Fall: Die Flucht durch den Stacheldraht mit dem sieben Wochen alten Baby gelingt. Und es gelingt noch viel mehr: Auch Jakob, der Vater des Kindes, zu dem schon Monate vorher der Kontakt verlorenging, der auch nichts von dem Kind weiß, hat überlebt, die Familie findet zusammen.
Fünf Jahre später werden Maria und ihr Mann sogar Auschwitz besuchen, gemeinsam mit dem nun fünfjährigen Sohn. Ein solches Ehepaar mit ihrem im Lager geborenen Kind hat es damals tatsächlich gegeben, und es war eine Zeitungsreportage, die Kiš zu dem Roman angeregt hat. Aber selbst da, wo seine Protagonisten im Jahr 1950 vor den Vitrinen mit den Haaren, Brillen, Schuhen der Ermordeten stehen, will Kiš nicht aufklären, schon gar nicht belehren, er will nur eine Geschichte erzählen, und die ist so dicht und trotz ihres knappen Umfangs so vielschichtig, dass man diesen Roman zu den meisterlichen Zeugnissen einer Literatur rechnen muss, die zeitlos gültig vom schwärzesten Abgrund des 20. Jahrhunderts erzählt. (Gerhard Zeillinger, ALBUM, 22.1.2020)