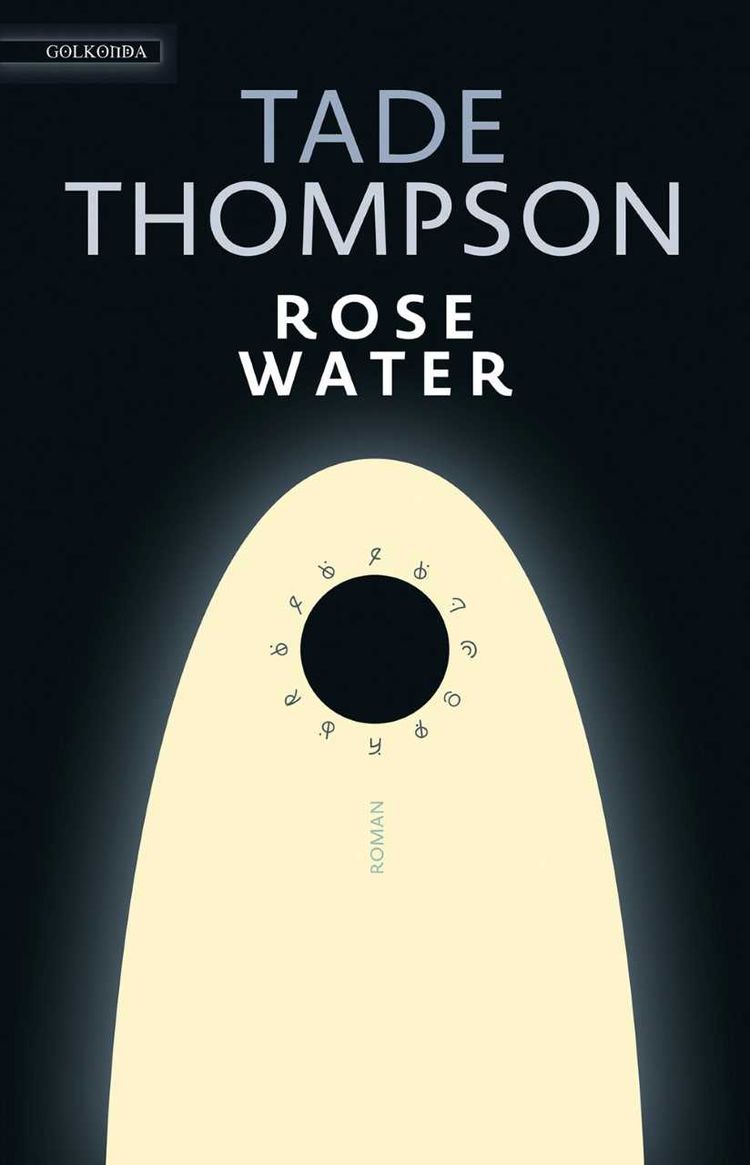
H. G. Wells' Klassiker "Krieg der Welten" war ein kaum getarnter Kommentar zum rücksichtslosen Agieren der europäischen Kolonialmächte im Rest der Welt – mit der Pointe, dass ebendiese durch den Onkel Doktor vom Mars ihre eigene Medizin zu schmecken bekamen. Auch in Tade Thompsons "Rosewater" ist eine Alien-Invasion im Gange. Diese läuft aber nicht mit Schlachtreihen und Kampfkolossen ab, sondern in Form des schleichenden Einsickerns eines kulturellen Systems in ein anderes. Das ist vielleicht die realistischere Variante, und möglicherweise auch die unentrinnbarere. Ob sie langfristig erfolgreich ist, werden die weiteren Bände der Trilogie zeigen, die mit "Rosewater" begonnen hat.
Im Bann der Kuppel
Zum Hintergrund: Seit den 1970er Jahren sind in dieser alternativen Version der Geschichte mehrfach Asteroiden auf die Erde gekracht, die eine eigene Flora und Fauna – zusammengefasst als Xenoformen – in ihrem Inneren trugen. Der dickste Brocken landete 2012 mitten in London und wandert seitdem durch die Erdkruste, um gelegentlich an neuen Orten aufzutauchen. Mitte der 2050er Jahre etwa in Nigeria (wo Romanautor Thompson aufgewachsen ist).
Dort erhebt sich seitdem eine quasi-lebendige Kuppel, die wie ein blauer Mond leuchtet und um die binnen eines Jahrzehnts eine neue Stadt entstanden ist: Rosewater. Die Stadt präsentiert sich uns als buntes Getümmel – insbesondere an dem einen Tag im Jahr, an dem die Kuppel eine "Pore" öffnet und einen Schwall heilsamer Mikroben freisetzt. Kranke und verkrüppelte Menschen genesen massenweise ... gut, manche werden auch grotesk entstellt, und es wanken danach auch immer ein paar bissige Zombies herum. Aber alles in allem wird die Kuppel als Segen wahrgenommen.
Protagonist wider Willen
Hauptfigur Kaaro ist von ihr wenig beeindruckt. Wie von allem eigentlich. Vorgestellt wird er uns nicht zuletzt über Aufzählungen der Dinge, die er nicht mag: Implantate (im Jahr 2066 sind sie zwecks Kommunikation allgegenwärtig). Waffen. Übertriebener Luxus. Verhöre (beruflich bedingt muss Kaaro selbst an welchen mitwirken). Oder Verkupplungsversuche durch Freunde. "Vielleicht hasse ich einfach alles", sagt er einmal. Da geht er zwar einen Tick zu hart mit sich selbst ins Gericht, aber die Richtung stimmt. Rückblicke in seine Kindheit zeigen uns zudem, wie er einst eine kriminelle Laufbahn einschlug – nicht aus Not, sondern aus freien Stücken. Nennen wir ihn also einen Antihelden.
Gegenwärtig geht Kaaro zwei Jobs nach. Zum einen späht er für den nigerianischen Geheimdienst S45 die Gedanken von Verdächtigen aus. Zum anderen hilft er in einer Bank dabei mit, eine psychische Firewall aufrechtzuerhalten, die ihre Kunden vor ebensolchen Gedanken-Hacks schützen soll. Beides ist möglich, weil Kaaro ein sogenannter Empfänger ist. Zu den außerirdischen Xenoformen gehören nämlich auch mikroskopische Pilzfäden, die an die Menschen angedockt und ein planetenumspannendes mentales Netz erschaffen haben. In das lädt zwar jeder ungewollt seine Gedanken hoch – Zugriff auf diese Daten und die Möglichkeit sie zu manipulieren (vulgo Telepathie und Suggestion) haben aber nur die wenigen Empfänger.
Von Netzen und Geflechten
Die "Technologie" mag also eine organische sein, das Resultat ist aber ganz klar: Cyberpunk. Nicht nur, weil wir viel durch virtuelle (Gedanken-)Welten surfen und einen Antihelden zum Protagonisten haben. An den Cyberpunk der frühen 80er erinnert auch die Street-Philosophie, mit der die Protagonisten durch den Tag kommen, ihr Leben im Prekariat, die stets hinter der nächsten Ecke lauernde Gewalt, oder das Treiben undurchsichtiger Entitäten aus Politik, Wirtschaft und Kriminalität. Zugleich blüht aber auch allerorten die Kreativität – es ist das pralle Leben.
Ähnlich wie die SF-Romane von Lauren Beukes oder Ian McDonald fasziniert "Rosewater" nicht zuletzt deshalb, weil wir hier in eine Kultur eintauchen, die uns nicht nur zeitlich, sondern auch geografisch fern ist. Der Rundgang durch das Nigeria der Zukunft flutet uns mit derart vielen neuen Eindrücken, dass man sich erst in der zweiten Romanhälfte zu fragen beginnt, wohin wir eigentlich gehen. Denn ein geradewegs aufs Ziel zusteuernder Plotverlauf war eindeutig nicht Thompsons Anliegen. Nur langsam schält sich heraus, was am Ende bedeutsam werden könnte. Zudem springen wir laufend aus der Gegenwart zu den verschiedensten Stationen auf Kaaros Lebensweg zurück. Für meinen Geschmack hat's Thompson mit der Zahl der Rückblickskapitel etwas übertrieben.
Beim direkten Vergleich mit Nnedi Okorafor – der sich angesichts der Konstellation Alien-Kontakt in Nigeria geradezu aufdrängt – erweist sich Tade Thompson als der klar organisiertere Autor. Okorafor hat ihre Geschichten einfach nicht im Griff, da ist mein persönliches Urteil mittlerweile gefällt. Wenn "Rosewater" nicht alle Erwartungen erfüllt, dann deshalb, weil Thompson explizit westliche Erzählmuster unterlaufen wollte und sich dabei unter anderem auf die Erzähltradition der nigerianischen Yoruba beruft. Das ist zu respektieren, auch wenn ich westliche Erzählmuster mag. Wie ich auch Pop-Songs mit Strophe und Refrain mag, während andere Musikstücke bevorzugen mögen, in denen sich Variationen von Motiven zu einem kunstvollen Geflecht verbinden. Ist letztlich, wie so vieles, Geschmackssache.