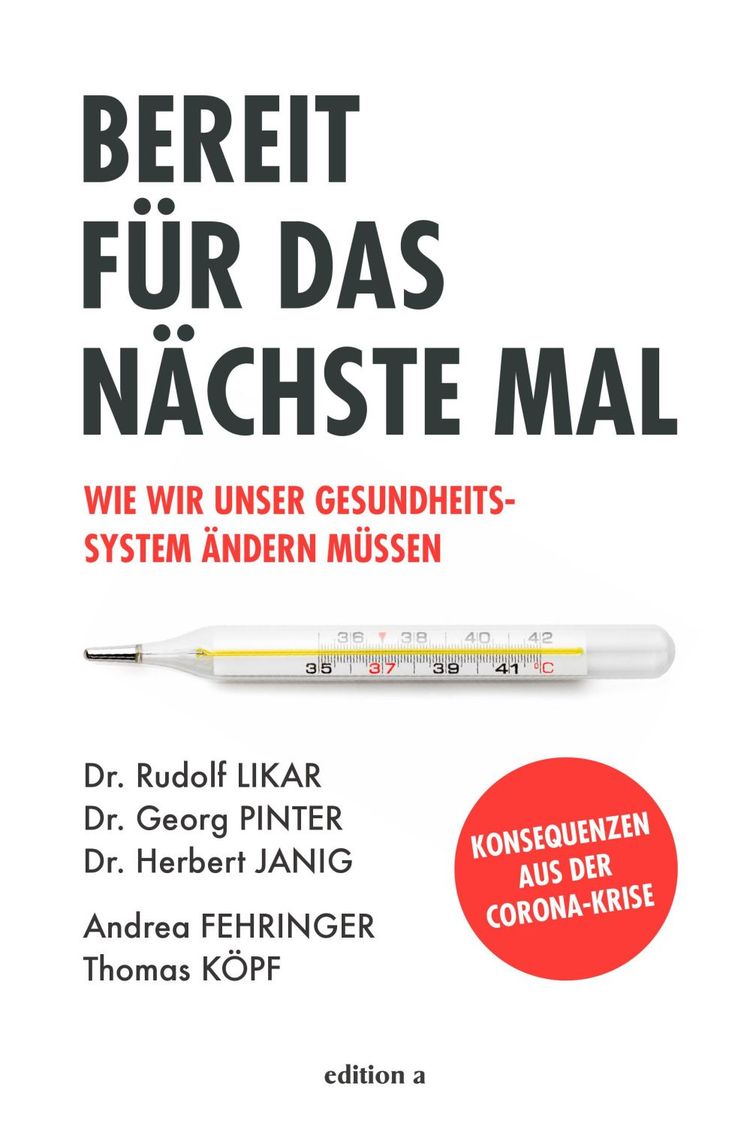STANDARD: Sie kritisieren in Ihrem Buch die Angstmache der Regierung. Der Titel lautet aber "Bereit für das nächste Mal" – das macht doch auch Angst ...
Likar: Nicht, wenn wir gut gewappnet in das nächste Mal gehen – und darum geht es uns.
STANDARD: Was genau kritisieren Sie?
Likar: Zu Beginn der Pandemie war das Problem, dass wir immer in die Lombardei geblickt haben und auf die Toten, die dort zu beklagen waren. Dabei haben wir die Gesundheitssysteme kaum verglichen. In der Lombardei gibt es 676 Intensivbetten auf zwölf Millionen Einwohner, bei uns sind es 2.400 auf acht Millionen. Dort sind die Corona-Infizierten direkt in die Kliniken gegangen, und das Personal war nicht geschützt. Bei uns läuft das anders, und wir haben ein besseres Gesundheitssystem.
STANDARD: Und Sie haben die Gesundheitssysteme verglichen?
Likar: Ja, von oben kam nur Angstmache. Wir waren angewiesen, uns selbst zu vernetzen. Also habe ich mir Mitte März auf eigene Faust ein Bild von der Lage gemacht. Ich habe Kollegen in Kärnten angerufen, und wir haben uns mit Südtirol vernetzt. Weil wir wussten, dass Südtirol eine ähnliche Struktur wie Österreich hat und uns zwei Wochen voraus ist. Zweimal täglich haben uns die Kollegen von dort ihre Infektionszahlen geschickt.
STANDARD: Mit welchem Ergebnis?
Likar: Ab dann waren wir beruhigt. Wir wussten, dass es bei uns nicht so schlimm werden würde, weil wir das Vergleichsszenario hatten.
STANDARD: Was kritisieren Sie an der Kommunikation während der Krise?
Likar: Es kann schon sein, dass man es für die Bevölkerung drastisch formulieren und ein Volk mit Angstsprache führen muss – mit Sätzen wie "Jeder wird bald einen Corona-Toten kennen". Meiner Meinung nach ist das Volk nicht für blöd zu halten, und man kann ihm Eigenverantwortung zutrauen. Allerdings wurde mit dieser Kommunikation auch uns im professionellen Bereich Angst gemacht, man hätte zumindest uns anders informieren können, obwohl wir als Mediziner an sich ja von Haus aus weniger Angst vor dem Tod haben. Wenn man aber während der Pandemie anderer Meinung war und beruhigen wollte, hatte man kaum eine Chance.
STANDARD: Wie meinen Sie das?
Likar: Die Stimmung war sehr aufgeladen in dieser Zeit. Wenn man gesagt hat "Es ist nicht so schlimm" oder "Wir haben das im Griff", war man ein richtiger Außenseiter und es hat nur geheißen, dass es schon noch richtig schlimm werden wird. Die Reaktionen waren teilweise richtig aggressiv und die Menschen in einer Art Angst- und Schockstarre, selbst Mediziner. Mich hat das sehr erschreckt.
STANDARD: Haben in der Kommunikation Vergleiche gefehlt?
Likar: Ja. Corona-Todesfälle wurden kommuniziert, aber sehr lange war es kein Thema, wie viele Menschen für gewöhnlich in einer Woche sterben. Corona ist klar gefährlicher als die Influenza, dennoch: In Kärnten hatten wir zwölf Tote durch Corona, aber 26 durch die Influenza – ohne Hygienemaßnahmen. Auch in den Medien ist das leider oft ein Problem, in Südkorea wird bei 34 Neuinfizierten in einer Disco schon von einer zweiten Welle gesprochen – und das bei einer Einwohnerzahl von 51 Millionen.
STANDARD: Sie schreiben in Ihrem Buch, Österreich sei der Pandemie "relativ hilflos ausgeliefert gewesen". Dabei ist es doch mit der Versorgung der Patienten gut gelaufen?
Likar: Damit ist gemeint, wie die Organisation dieser Pandemie abgelaufen ist. Es hat keinen Katastrophenplan gegeben, die Intensivstationen waren nicht vernetzt. Wir wussten nicht einmal, wo es wie viele Betten gibt. Von oben kamen nur Maßnahmen, die Bundesländer mussten Schutzkleidung und Tests selbst organisieren und notwendige Infos einholen. Wir haben in Kärnten ein eigenes Covid-Ärzte-System aufgebaut, der Samariterbund hat uns Fahrzeuge zur Verfügung gestellt, mit denen wir zu den Kranken nach Hause gefahren sind – alles auf Eigeninitiative. Das Landeskrisenmanagement in Kärnten hat gut funktioniert.
STANDARD: Hätten Sie einen weniger restriktiven Weg gewählt?
Likar: Es war wichtig, rechtzeitig gegenzusteuern und Maßnahmen wie Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz und Handhygiene zu setzen. Doch man hätte das medizinische System nicht so runterfahren dürfen. Wir hatten 80 Corona-Fälle und mussten in Kärnten 700 Spitalsbetten freihalten.
STANDARD: Und für Sie war absehbar, dass die nicht alle gebraucht werden?
Likar: Ja. Das Gesundheitssystem war nicht an seiner Grenze, und das wird in dieser Pandemie auch nicht mehr passieren. Trotzdem hatten die Menschen Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Wir waren aber jederzeit fähig, die Menschen richtig zu behandeln, das System hat funktioniert. Es gab auch nie einen Punkt, an dem wir gesagt haben, dass chronisch Kranke nicht mehr kommen dürfen, trotzdem sind sie acht Wochen lang ferngeblieben, darunter Patienten, die eine Chemo brauchen oder eine rheumatologische Therapie. Nun mussten wir sie sogar anrufen, um ihnen zu sagen, dass sie wieder kommen dürfen. Solche Kollateralschäden dürfen nicht wieder passieren.
STANDARD: Was wäre Ihre Strategie, sich auf erneut steigende Infektionszahlen vorzubereiten?
Likar: Man könnte überlegen, die Zahl der Intensivbetten zu erhöhen. Aber die medizinische Versorgung darf sich kein zweites Mal komplett auf Covid-19 fixieren. Und die Maßnahmen sollten regionaler werden. Kärnten hatten schon 20 Tage lang keine Neuinfektionen, bevor wieder wenige Fälle aufgetreten sind. Da könnte man schon früher Lockerungen zulassen.
STANDARD: Bezugnehmend auf Ihren Buchtitel – wie könnte ein "nächstes Mal" aussehen?
Likar: Nach Sars-CoV-2, aber auch schon nach der starken Grippewelle 2009 ist und war absehbar, dass wir ähnliche Situationen auch in Zukunft erleben werden. Insgesamt müssen wir uns hier besser vorbereiten. Und zwar nicht nur auf eine mögliche zweite Corona-Welle oder Infektionskrankheiten, sondern auch auf andere Gesundheitsgefahren. Seit Jahren warnen Experten etwa vor Antibiotika-Resistenzen. Diese könnten eine Bedrohung für viele Menschen werden, die schwer krank sind und auf diese Medikamente angewiesen sind.
STANDARD: Wie muss sich das System vorbereiten?
Likar: Es muss ausreichend Schutzkleidung wie Masken und Desinfektionsmittel auf Vorrat geben. Die Notfallaufnahme muss besser aufgestellt sein, um Patienten schneller in "infektiös" und "nicht infektiös" einteilen zu können. Auch niedergelassene Ärzte müssen besser ausgerüstet werden. Zudem fordern wir eine Grippe-Impfpflicht im Gesundheitsbereich, ein Frühwarnsystem und einen Mehrstufenplan für zukünftige Ausbrüche.
STANDARD: Corona hat auch viele ethische Fragen aufgeworfen. Wie gehen Ärzte damit um?
Likar: Wir waren zum Glück nie in einer Situation, in der wir entscheiden müssten, welchen Patienten wir behandeln und welchen nicht. Wir hatten aber einen Patienten mit schwerer Lungenfibrose, der an Corona erkrankt war und nicht beatmet werden wollte. Das mussten wir respektieren und akzeptieren. Denn trotz Corona muss die Autonomie des Menschen gewahrt werden. Auch unseren Umgang mit alten Menschen sollten wir überdenken. Pflegeheime brauchen in Zukunft bessere Strukturen, um Infizierte vor Ort betreuen zu können. Es gibt einiges, was wir aus dieser Krise lernen und nicht so schnell wieder vergessen sollten. (Bernadette Redl, 3.6.2020)