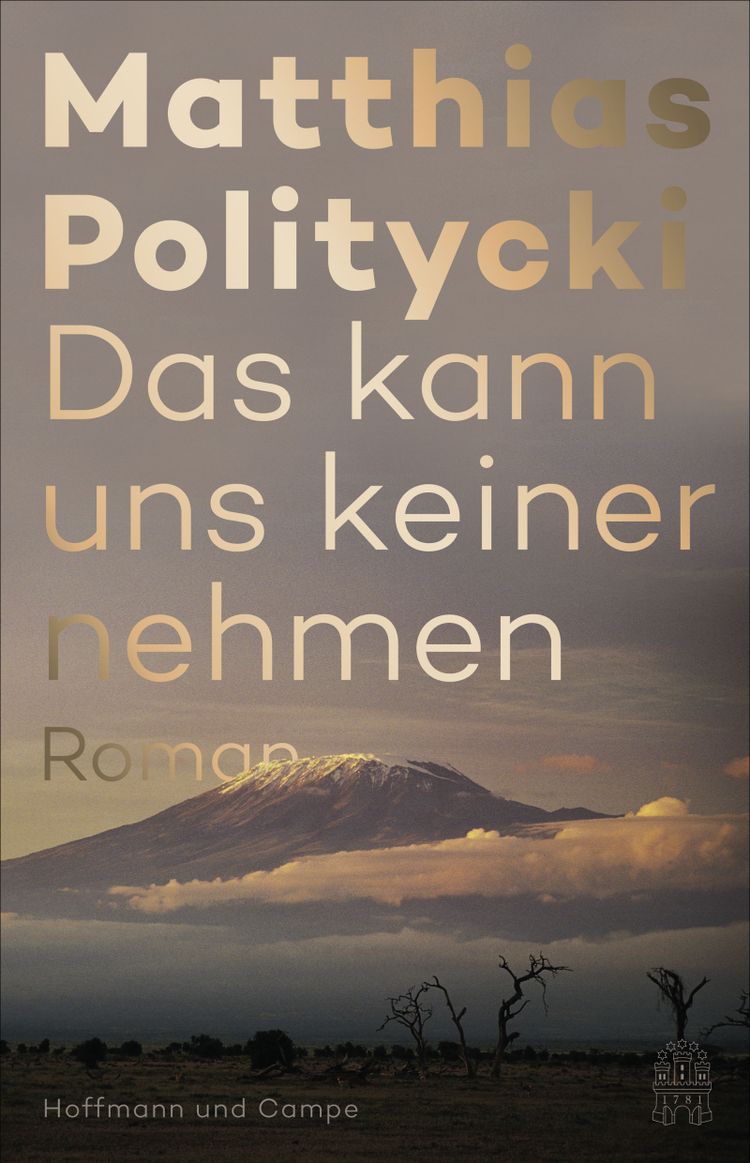DerStandard: Das Szenario Ihres neuen Romans ist überwältigend: Der Kilimandscharo – mit seinem 5895-Meter-Gipfel ist er der höchste Berg Afrikas. Dort hat es Hans aus Hamburg hinverschlagen. Der Ich-Erzähler will den Berg meistern. Es herrscht reger Bergsteigertourismus, und Hans hat hier eine Begegnung mit einem ihm fremden Menschenschlag: Gemeint ist "der Tscharli", ein Ur-Bayer aus Miesbach. Wie kamen Sie auf dieses eigenwillige Setting?
Matthias Politycki: Na ja, ich bin in München aufgewachsen, und da gab es jede Menge Tscharlis, sie erschienen mir immer viel interessanter als meine Eltern. In Norddeutschland wird dieser Typus notorisch unterschätzt, man versteht seinen Humor nicht und die tiefe Weisheit, die sich darin verbirgt. Andrerseits lebe ich seit 25 Jahren auch in Hamburg, man feiert sich dort gern als weltläufig und eckt doch außerhalb der Stadtgrenzen überall mit seinem Tonfall an, ohne es zu merken – das ist schon auch sehr speziell. Also meine beiden Hauptfiguren kenne ich halt aufgrund meiner Lebensumstände ganz gut.
DerStandard: Am Anfang sind sich die beiden gar nicht grün. Tscharli nennt den feinen Herrn aus Hamburg "a Hornbrillenwürschtl". Und Hans hält sein bayerisches Gegenüber für ein trampelig-bayerisches Urviech. Und doch durchleben beide gemeinsam den Roman – "Das kann uns keiner nehmen" lautet der Titel. Was bringt, was hält die beiden zusammen?
Politycki: Zunächst mal die schiere Naturgewalt – das schafft auch wider Willen Empathie, selbst wenn der eine den anderen zuvor als unerträglichen "Rechten" abgehakt hatte und der andere den einen als ebenso unerträglichen "Gutmenschen". Im Verlauf der weiteren Reise stellt sich immer mehr heraus, dass dieser erste Eindruck falsch war. Das ist ja eines der Themen des Romans: Wie schaffen wir es, über weltanschauliche Vorurteile und Gräben hinweg wieder miteinander ins Gespräch zu kommen? Hans und der Tscharli tun es, und schon erleben sie gemeinsam Sachen, die sie allein nie erlebt hätten. Das hält sie dann sogar über den Tod hinaus zusammen.
DerStandard: Tscharli ist ein echter Afrika-Kenner und spricht einen eigenwilligen Mix aus Englisch, Bayerisch und Kisuaheli. Die Einheimischen lieben ihn, nennen ihn ehrfürchtig "Big Simba". Und Tscharli ruft ihnen liebevoll machohaft zu: "My brother from another mother." Genau diese zutiefst politische Inkorrektheit öffnet ihm in Afrika Tür und Tor. Und der Hanseat Hans merkt, dass er sein deutsch-korrektes Afrikabild ändern muss, will er ernst genommen werden. Ist das ein Teil Ihrer Botschaft, die Sie im Roman vermitteln wollen?
Politycki: Die Idee der politischen Korrektheit ist und bleibt richtig. Bei ihrer Umsetzung haben wir mächtig übertrieben. Wollte man in Afrika auf dem korrekten Sprech- und Verhaltenskodex insistieren, käme man nicht weit. Wer die Einheimischen wirklich ernst nehmen will, muss auch ihren Humor teilen. Wer mit ihnen auf Augenhöhe reden will, muss oft klarer und direkter werden, als es die politische Korrektheit zuließe. Das kann man bedauern, man kann es aber auch als eine vorübergehende Befreiung vom zu Hause herrschenden Zeitgeist empfinden.
DerStandard: Der Impuls für Ihren Roman fußt auf einer jahrzehntelang zurückliegenden Afrikareise, die Ihnen beinahe das Leben gekostet hätte. Wie stark haben diese autobiografischen Bezüge das Erzählte mitgeprägt?
Politycki: Meine erste Afrikareise führte mich unter anderem nach Ruanda und Burundi, das war 1993. Wir dachten, der Bürgerkrieg zwischen Hutu und Tutsi sei vorbei, er hatte jedoch nur eine Pause gemacht. Schon diese Rahmenbedingungen konnte ich nur schildern, indem ich darauf zurückgegriffen habe, was ich tatsächlich selber gesehen, selber erlebt hatte. Und erst recht, als es um die Nahtoderfahrungen ging, die ich dort machen musste. Es half nichts, ich musste in diesen zentralen Passagen des Buches bei der Wahrheit bleiben. Alles, was ich hier hätte erfinden können, wäre womöglich kitschig oder sogar falsch gewesen. Wahrscheinlich habe ich deshalb jahrzehntelang nicht mal erwogen, diese Erlebnisse literarisch zu verarbeiten. Autobiografische Bezüge muss man beim Schreiben ja auch zulassen.
DerStandard: Sie kennen Ostafrika und andere Teile des Kontinents gut. Bisher hat sich dort das Coronavirus noch schwach ausgebreitet. Doch Gesundheitsexperten schlagen bereits Alarm: Aufgrund der medizinischen Versorgung und der hygienischen Verhältnisse könnte es hier zu einer menschlichen Tragödie kommen. Sehen Sie das auch so?
Politycki: Das könnte es zweifellos. Es sind aber nicht nur die "Verhältnisse", es ist schon auch der vorherrschende Egoismus, ein gewissermaßen "unschuldiger" Egoismus, der das eigene Wohl, das der eigenen Familie, des eigenen Dorfes, des eigenen Stammes, des eigenen Volks immer über das Wohl der Gesamtbevölkerung eines Staates stellt. Das reicht bis zum gerade regierenden Präsidenten, der seine eigene Heimatregion so lange aus Staatsgeldern bevorzugt, bis er durch einen Präsidenten abgelöst wird, der einem anderen Volk angehört. Ich liebe Afrika, aber an diesem überall herrschenden Prinzip könnte ich verzweifeln. In Zeiten der Krise wird dieser Mangel an Solidarität noch empfindlicher zu spüren sein – keine gute Ausgangsbasis, um eine Pandemie zu bekämpfen. King Charles, einer meiner tansanischen Freunde– und Romanfiguren –, hat mir geschrieben: "Please put us in your prayers". Da war das Virus gerade erst in Tansania angekommen.
DerStandard: Dass das Gefälle zwischen den Industriestaaten und afrikanischen Staaten sehr groß ist, ist jedem klar. Was aber müssten die reichen Staaten der Welt jetzt tun, um zu helfen?
Politycki: An der Beantwortung dieser Frage sind wir schon jahrzehntelang gescheitert. Afrika ist extrem kleinteilig, entsprechend kleinteilig müssten die Antworten ausfallen – was hilft diesem Dorf, was jener lokalen Initiative? Selbst wenn wir Medikamente dezentral liefern und Ärzte in kleinen Teams in die Dörfer schicken würden, hieße das noch lange nicht, dass die Hilfe willkommen wäre. Europäer gelten vielerorts als diejenigen, die Corona überhaupt erst nach Afrika eingeschleppt haben, dort wird man europäische Ärzte meiden oder sogar mit Gewalt vertreiben. Wer mit unseren Maßstäben helfen will, ist auch schon vor Corona oft auf Ablehnung gestoßen. Übrigens auch die Zentralregierungen afrikanischer Staaten, wenn sie afrikanische Völker mit rechteckigen Wellblechsiedlungen zu "zivilisieren" versuchten, die Bewohner aber viel lieber in ihren Rundhütten bleiben wollten. Im Grunde sind all diese Hilfen Umerziehungsmaßnahmen, eine Art Mikroglobalisierung. Vielleicht sollte man einfach weniger umerziehen wollen, sollte kosmopolitisch denken, also das Fremde ruhig auch mal fremd belassen? Und die vielen afrikanischen Ethnien ihre vielen verschiedenen Wege einschlagen lassen? Am Ende werden sie wohl nicht dort ankommen, wo wir sie gerne hätten, sondern dort, wo sie selbst sein wollen.
DerStandard: Was können die einzelnen afrikanischen Staaten selbst unternehmen? Sind da Umstände wie schwache Zentralgewalt ein enormes Hindernis?
Politycki: Was auf der Ebene der Dorfgemeinschaft sehr gut funktioniert, funktioniert nicht mal in Ansätzen auf Staatsebene, weil sich mit diesen Staaten im Zweifelsfall kaum einer, abgesehen von den Intellektuellen, wirklich identifiziert. Es sind künstliche Gebilde, das problematische Erbe des Kolonialismus. Es wird erst dann wirklich überwunden sein, wenn die Menschen in Afrika zu ihren eigenen Staatsgebilden gefunden haben.
DerStandard: Kommen wir zu Ihrem Roman zurück. Der Ich-Erzähler ist nach Deutschland zurückgekehrt und denkt doch immer wieder an den "Tscharli". Aber warum? Die Antwort mag er sich kaum eingestehen: "Weil ich in Afrika, jedenfalls in seiner Gesellschaft, ein freierer Mensch war als zu Hause." Empfinden Sie ähnlich?
Politycki: Tatsächlich hatte ich in den letzten Jahren überall auf der Welt das Gefühl, weit freier reden zu können als zu Hause. Irgendwann habe ich jedoch gemerkt, dass ich auch zu Hause ein glückliches Leben führen möchte, und habe ganz vorsichtig wieder angefangen, mich an den öffentlichen Debatten zu beteiligen. Das kann uns keiner nehmen hat viel mit der Haltung zu tun, die ich seither mit meinen Texten vermitteln will. (INTERVIEW: Andreas Puff-Trojan, 6.6.2020)