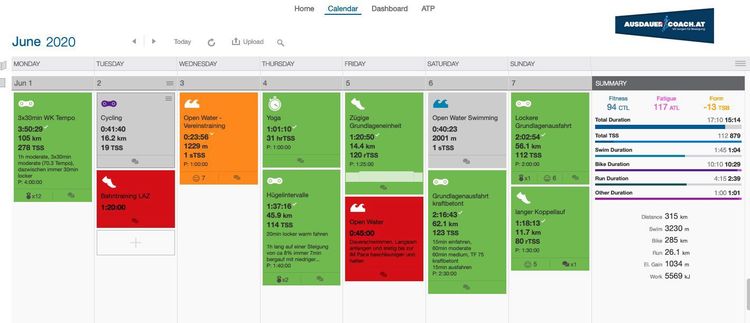
Zum Abschluss der Woche stand dann noch ein kleiner Koppellauf auf dem Plan. Eh nur eineinhalb Stunden. Gemütlich. Wirklich gemütlich. In Gesellschaft – und deshalb auch in wirklich zivilem Tempo: Es geht ja um nix, nur um den Spaß an der Freude.
Trotzdem hat der Coach recht: Wie sich die ersten zehn oder 15 Minuten eines Laufes, der "Koppellauf" heißt, anfühlen, beschreibt Harald Fritz meist mit Formulierungen, die im sehr Vertraut-Privaten gerade noch, niedergeschrieben aber auf gar keinen Fall gehen. Sagen wir es so: Ein Koppellauf ist am Anfang meist ziemlich das Gegenteil von "leiwand".

Doch genau darum geht es: Um das "Nicht leiwand". Weil "leiwand" dort aufhört, wo die eigene Komfortzone endet. Und die ist stur: Was sie nicht kennt, mag sie nicht. Sie glaubt auch nicht dran, dass es außerhalb ihrer selbstgesteckten Grenzen leiwand sein oder leiwand werden könnte: Die Komfortzone zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit sich selbst zufrieden ist. Sich selbst genügt – und sich, zumindest anfangs, mit Händen und Füßen gegen alles sträubt, was ihren Horizont erweitern könnte.

Das ist ihr gutes Recht. Anderseits: Wer die Komfortzone nie verlässt, weil es in ihr "eh leiwand" ist, wird nie weit über den Tellerrand hinausschauen. Und versäumt dadurch so einiges.
Ich rede gar nicht von sportlichen Best- oder Wasauchimmerleistungen, sondern auch von Erlebnissen, Bildern und Eindrücken, die man nach und nach beim Herumsporteln einsammelt, die man aber auf dem Sofa kaum erlebt hätte. Die Sache mit der Hadersfelder Feuerwehr vor ein paar Wochen zum Beispiel. Oder, gleich ums Eck davon, unten am Fluss – der eigentümliche Getränkeautomat-und-Gartenzwerg-Container am Ufer des Greifensteiner Altarmes: Nix Besonderes – aber eben doch.

Oder die "Rinne", das Entlastungsgerinne in Wien, zeitig am Morgen: Wenn sich der Schwimm-Workout am Vortag einfach nicht ausging, kann man entweder bedauernd mit den Schultern zucken und am nächsten Morgen, es ist ja Samstag, ausschlafen – oder aber sich ein bisserl früher aus dem Bett (a.k.a. Komfortzone) schälen, an die Neue Donau fahren und "nachschwimmen".
Der Benefit? Auch wenn dann tagsüber – etwa bei der angehängten Radrunde – der Wind schon recht ordentlich (und natürlich immer von vorne) pfeift, ist das Wasser um sieben in der Früh noch spiegelglatt. Da schläft der Donauwind oft noch. Die Sicht ist – für lokale Verhältnisse – ein Hammer. Und Morgensonnenstrahlen kitzeln sogar unter Wasser lustig in der Nase.

Und wenn wir schon beim Verlassen der Komfortzone am oder im Wasser sind: Ein paar Tage zuvor hätte die wetterberichtindizierte Komfortzonen-Ansage gelautet, das Schwimmtraining in der Gruppe auszulassen. Aber natürlich kann man es trotzdem versuchen. Dann hat man, wenn über der Stadt Blitze zu zucken beginnen und der Coach vernünftigerweise "Alle sofort raus" signalisiert, immerhin ein bisserl was getan.
Aber wichtiger: Wer nur bei gutem Wetter schwimmen geht, probiert nie aus, ob ein Neoprenanzug auch bei einer Regen-Mofafahrt vor Nässe und Wind – und somit Kälte – schützt. "Schaut bescheuert aus", ätzte ein Bekannter. Stimmt. Aber waschelnass und durchgefroren auf dem Motorrad schaut auch doof aus – und ist außerdem noch richtig unangenehm: Nur doof Ausschauen ohne Frieren ist die bessere Option.

Zugegeben: Mit Koppeln, also der Aneinanderreihung unterschiedlicher Sport-Trainingseinheiten, mag die Erweiterung des Erlebnishorizonts auf den ersten Blick nichts zu tun haben.
Andererseits aber eben doch. Etwa dann, wenn vor dem Rad Wasser auf dem Plan steht und der Lieblingsmensch vollkommen zu Recht fordert, dass die Radausfahrt rechtzeitig beendet zu sein hat. Schließlich ist man zum Samstagsbrunch verabredet. Also muss man deutlich früher raus – und teilt sich den Sonnenaufgang dann nur mit einem einsamen Mann im Gummiboot oder …

… erschreckt kurz danach die Schafe im oberen Bereich der Insel, die dort als Bio-Rasenmäher angestellt sind …

… und lernt dann auf der Greifensteiner Kraftwerksmauer noch Kevin und Lisa bei ihrem Longrun (es ist immer noch nicht einmal acht Uhr, aber "das ist grad Kilometer 13 von 18") kennen: Sie ist Frauenfußballtrainerin, er Pressesprecher des österreichischen Frauennationalteams – und ihre Bitte, die Sportredaktion im STANDARD "ganz herzlich" zu grüßen, wird natürlich mit flussabwärts genommen.

Darüber hinaus hilft Koppeln aber, der Komfortzone zu erklären, dass es Spaß macht, sie zu erweitern.
Obwohl ich eins zugeben muss: Meine Koppeleien waren diesmal streng nach Trainingslehre nur eingeschränkt "echtes" Koppeltraining: Zwischen dem Frühschwimmen auf der Insel und der Radfahrt am Samstag lag eine Heimfahrt durch halb Wien. Und zwischen der Radlerei von Sonntag und dem Lauf dann auch mehr als eine halbe Stunde: Während versprengte Nachtschwärmer immer noch tanzten, schlief meine Laufbegleitung noch, als ich heimkam …

Genau genommen bedeutet "Koppeltraining" nämlich, dass man das eine dem anderen unmittelbar folgen lässt. Das muss nicht so rasch gehen wie der Outfit- und Ausrüstungswechsel im Wettkampf, aber nach 15 Minuten sollte man doch wieder unterwegs sein. Nicht weil das Laufen sich dann nach 20 Minuten weniger heftig anfühlt oder in Summe weniger anstregend ist, sondern weil es auch darum geht, den Stoffwechsel auf Trab zu halten.

Darum, eben weil man dem Körper keine Pause gönnt, man aber dennoch Ressourcen schonen möchte, radeln manche Triathleten ein bisserl anders als "klassische" Rennradfahrer: Man fährt mitunter "dicke" (also schwerere) Gänge bei vergleichsweise niedrigeren Trittfrequenzen – weil sich die Muskulatur mit der Umstellung danach dann (bei manchen Leuten) eine Spur leichter tut.
Wobei "leichter" etwas anderes ist als "leicht": Nach zwei Stunden auf dem Rad fühlen sich die Beine beim Losrennen eben so an, dass der von meinem Coach dafür strapazierte Vergleich schlicht nicht zitabel ist. Aber absolut zutrifft. Auch dann, wenn "unmittelbar danach" nicht mehr zu 100 Prozent stimmt.

Warum man das dann in Trainingspläne schreibt? Oder sich selbst aufträgt? Auch wenn kein Wettkampf unmittelbar ansteht? Ganz einfach: wegen der Erweiterung der Komfortzone – also des Immer-weiter-Hinausschiebens jener Grenze, an der es ungemütlich zu werden beginnt. Denn Trainingseffekte sind ja – auch – Lerneffekte: Der Körper kann in der Regel viel früher viel mehr, als der Kopf ihm zutraut – aber dass da noch was geht, lernt er am besten, wenn man es ihm beweist. Etwa wenn die nicht-zitable Beschreibungsvokabel verblasst – und aus Leiden dann sogar noch Laufen wird.

Aber nicht nur beim Triathlon oder anderen Multisportdisziplinen. Auch bei "Nur"-Läuferinnen und -Läufern, sagt Harald Fritz, macht Koppeltraining Sinn. Bei erfahrenen Langstrecken- und Ausdauersportlerinnen und -sportlern, weil die bei langen und intensiven Trainingseinheiten zwar auf alle Fälle das Einteilen der Kräfte und den Umgang mit der Ermüdung über einen langen Zeitraum intensiver Belastungen trainieren, sie auf dem Rad aber doch einen Zusatznutzen mitnehmen: Das No-Impact-Training ist zwar absolut fordernd, für Muskeln und Gelenke aber schonender und verletzungssicherer.

Auch bei "Normalos" oder Anfängerinnen und Anfängern mache Koppeltraining deshalb durchaus Sinn, sagt Fritz: "Jeder weiß, dass Longjogs, also lange Läufe in niedrigen Puls- und Belastungszonen, wichtig sind." Grob vereinfacht und unwissenschaftlich gesagt geht es darum, welche Energiereserven man wann wo abruft: In eher niedrigen Belastungsbereichen holt sich der Körper mehr Energie aus den "Tiefenspeichern", also vor allem Fettreserven – und davon hat jeder von uns genug.
Steigen Belastung und Puls, wird aber immer mehr Energie aus "Kurzzeitspeichern" abgezogen – etwa direkt aus dem Blut. Und wenn diese Reserven aufgebraucht sind, ist das Spiel vorbei. Je länger man im niedrigen Bereich unterwegs ist, je später man auf die Kurzzeitspeicher zugreifen muss, umso besser also.

Doch genau das ist das Problem vieler ungeübter Sportlerinnen und Sportler oder von Anfängern: Der Puls geht oft viel zu rasch in Bereiche, in denen dann die Energie für langes Laufen nicht verfügbar ist. Genau deshalb ist es eine langwierige, oft zähe und auch langweilige Sache, Kondition und Ausdauer überhaupt aufzubauen.
Und da kommt dann das "Koppeln" ins Spiel, sagt Ausdauercoach Harald Fritz: "Der große Vorteil des Radfahrens ist eben, dass der Puls vergleichsweise niedrig bleibt. Für Leute, die zwar laufen wollen, für die zwei Stunden aber – noch – zu viel wäre, bietet sich Koppeln da geradezu an. Eine Stunde auf dem Rad, um Körper und Feststoffwechsel auf ‚Betriebstemperatur‘ zu bringen, und dann eine Stunde laufen etwa."
Wobei Dauer und Intensität da durchaus variabel seien, erklärt der Sportwissenschafter: "Gerade für Anfänger ist Koppeln eine gute Methode, Grundkondition aufzubauen, ohne sich zu überfordern."
Wichtig sei auf dem Rad aber das gleiche wie beim Laufen: den Unterschied zwischen "mäßig" und "abschießen" sehr genau zu beachten.

Denn darüber, dass "abschießen" auf dem Rad natürlich auch geht, braucht man nicht eigens zu reden. Und wer dann nach so einer Radeinheit noch einen Koppellauf, vielleicht sogar mit verschärftem Tempo, anhängt, wird nicht nur am Anfang Probleme haben, in einer halbwegs jugendfreien, zitablen Sprache zu erklären, wie der Körper auf die Rennerei gerade antwortet.
Aber viel schlimmer: Danach wird er (oder sie) nicht so bald wieder Lust haben, die Komfortzone zu verlassen – und zu entdecken, wie schön es jenseits des eigenen Tellerrands sein kann.
Obwohl es doch genau darum geht.
(Thomas Rottenberg, 10.6.2020)
Weiterlesen: