Bild nicht mehr verfügbar.
Kurz nachdem ich vor 20 Jahren nach Deutschland umgezogen war, ich war damals 36, sah ich an der Universität Tübingen ein Flugblatt und notierte mir die Telefonnummer. Ein Forschungsprojekt der Abteilung für klinische Psychologie suchte Versuchspersonen und versprach gute Bezahlung. Einzige Voraussetzung: Arachnophobie. Ich bin in Virginia aufgewachsen, in einer feuchten subtropischen Gegend, in der Spinnen ziemlich groß und sehr giftig sein können. Ich rief an und bekam einen Termin. Ich erzählte dem netten Psychologen, dass ich vor Spinnen Angst hätte – so viel Angst offenbar, dass ich in ein Land gezogen sei, in dem sechs Monate lang Winter herrsche, nur damit ich von ihnen wegkäme. Ich wurde nicht für das Projekt genommen. Der Psychologe erklärte mir, dass Arachnophobie eine irrationale Angst vor Spinnen sei, während meine Angst rational sei.
Ich würde mich als jemand beschreiben, der sehr von Gefühlen beeinflusst ist. Als ich klein war, waren Leute gemein zu mir (ich weiß, das klingt jämmerlich, aber ich wurde viel geschlagen und gehänselt, sogar von meinen Eltern), ich hatte also kein sehr großes Selbstwertgefühl. Als Mädchen wurde ich dazu erzogen, selbstlos und unterwürfig zu sein. Wann immer ich mich also selbst behaupten wollte, musste ich zuerst meine Gefühle dazu bringen, meine Tendenz zur Unterwürfigkeit zu überwältigen. Ich beschrieb mir selbst meinen Zustand in Form einer Orgie von poetischem Selbstmitleid, bis ich heulte. In der Grundschule heulte ich mindestens einmal täglich. Ich wurde nebenbei auch sexuell missbraucht (von einem schuldlosen gleichaltrigen Kind). Irgendwann kam ich zum Schluss, dass die Schwachen soziale Außenseiter sind, und ich wechselte von Selbstmitleid zu selbstironischem Humor. Ich lernte, mich selbst sozial zu isolieren, unterstützt von Natur, Kunst und romantischer Liebe. Das half mir über die nächsten 35 Jahre, bis meine Selbstachtung sehr plötzlich zunahm, als in der New York Times eine euphorische Rezension meines ersten Romans erschien. Da war ich fünfzig. Besser spät als nie!
Was man immer verdrängt
Das Leben ist grausam. Heißt das, dass es Sinn ergibt? Ich bezweifle das. Haben Sie Pierre Bourdieus Esquisse pour une auto-analyse gelesen? Wenn jemand imstande ist, schlüssig über das Leben nachzudenken, dann Bourdieu, aber sogar er klebt – in seinem letzten Buch – am Problem intellektueller Selbstgefälligkeit fest wie eine Musil’sche Fliege an einem Fliegenpapier. Gerade wenn man sein Leben lang das Unbewusste bewusst machen will: Wie kann man dann wissen, was man immer noch verdrängt?
Ich respektiere alle, die Zeit und Mühe darauf verwenden, darüber nachzudenken. Unter Autorinnen und Autoren schätze ich strenge Denker, deren Prosa ihre Gedanken nicht ungeprüft übernimmt. Denken ist das nützlichste Werkzeug, das wir haben. Verglichen mit leidenschaftlichen Äußerungen naiver Gefühle kann es unecht, sogar unehrlich scheinen.
Ich kann mich an die expliziten, bewussten Gründe erinnern, warum ich nach Deutschland gezogen bin. Ich wollte eine Zeitlang von meinem Ersparten leben und viel nachehelichen Sex haben. Aber das kann man überall haben, wenn man Frau und sparsam ist. Der wahre Grund muss etwas Tieferes sein. Vielleicht waren es nicht die Spinnen. Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn es nicht darum geht, sich Nekrosen zu ersparen, Herzrasen, große Schmerzen, Schweißausbrüche oder Muskelkrämpfe, warum will man dann überhaupt umziehen?
1988 habe ich zum ersten Mal von Amerikanern gehört, dass sie aus politischen Gründen wegziehen würden. Der Anlass war die anstehende Wahl von George H. W. Bush, einem CIA-Funktionär, der in seiner Karriere bis zum Hals im Blut gewatet war. Er wurde gewählt. Keiner, den ich kannte, emigrierte. Das Muster wiederholte sich bei jedem republikanischen Präsidenten. Ich habe Freunde, die mir schworen, dass sie emigrieren würden, wenn Donald Trump gewählt würde. Sie reden jedes Mal, wenn ich sie sehe, über ihre Pläne, aber sie sind immer noch in Virginia.
Ich dachte viel an sie während einer der intensivsten Leseerfahrungen meines erwachsenen Lebens: Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten – die Tagebücher (1933–1949) von Victor Klemperer (1881–1960). Er war Sohn eines Rabbiners, konnte kein Französisch, lehrte aber Romanistik in Dresden. Er betrachtete das Judentum als Religion und seine ethnische Zugehörigkeit als deutsch. Viele Deutsche waren anderer Meinung. Theoretisch bieten die Bücher null Spannung. Jeder weiß, dass die Nazis Sadisten waren und dass Klemperer überlebte und Lingua Tertii Imperii ("Sprache des Dritten Reiches") schrieb. Aber die Bücher sind unendlich überraschend, weil man unmöglich glauben kann, dass ausgerechnet dieser Mann mit seinen besonderen Schwächen überleben würde.
Wie jeder normale Mensch hat er plausible Vermutungen über die Zukunft. Die Nazis werden sicherlich abgewählt. Es ist ihm peinlich, als Freunde ihm raten, sich um eine Professur in Frankreich umzusehen. Er denkt an einen Kollegen, der nach Amerika geflohen und in einer Fabrik gelandet ist. Ganz sicher wird es einen Staatsstreich geben. Als er und seine Frau sich schließlich dazu durchringen zu gehen, ist die Warteliste am US-Konsulat 56.000 Namen lang. Er ist erleichtert, als die Nazis, die ihn in den frühen Ruhestand gezwungen haben, ihm eine Pension zahlen. Er ist erfreut darüber, dass seine zunehmenden Herzprobleme ihn von der Zwangsarbeit befreien – dort haben seine verärgerten Aufseher sich darüber beschwert, dass er weniger produktiv sei als ein kleines Mädchen. Die Nazis werden doch offensichtlich den Krieg verlieren. Aber sie gewinnen ihn; wenigstens die meisten von ihnen, individuell.
Bild nicht mehr verfügbar.
Klemperer ist der perfekte Antiheld, einer der menschlichsten Charaktere in der Literatur, ein absoluter Versager bis hin zu seiner Rückkehr nach der Befreiung nach Dresden, einem von Stalinisten kontrollierten Trümmerhaufen. Es sind derartig wenige Leute in diese Richtung unterwegs – die Kapitulation hat er unter vergleichsweise idyllischen Umständen bei München erlebt –, dass er und seine Frau keine Fahrgelegenheit finden. Sie gehen schließlich zu Fuß in den Osten. Sogar die Rote Armee meint: SEID IHR DENN WAHNSINNIG?!
Auch die Tatsache, dass diese Tagebücher überhaupt existieren, zeugt von zweifelhaftem Urteilsvermögen. Die Gestapo durchsuchte regelmäßig jüdische Haushalte, und wenn sie auch nur eine Seite gefunden hätte, hätte sie ihn zu Tode gefoltert und seine Frau auch und viele andere – er hat ihre wirklichen Namen verwendet! Er weiß das. Er schreibt darüber, dass ihm das manchmal Sorgen bereitet. Aber er schreibt weiter. Er lebt, also muss schon irgendwie richtig sein, was er macht.
Schwarze leben gefährlich
Wie einst Klemperer zögern auch viele Amerikaner, das Risiko auf sich zu nehmen und ein Land zu verlassen, in dem sie überleben können. Wenn man doch nicht überlebt, dann kommt es fast immer als Überraschung, sogar für Menschen, deren Gefährdung systematisch vorbereitet wird, bevor sie noch geboren werden.
Schwarze leben gefährlich in Amerika. Jetzt sind die News voll davon, und es gibt eine riesige Protestbewegung, aber für Amerikaner sind es keine Neuigkeiten. (Wenn Sie, als gute Sozialisten, sich fragen, warum der Slogan "Black Lives Matter" lautet und nicht "All Lives Matter", dann betrachten Sie einen einfachen Syllogismus: Wenn schwarze Leben zählen, dann zählen alle Leben, denn im gegenwärtigen Amerika zählen schwarze Leben am wenigsten.)
Ich bin keine Historikerin des Rassismus, doch meine diesbezüglichen Erinnerungen begannen in der Kindheit und hörten nie auf. Getrennte Klassenzimmer, Freizeiteinrichtungen, Ferienlager, Restaurants, Karrieren. Alte Frauen, die fälschlich wegen Drogenbesitzes verklagt wurden, nach zehn Jahren aus der Haft entlassen werden und "Preiset den Herrn!" ausrufen. Morde, die nie von der Polizei untersucht werden, denn ein toter junger schwarzer Mann muss ein Drogenhändler gewesen sein und eine tote junge schwarze Frau eine Prostituierte. Ein schwarzer Freund von mir, dessen Bruder von der Polizei erschossen wurde, die ihn wegen eines kaputten Scheinwerfers angehalten hatte, sagte mir, sein Bruder habe es sich wahrscheinlich selbst zuzuschreiben gehabt, weil er unhöflich war.
Die Gefängnisrate für schwarze Männer in Amerika ist 2272 pro 100.000 Einwohner. Für weiße Männer ist sie 392, insgesamt ist sie um die 600. (In Österreich 100; in Deutschland 20, eine der niedrigsten der Welt.) Es gibt mehr Schwarze in Gefängnissen als Weiße, obwohl Schwarze nur rund 13 Prozent der Bevölkerung ausmachen.
Der Bogen des moralischen Universums ist weit, sagte Martin Luther King Jr. einmal, aber er neigt sich zur Gerechtigkeit. In den 1970er-Jahren hat die Polizei allein in Philadelphia im Durchschnitt jede Woche eine Zivilperson getötet; jetzt sind es "nur" 1000 Tote im ganzen Land (in Deutschland sind es circa 14). Das Durchschnittseinkommen eines weißen Haushalts ist eineinhalbmal so hoch wie das eines schwarzen Haushalts, aber in meiner Kindheit war es mehr als doppelt so hoch. Sogar die Gefängnisrate ist niedriger als vor ein paar Jahren. Es gibt Verbesserungen, aber angesichts der Ressourcen des reichsten Landes der Welt sind die Zustände immer noch erschreckend und obszön schlimm.
Hier ist noch eine Kindheitserinnerung: Ich saß zum Abendessen mit einem Modelleisenbahnfreund meines Vaters, der als Polizist in Washington, D.C., arbeitete. Er erklärte mir, dass er während der Arbeit nie seinen Revolver berühre. Wenn er ihn angerührt hätte, hätte er schießen müssen, um zu töten. Man könne nicht mit dem Revolver fuchteln und sagen "Hände hoch, oder ich schieße", wie man es in Filmen sieht. Wenn man ihn anrührt, muss man den anderen wehrlos machen, denn er könnte auch einen Revolver haben. Das war 1975, als noch weniger Amerikaner Waffen besaßen. Jetzt gibt es 120 zivile Waffen pro 100 Einwohner. (In Österreich ist das Verhältnis 30 pro 100; in Deutschland 20; im Vereinigten Königreich acht; in Japan 0,3; autoritäre Staaten haben ähnliche Zahlen wie Japan.) Ein Drittel der Waffen, die heute in den USA gekauft werden, sind klein und für verdecktes Tragen vorgesehen, was für Zivilisten mit Lizenz in allen 50 Bundesstaaten legal ist. 16 Staaten verlangen keine Lizenz. In 26 Staaten braucht man keine Lizenz, wenn man einen Revolver offen tragen will. Ungefähr die Hälfte der US-Haushalte hat Waffen. Erschießt man zu Hause einen Eindringling, gilt das als Selbstverteidigung. In 35 Staaten mit "Stand your ground"-Gesetzen gilt es als Selbstverteidigung, wenn man jemanden erschießt, der einen irgendwo bedroht. Zugleich ist es eine Straftat, wenn man jemanden bedroht, indem man eine Waffe schwingt oder einen Warnschuss abgibt; es ist also besser, jemanden gleich zu erschießen.
Deutschland hat ein "Stand your ground"-Gesetz, das sogar gilt, wenn jemandes Besitz bedroht wird – das ist so deutsch! Nehmen wir an, Sie verteidigen Ihr Fahrrad. Tödliche Gewalt ist nur erlaubt, wenn es um Objekte geht, die mehr als 50 Euro wert sind. Sie müssen erstens den Revolver zeigen, zweitens einen Warnschuss abgeben und drittens einen weiteren Schuss auf einen nicht lebenswichtigen Teil des Körpers des anderen abgeben, bevor Sie auf den Rumpf zielen. Bis dahin hätte jeder bewaffnete Räuber sicher als Selbstverteidigung auf Sie geschossen; Das heißt, in Deutschland geht man davon aus, dass praktisch niemand eine Waffe trägt.


1989 lebte ich in Washington, D.C.; es gab damals Kokain überall, so wie es jetzt Schmerzmittel und Opiate überall gibt. Kokain, das man rauchen konnte, war so billig, dass Leute Straftaten begingen, um auch nur an kleine Geldsummen zu kommen. Eines Nachts brach jemand in unser Gemeinschaftshaus ein, während wir schliefen. Ich wachte vom Klirren des zerbrechenden Fensterglases auf. Wir schrien, und der oder die Einbrecher rannten weg. Der Polizist, der unsere Angaben aufnahm, riet uns, eine Schrotflinte mit Pumpmechanik zu kaufen. Er sagte uns, dass eine Pistole gut sei in einer Situation, in der man sie jemandem in die Rippen stoßen oder aus der Nähe zielen könne, aber auf einen Einbrecher könne man in der Dunkelheit schlecht zielen. Wenn er aber höre, wie eine Ladung in die Pumpgun geschoben werde, dann laufe er garantiert weg.
Es war ein merkwürdiger Rat an Leute, die gerade Einbrecher durch Schreie vertrieben hatten. Ich denke, was er meinte, war: Bitte erschießt doch lieber diese Drogenabhängigen und erspart uns ein wenig Arbeit.
Es gibt seit kurzem ein Video, das einen weißen Amerikaner, Mittelschicht, zeigt, der versucht, dem Befehl zu gehorchen, in Richtung von ein paar Polizisten zu kriechen. Sie wollen, dass er sich flach am Boden windet, wie eine Robbe, damit er außer Gefahr bleibt. (Sie versuchen, jemanden anderen zu verhaften.) Doch er trägt lose kurze Hosen, die ihm immer wieder zu den Knien hinunterrutschen. Er fasst nach unten, um sie am Gürtel hochzuziehen. Caedite eos; novit enim Dominus qui sunt eius, wie Klemperer sagen würde: Tötet sie; denn der Herr kennt die Seinigen.
Amerikaner ohne Geld
Ich weiß, dass reiche Amerikaner ihr Amerika anders beschreiben. Sie finden meine Darstellung exotisch, so als wären wir nicht aus demselben Land. Meine Eltern hatten das nicht geplant, aber nach dem College wurde ich Teil der Arbeiterklasse. Arbeit in Amerika ist entweder prekär, ohne Urlaub und ohne bezahlten Krankenstand, oder sie ist Vollzeit, mit zwei Wochen Urlaub im Jahr. Freiwillige Krankenversicherung ist ein teurer Witz. Billige Wohnungen gibt es nur in gefährlichen Vierteln. Vermieter können die Miete jedes Jahr verdoppeln oder einen hinauswerfen, wenn man einen Monat im Rückstand ist. Die Sozialhilfe der Regierung ist auf fünf Jahre beschränkt, sodass Millionen Amerikaner, inklusive Kindern in einigen Bundesstaaten, kein Einkommen irgendwelcher Art haben.
Kurz, Amerikaner ohne Geld stehen unter großem Druck auszuwandern, vor allem im Süden. Wenn sie sich nicht vorstellen können, irgendwo anders zu leben, dann fühlen sie einen wachsenden Druck zu sterben.
In ihrem Statement für das Manifest der Black Artists for Freedom vom 19. Juni 2020 schrieb die Romanautorin Angela Flournoy: "Freiheit bedeutet mehr Zeit, hier zu sein, gesund und ganzheitlich auf diesem Planeten, von Sicherheit und Liebe umgeben." (Es erinnert mich an diesen Naturfreunde-Slogan in Faust: "Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.") Im Januar veröffentlichte sie einen Text im New Yorker nach ihrer Zeit an der Amerikanischen Akademie in Berlin:
Ich war nicht darauf vorbereitet, wieder in ein Land heimzukehren, wo ich mich, wie viele andere unabhängige Schriftsteller und Künstler, in einem ausbeuterischen System der Krankenversicherung zurechtfinden muss; wo ich mit Leuten, die ich lange gekannt und geliebt habe, darüber streiten muss, dass es unmoralisch ist, ein Kind als "illegal" zu bezeichnen; wo ich in Kinos auf Nadeln sitze aus Angst, dass ich erschossen werden könnte, während noch der Vorspann läuft.
Sie war so froh, weit weg von Mitbürgern zu sein, die mit AR-15-Sturmgewehren herumlaufen, dass sie gerne Abendessen mit Tischkarten in einer muffigen Villa am Wannsee auf sich nahm! Flournoy ist eine junge, schöne, gefeierte, erfolgreiche Autorin, und ihre Stimme ist ein Ruf um Hilfe.
Ich bin weißer als weiß
Journalisten fragen mich nie, ob ich plane, in Deutschland zu bleiben. Es ist ihnen klar, wie feindselig die Frage klingt. Aber Fremde, die keine Journalisten sind, fragen mich das die ganze Zeit. Warum gehe ich nicht zurück? Die Steuern sind niedriger. Ich bin weißer als weiß. Amerikaner sagen, ich sähe "aristokratisch" aus, und Kroaten sprechen mich auf Kroatisch an. Die amerikanischen Wurzeln meiner Familie reichen bis ins Jahr 1620.
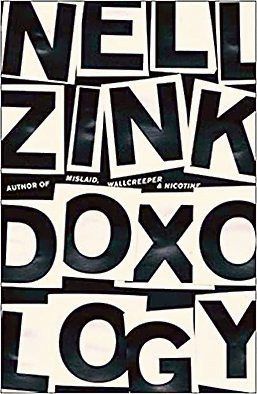
Ich würde gerne antworten: "Nett für einen Besuch, aber leben will ich da nicht." Doch in Wirklichkeit sollte man die USA nicht einmal besuchen! Kein denkender Mensch setzt auch nur einen Fuß in ein Land, wo es Todesstrafe gibt. Fehler passieren. Beweise werden untergejubelt. Aufzeichnungen werden gefälscht. Zeugen lügen. Die Polizisten sind manchmal komplette Idioten.
Reisen Sie nie, nie in ein Land – und zahlen Sie schon gar nicht dort Steuern –, deren Regierung in gutem Glauben Vereinbarungen trifft, die zu Ihrem Tod in einem Gefängnis führen. Wenn Sie sicher sind, dass Ihnen das nicht passieren kann, dann fragen Sie sich, wieso nicht. Vielleicht hilft Ihnen dabei eine gute Arbeitsdefinition von "weißen Privilegien", auch als "Bürgerrechte" bekannt.
Bis die Corona-Krise alle meine Reisepläne durchkreuzte, überquerte ich den Ozean mindestens zweimal jährlich und verdreifachte dadurch meinen CO2-Fußabdruck. Es macht natürlich Spaß, für meine Bücher zu werben, und jemand muss sich schließlich um meinen 85 Jahre alten Onkel in Los Angeles kümmern.
Ich war nie der Ansicht, dass das Leben Sinn ergibt, und ich bin nicht dankbar für meine Freiheit. Wie Klemperer sinngemäß sagt: Wenn andere leiden, dann gibt es nichts Geschmackloseres als einen Ausdruck von Dankbarkeit dafür, dass man selbst verschont wurde. (Nell Zink, 4.7.2020)