
Ein Stück Zeitgeschichte
Im Oktober 2020 jährte sich der erste Bericht über die Machenschaften von Harvey Weinstein zum dritten Mal. Die "New York Times"-Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey arbeiteten seit dem Frühsommer 2017 an den Recherchen zu den Vorwürfen an den Hollywood-Produzenten, die schon einige Jahre dahinköchelten. Dennoch wurden sie nie richtig ernst genommen, ebenso wie die Arbeit anderer Journalist*innen in dieser Sache von verschiedenen Stellen im Keim erstickt wurde.
Jodi Kantor ist eine seit Jahrzehnten bei der "New York Times" beschäftigte Reporterin, die bereits zahlreiche Skandale rund um Geschlechterdiskriminierung aufdeckte. Megan Twohey arbeitete erst kurz für die "New York Times", als Kantor und Twohey ihre Zusammenarbeit im Fall Weinstein begannen.
Twohey recherchierte kurz zuvor zu den diversen Vorwürfen der sexuellen Belästigung durch Donald Trump und bekam den geballten Hass zu spüren, wenn jemand massiv übergriffiges Verhalten durch mächtige Männer thematisiert, all die Skepsis, die Rufe nach mehr Beweisen, das Abwiegeln der Übergriffe. Das Buch der beiden Journalistinnen zeigt, wie besonders genau Berichte über sexuelle Diskriminierung und Gewalt ausgearbeitet werden müssen, damit sie eine Chance auf Beachtung finden und nicht in der Luft zerrissen werden.
Kantor und Twohey haben parallel zu Ronan Farrow recherchiert, der den Vorwürfen gegen Weinstein für den "New Yorker" nachging. Die "New York Times" war letztlich mit dem Artikel über die systematische sexualisierte Gewalt in Hollywood, der kurz darauf die #MeToo-Bewegung auslöste, etwas früher dran. Auch Farrow veröffentlichte ein Buch über seine Arbeit an der Story, einen spannenden Recherche-Krimi ("Catch and Kill"). In diesem Buch von Kantor und Twohey erfahren wir hingegen deutlich mehr über jene Frauen, die endlich reden wollten, über Hindernisse in Bezug auf die Quellen und die Beweggründe, diese letztlich doch beiseite zu schieben. Ein Buch, das ein wichtiges Stück Zeitgeschichte dokumentiert.
Jodi Kantor, Megan Twohey: "#MeToo. Von der ersten Enthüllung zur globalen Bewegung". € 18 / 448 Seiten, Tropen-Verlag, Stuttgart 2020

Gegen die Grauzonen
Bereits zwei Jahre vor #MeToo hat die damals im EU-Parlament beschäftigte Sara Hassan begonnen, sich mit Kolleg*innen zu organisieren, um sich über systematische Übergriffe am Arbeitsplatz auszutauschen und Strategien zu entwickeln, wie man sich gegen Belästigung zur Wehr setzen könne.
Dieses Jahr erschien "Grauzonen gibt es nicht" von Sara Hassan und Juliette Sanchez-Lambert im ÖGB-Verlag auf Deutsch, nachdem 2019 mit "It's not that Grey" ein erster Ratgeber auf Englisch veröffentlicht wurde. In beiden Fällen sollen Muster sexueller Belästigung durch ein "Red-Flag-System" erkannt werden.
2019 lag der Fokus auf den Betroffenen und den Strategien, wie mit Belästigung umgegangen bzw. danach reagiert werden kann. In "Grauzonen gibt es nicht" fügten die Autor*innen ein Kapitel hinzu, das sich direkt an Umstehende und Beobachter*innen gewaltvoller Übergriffe wendet. Denn: "Als Betroffene von sexueller Gewalt werden unsere Leben aus der Bahn geworfen, und uns wird unendlich viel abverlangt, um die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Die Verantwortung, gesellschaftliche Veränderung voranzutreiben, kann nicht auch noch auf unseren Schultern lasten."
Was beide Ratgeber lesenswert macht: Die detaillierte Beschreibung möglicher "roter Fahnen", die anhand konkreter Erfahrungen von Betroffenen anschaulich vermittelt werden. Besonders hilfreich: Die Beispiele aus dem Alltag sind in "Grauzonen gibt es nicht" zweimal hintereinander zu lesen. Zuerst in einer Version, die Platz für eigene Notizen bietet, und dann gleich noch einmal – aber mit Anmerkungen der Autor*innen und von ihnen markierten "roten Fahnen". Dabei wird klar, was sich alles schon im Vorfeld anbahnt – während in der Öffentlichkeit allzu oft nur die krassen, expliziten Ausprägungen von Belästigung erkannt werden. Ziel des Ratgebers ist, ein eigenes zuverlässiges Warnsystem zusammenzustellen, um Belästigung im Alltag schon früh erkennen zu können.
Sara Hassan, Juliette Sanchez-Lambert: "Grauzonen gibt es nicht. Muster sexueller Belästigung mit dem Red Flag System erkennen". € 10 / 97 Seiten, ÖGB-Verlag, Wien 2020 oder gratis als PDF

Unaufgearbeitet und nur schön dahingesagt
Die Lyrikerin und Essayistin Esther Dischereit versammelte in "Mama, darf ich das Deutschlandlied singen" Interviews, Aufsätze und Prosatexte.
Sie zeigt in dieser aktuellen Testsammlung unter anderem, wie erschreckend unaufgearbeitet die jüngeren rassistisch motivierten Morde und antisemitischen Anschläge in Deutschland sind. Sowohl auf der Ebene des Denkens in Zugehörigkeiten und Ausgrenzung als auch auf der ganz profanen Ebene der Justiz, Stichwort NSU-Prozess. Das Ringen von Politiker*innen um Worte nach antisemitischen Attentaten und Terror untersucht Dischereit auf die darin enthaltenen Botschaften an Menschen jüdischer Identität, aber auch an andere, wie etwa Rom*nja sowie die muslimische oder türkische Community.
Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte etwa nach dem Anschlag in Halle, sie sei "froh über jede Synagoge, über jede jüdische Gemeinde und über alles jüdische Leben in unserem Land". Und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "Ja, wir wollen die jüdische Gemeinde in unserem Land." Davon abgesehen, dass andere Gemeinschaften nie – auch nicht nach Angriffen auf sie nicht – etwas Vergleichbares aus der Politik hören, stellt Dischereit an solchen Aussprüchen für sich fest: "Es muss überhaupt niemand froh oder nicht froh darüber sein, dass es mich gibt. Ich bin da, gleichgültig, ob jemand froh darüber ist oder nicht."
Völlig egal, welche Textform sie wählt, Dischereits politische Analysen zu Antisemitismus, rechter Gewalt und Terror sowie ihre scharfsinnigen sprachpolitischen Beobachtungen des Umgangs der Politik damit sind politische Bildung im besten Sinne.
Esther Dischereit: "Mama, darf ich das Deutschlandlied singen", € 19 / 237 Seiten, Mandelbaum-Verlag, Wien 2020
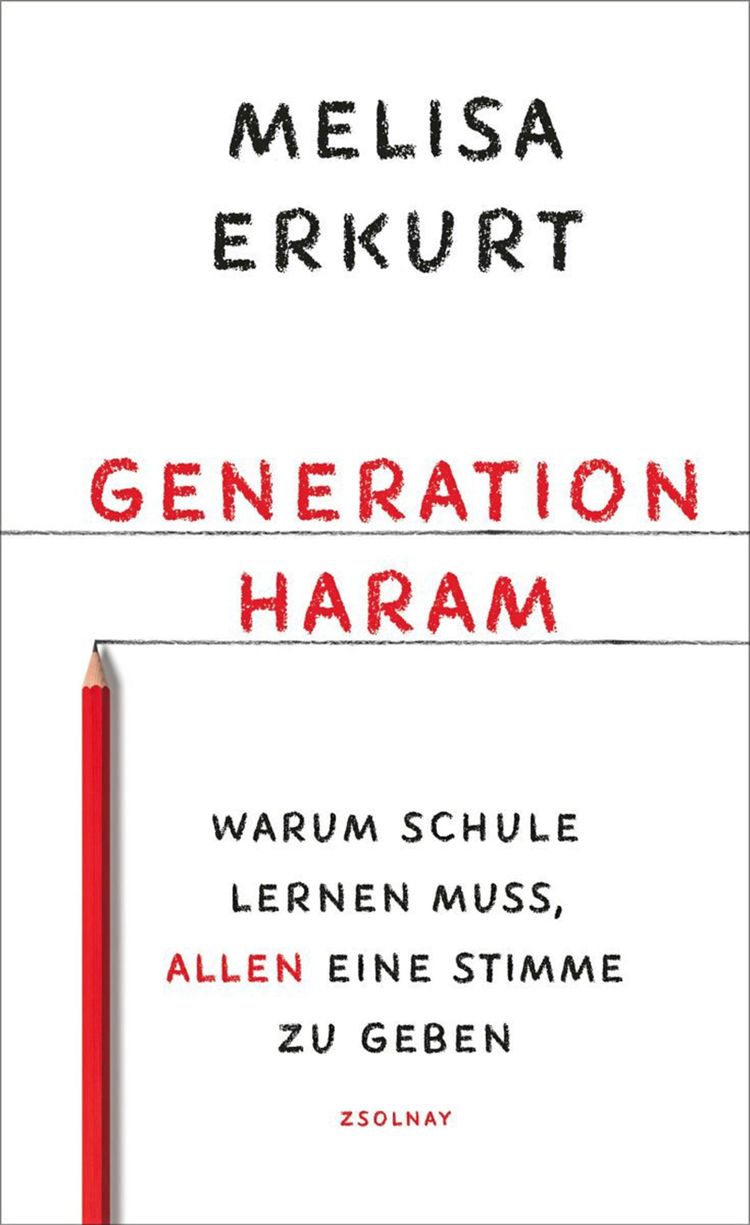
Bildungsverlierer*innen am Wort
"Warum Schule lernen muss, allen einen Stimme zu geben", ist etwas, das Melisa Erkurt in ihrem Buch darlegt. Auch jener "Generation Haram", auf die sich der Titel bezieht und über die die Autorin, Journalistin und ehemalige Lehrerin 2016 eine preisgekrönte Reportage schrieb. Anhand ihrer eigenen Erfahrung sowie zahlreicher Stimmen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsgeschichte oder Fluchterfahrung beschreibt Erkurt den Alltag migrantischer Menschen in der Schule und wie wenig Rücksicht auf sie im Bildungssystem genommen wird.
Auf die auch bei Lehrkräften vorherrschenden Stereotype würden sie entweder mit Rebellion reagieren oder mit der Lebensaufgabe, "die perfekten Repräsentantinnen und Repräsentanten ihrer Gruppe" zu sein. "In beiden Fällen können sie nicht einfach Kind und Teenager sein wie ihre Kolleginnen und Kollegen ohne Migrationshintergrund."
Erkurt plädiert nicht nur für eine verschränkte Ganztagsschule und ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, sondern vor allem für einen anderen Zugang in der Bildungsdebatte, der die Eltern weniger in die Pflicht nimmt – denn "bestraft werden immer die Kinder". Mit ihrer Forderung, dass nun die Verlierer*innen mit Reden dran sein müssten, und dem vielen Raum, den Erkurt ihnen in ihrem Buch einräumt, leistet sie nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur aktuellen Bildungsdebatte, sondern spricht auch heute erwachsenen Menschen mit Migrationsgeschichte aus der Seele.
Melisa Erkurt, "Generation Haram. Warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben". 20,60 Euro / 192 Seiten. Zsolnay, Wien 2020
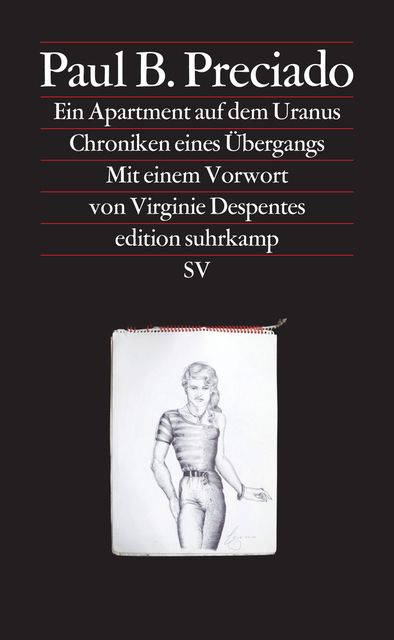
Wer sind wir, wenn wir nicht Männer oder Frauen sind?
J. K. Rowling stieß in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres eine Debatte über Transpersonen an. Es war dieser herablassende Ton, wie er bei Genderthemen so oft zu finden ist, in dem Rowling meinte, auf Twitter erklären zu müssen, dass es bitte schön immer noch Frauen seinen, die menstruieren. Eine NGO hatte sich zuvor erdreistet, von "menstruierenden Menschen" zu sprechen. Wie kleingeistig eine derartige als Richtigstellung getarnte Zurechtweisung ist, die sich noch dazu als feministisch generierte, vermochten leider nur wenige der wütenden Kommentare – ebenso in sozialen Medien – gegen Rowling zu zeigen.
Dabei ist es tatsächlich eine sehr begrenzte Vorstellung von Feminismus, dass wir Zwänge aufgrund von Geschlecht, Klischees, Normen und somit Unterdrückung nur bekämpfen könnten, indem wir auf einige biologische Differenzen beharren. Das 2020 erschienene Buch des Philosophen und Queer-Theoretikers Paul B. Preciado denkt darüber weit hinaus. In "Ein Apartment auf dem Uranus" versammelt er seine seit einigen Jahren für die "Libération" verfassten Kolumnen, die sich unter anderem mit seiner Transition in einen Transmann beschäftigen.
Wobei das auch nicht ganz stimmt, denn es geht weniger darum, ein "Mann zu werden", als um das Erleben einer ständigen Transition. Es gehe ihm um ein "utopisches Geschlecht", wie die französische Autorin und enge Gefährtin Preciados, Virginie Despentes, in ihrem Vorwort schreibt. Was, wenn wir jenseits der zweitgeschlechtlichen Kategorien denken, lieben und leben? Jenseits der "von der Macht festgeschriebenen Karte", eine Karte, die "nicht das Gebiet des Lebens ist" fragt Preciado. "Wenn es aber Homosexualität und Heterosexualität, Intersexualität und Transsexualität nicht gibt, wer sind wir dann? Wie lieben wir? Malen wir es uns aus?" Das sind doch die wirklich interessanten Fragen.
Paul B. Preciado: "Ein Apartment auf dem Uranus. Chroniken eines Übergangs". € 20,60 / 367 Seiten, Suhrkamp, Berlin 2020

Keinen Keks für das Minimum
Während das Genre nicht ausstirbt, Männern zu erklären, dass sie sich für Gleichberechtigung engagieren sollten, weil auch ihnen der Feminismus etwas bringt, geht die Autorin Pauline Harmange einen anderen Weg: Mit "Ich hasse Männer" plädiert sie für die Abschaffung des Mannes als relevanten Faktor feministischen Engagements und fordert dazu auf, Männer zu ignorieren, denen es nicht genug ist, aus Solidarität Feministen zu sein. Sie stellt die berechtigte Frage, ob sie die Anstrengungen überhaupt wert seien, wenn "hinter jedem Mann, der sein männliches Privileg zumindest ansatzweise reflektiert, mehrere Frauen stehen, die ihm in harter Arbeit die Augen geöffnet haben". Zugleich gebe es ohnehin "viel zu viele Männer, deren Augen ebenso hoffnungslos wie hartnäckig geschlossen bleiben".
Für die Autorin sind Misandrie und Misogynie nicht einfach zwei Seiten derselben sexistischen Medaille: Männerhass sei eine Reaktion auf Frauenhass, fordere keine Opfer und sei letztlich angesichts der Zahlen zu Belästigungen, Vergewaltigungen und Femiziden eine Vorsichtsmaßnahme. Harmange verurteilt nicht nur die Taten und Täter, sondern auch jene, die nichts dagegen tun bzw. nicht gegen das Patriarchat aufbegehren.
Harmange schreibt für junge Frauen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die sich fragen, warum sie jetzt schon ins Strudeln geraten, obwohl Frankreich quasi Vorreiter ist, wenn es darum geht, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Damit lässt die Autorin den intersektionalen Aspekt leider außer Acht: Denn Hass auf Männer kann sich nur leisten, wer nicht ökonomisch von ihnen abhängig ist. Für diese nach Erfolg strebenden Frauen schafft Harmange einen Raum, in dem sie ihren eigenen Frust, ihre Wut, ihre Ängste wiederfinden können und der ihnen zeigt, dass eine Welt jenseits der Männer und ohne deren Engagement für Gleichberechtigung möglich ist.
Pauline Harmange, "Ich hasse Männer", € 8 / 112 Seiten, Rowohlt, Berlin 2020
(Beate Hausbichler, Noura Maan, 29.12.2020)