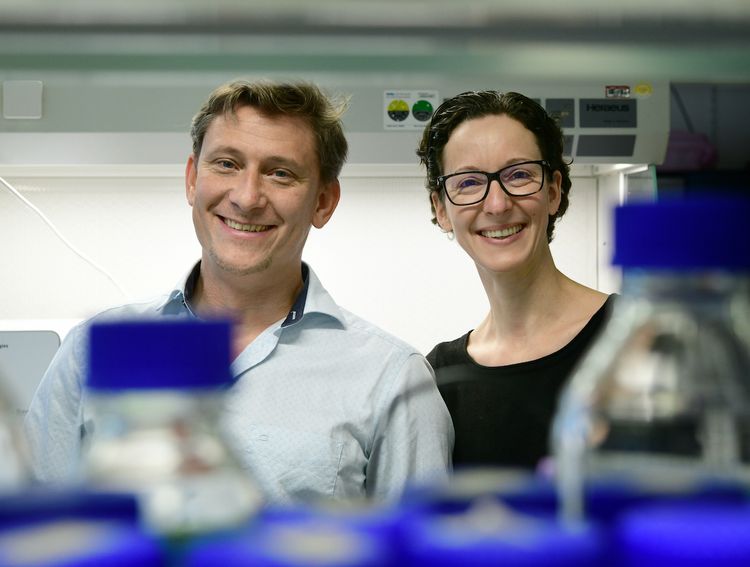
Ulrich Elling und Luisa Cochella sind mitverantwortlich dafür, dass wir in Österreich immer besser über die Verbreitung der gefährlichen Virusmutationen Bescheid wissen.
An diesem Mittwochmittag herrscht in einem der Hightech-Laborräume des Vienna Biocenter im dritten Wiener Gemeindebezirk konzentrierte Betriebsamkeit. Zwei junge Mitarbeiter holen aus Kunststoffboxen, die mit Eis gekühlt sind, kleine Paletten mit jeweils 96 Virusproben. "Keine Angst, die sind ungefährlich", lässt Ulrich Elling den vorsichtig näher tretenden und etwas misstrauischen Laborbesucher wissen.
"Die Proben sind gerade mit dem Lieferwagen aus Osttirol angekommen", fügt der Genomik-Experte vom Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der ÖAW hinzu. Noch am Vormittag haben er und sein Team – nach einem Anruf des Ages-Chefinfektiologen Franz Allerberger – auch noch kurzfristig Proben aus Nordtirol erhalten, also aus dem europäischen Hauptverbreitungsgebiet der südafrikanischen Virusvariante B.1.351.
Der aus Deutschland stammende Elling ist mit seiner Kollegin Luisa Cochella vom Partnerinstitut IMP (Institut für Molekulare Pathologie) mitverantwortlich dafür, dass man in Österreich einen zunehmend besseren Einblick darin gewinnt, welche Virusmutationen im Land wie häufig vorhanden sind. Nach diesem Wochenende werden die beiden mit ihrem Team in gerade einmal fünf Wochen nicht weniger als 10.000 Proben teilsequenziert haben – mit einer neuen Methode, die sie selbst entwickelt haben und die weltweit einzigartig ist.
Präparation der Proben
Nun sitzen sie nebeneinander an einem kleinen Roboter, nehmen die kleinen gekühlten Paletten mit den Proben entgegen, die sie mit einem Barcode identifizierbar machen. Der wird allerdings nicht umständlich außen an den Proben aufgeklebt, sondern von der Maschine allen 96 Proben auf einmal in Form von winzigen DNA-Schnipseln direkt zugegeben.

Damit sind weitere Proben für den Sequenzierungsdurchgang an diesem Wochenende vorbereitet, bei dem weitere 2.000 österreichische Sars-CoV-2-Infektionsfälle auf alle wichtigen Mutationen analysiert werden, was nicht weniger als 130 Gigabyte Daten produzieren wird.
Solche Sequenziermengen sind auch im internationalen Vergleich ein Spitzenwert. Dass so etwas in Österreich möglich ist, liegt nicht allein an der Hightech-Infrastruktur, die den beiden Forschern am Vienna Biocenter zur Verfügung steht. Die Grundlagenforscher, die eigentlich an ganz anderen Fragestellungen arbeiten, haben die Technik namens "Sarseq" quasi nebenbei auch selbst entwickelt.
"Ursprünglich arbeiteten wir ab März an einem neuen Schnelltest mittels sogenannten Next Generation Sequencing (NGS), bei dem man bis zu 36.000 Proben auf einmal analysieren kann, ob sie positiv sind", sagt die gebürtige Argentinierin Cochella, die lange in den USA forschte. Das sei mit der Methode auch gelungen, und der dazugehörige Aufsatz ist längst auch publiziert. Doch ein großflächiger Praxiseinsatz der Methode hatte sich in der Zwischenzeit durch die Einführung der Antigen-Massentests erübrigt.
Die Herausforderung der Mutanten
Im Dezember zeichnete sich dann allerdings ab, dass die Pandemie noch einmal ganz neue Herausforderungen bringen würde. Man wusste zwar von Beginn an, dass sich das neue Coronavirus genetisch leicht verändert wie alle anderen Viren auch. Doch erst mit der britischen Variante B.1.1.7, die gleich 17 verschiedene Mutationen auf einmal aufwies, wurde offensichtlich, dass Sars-CoV-2 seine Eigenschaften ändern kann. Und die südafrikanische Variante B.1.351, die ebenfalls zahlreiche Einzelmutationen aufweist, dürfte die Wirksamkeit bestimmter Impfstoffe beeinträchtigen.
Mit diesen tückischen Mutanten reichte es nun nicht mehr, infizierte Personen durch Tests möglichst schnell zu identifizieren. Um zu wissen, wo die gefährlichen Mutanten bereits Fuß gefasst haben, ist es nötig geworden, positive Proben auch noch zu sequenzieren.
Der Königsweg dafür ist die Vollgenomsequenzierung. In Österreich ist diesbezüglich Andreas Bergthaler am Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der ÖAW der große Pionier, der – zunächst in Eigenregie – im Laufe des Jahres 2020 über 1.300 Virusgenome sequenzierte. Der Nachteil dieser Methode, bei der alle 29.000 Basenpaare des Virus ausgelesen werden: Sie ist recht zeit- und ressourcenintensiv, und Bergthalers Team schafft pro Woche maximal 400 Proben.
Zusätzliche Arbeit über Weihnacht
Franz Allerberger, der als Ages-Chef für öffentliche Gesundheit auch für das Aufspüren der Virusmutationen zuständig ist, fragte deshalb kurz vor Weihnachten auch bei Cochella und Elling nach, ob sie ihre Methode auf Sequenzierungen umrüsten könnten. Während andere Ferien machten, arbeiteten die beiden unter Hochdruck daran, ihr Verfahren zu adaptieren, um damit das gesamte S-Gen des Virus zu sequenzieren. "Das sind jene rund 2.100 Basenpaare, die für das Spikeprotein des Virus zuständig sind", wie Elling erklärt. "Und alle wichtigen Mutationen der neuen Virusvarianten befinden sich in dem Bereich, der das Andocken des Virus an die Zellen und dessen Eindringen steuert."
Das Team hat mit seiner ingeniösen Methode in kürzester Zeit – und einigen Wochen mit zusätzlich 60 Wochenstunden neben der anderen Forschung – viel Licht ins Dunkel der Virusmutationen gebracht. Dass in Tirol, wie von dortiger Seite oft kolportiert, am meisten sequenziert wird, stimmt freilich nicht: Erstens geschieht das vor allem in Wien, auch wenn mittlerweile auch die Virologin Dorothee von Laer an der Med-Uni Innsbruck ebenfalls, aber mit einer älteren Methode (teil)sequenziert. "Zweitens haben wir auch aus vielen anderen Bundesländern mindestens ebenso viele Proben analysiert", sagt Elling.
Aufgrund der Effizienz von Sarseq gehen auch die meisten (teil)sequenzierten Virusvarianten, deren Zahlen von der Ages seit Mittwochabend veröffentlicht werden, auf das Konto des Teams von Cochella und Elling. Die Forscher fahnden freilich nicht nur nach den charakteristischen Mutationen der südafrikanischen und der britischen Mutante, die sich alle am S-Gen befinden, sondern nach weiteren Veränderungen ebendort. "Das könnte künftig auch bei der Entwicklung veränderter Impfstoffe helfen, die ja auch alle am Spikeprotein ansetzen", erklärt Elling.
Ergebnisse stimmen nachdenklich
Was die beiden bei den bisherigen Sequenzierdurchgängen gefunden haben, stimmt etwas nachdenklich: "Wir sehen jetzt schon, dass es kaum mehr Fälle des ursprünglichen ,Normaltyps‘ gibt", sagt Cochella und zeigt auf ihrem Laptop einige der Ergebnisse in Form langer Kolumnen: "Viele der Proben weisen mittlerweile auch einzelne jener unangenehmen Mutationen auf, wie sie auch in B.1.1.7 oder B.1.351 vorkommen, ohne dass es sich dabei um die britische oder englische Variante handeln würde."
Warum das so ist, liegt für die Forscherin auf der Hand: "Das Virus passt sich einfach immer besser an den Menschen an", sagt Cochella und nennt im selben Atemzug ein ziemlich logisches Argument für möglichst geringe Infektionszahlen: "Je mehr Ansteckungsfälle es gibt, desto mehr Chancen hat das Virus, Mutationen zu entwickeln, die es ansteckender machen oder die es ihm ermöglichen, den Immunschutz zu überlisten."
Auch Ulrich Elling tritt dringend dafür ein, die Evolution dieses Virus möglichst zu verlangsamen. Denn diese könnte im schlimmsten Fall dazu führen, "dass die bisherigen Impfungen zum ,Rohrkrepierer‘ werden". (Klaus Taschwer, 12.2.2021)