Teilchen, die die Eigenschaften von Materie bestimmen

"Wenn im Teilchenbeschleuniger des europäischen Kernforschungszentrums Cern bei Genf zwei Protonen mit hoher Energie aufeinandertreffen, darf man sich das nicht wie zwei Gläser vorstellen, die beim Zusammenstoß Scherben produzieren", sagt Claudia-Elisabeth Wulz, die am Institut für Hochenergiephysik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und am CMS-Experiment am Cern tätig ist.
Die Teilchen zerfallen nicht einfach in noch kleinere Teilchen. "Die Geschwindigkeit ist plötzlich null, die Energie ist hingegen noch da. Relativitätstheorie und Quantenmechanik erlauben, dass aus dieser Energie wiederum Masse entsteht", erklärt Wulz. "Aus dem Ereignis gehen neue Teilchen hervor, und hin und wieder kann eines entdeckt werden, das man noch nicht kennt."
1034 Jahre
Die Teilchen, aus denen unsere Welt aufgebaut ist, sind extrem langlebig. Elektronen zerfallen nach heutigem Kenntnisstand überhaupt nicht, Protonen werden, wenn überhaupt, erst nach unvorstellbaren 1034 Jahren instabil. Doch viele der Teilchen, die am Cern unter den extremen Bedingungen einer Protonenkollision entstehen, sind für menschliche Zeitvorstellungen extrem kurzlebig. B-Mesonen, deren Zerfallsmessdaten kürzlich weltweite Schlagzeilen als Hinweisgeber auf eine "neue Physik" machten, gehören noch zu den langlebigsten Produkten des Teilchenbeschleunigers. Sie existieren gerade einmal 10-12 Sekunden lang, also ein Millionstel einer Millionstelsekunde.
Teilchen und ihre Zerfallsprodukte werden registriert, wenn sie mit einem Detektormaterial interagieren. Aus den Messdaten kann auf ihre Eigenschaften geschlossen werden, darunter auch auf Masse und Lebensdauer. Eines der wichtigsten Werkzeuge dabei ist die Heisenberg’sche Unschärferelation, mit der Lebensdauer und Masseverteilung eines Teilchens in Zusammenhang gebracht werden.
Die Lebensdauer der am Cern entdeckten Teilchen – die Experimente stellen im Grunde die Vorgänge kurz nach dem Urknall nach – hat Einfluss auf das Verhalten von Atomen und damit auf die grundlegenden Eigenschaften von Materie. "Die Lebensdauer von W- und Z-Bosonen, die bei 10-25 Sekunden liegt, bestimmt den radioaktiven Zerfall von Atomen", gibt Wulz ein Beispiel. "Die Lebensdauer des vor neun Jahren erstmals nachgewiesenen Higgs-Bosons ist mit 10-22 Sekunden dagegen tausendmal länger. Sie hat unter anderem Auswirkungen auf die Größe und die Stabilität der Atome."
Suche nach langlebigen Zeugen der Vergangenheit

Die Fähigkeit von Gegenständen, lange Zeiten zu überdauern, bestimmt auch das Bild, das wir von der Vergangenheit haben. In der Archäologie werden diese Artefakte erforscht, um sie in dieses Bild richtig einzuordnen. "Auf der einen Seite beruht das ganze Fachgebiet der Archäologie auf der Langlebigkeit von Materialien", sagt Michaela Binder, die für die archäologische Grabungsfirma Novetus in Wien tätig ist. "Auf der anderen Seite könnten wir uns ohne die Archäologie gar nicht mit der Langlebigkeit von Objekten und der Frage, wie lange Spuren von ihnen im Boden bleiben, auseinandersetzen."
So betrachtet ist die Archäologie selbst eine Wissenschaft der Langlebigkeit – mit vielen dazupassenden Kontexten: Zum Beispiel stellt sich bei menschlichen Überresten nicht nur die Frage, wie alt sie sind, sondern auch die, wie lange die Menschen, von denen sie Zeugnis geben, gelebt haben. "Sind sie im Erwachsenenalter nach Ende der körperlichen Wachstumsprozesse gestorben, kann nur noch über Abnutzungserscheinungen auf das Alter geschlossen werden", erklärt Binder. "Diese Abnutzung ist wiederum stark von den Lebensbedingungen abhängig. Es gibt keine Methode, die gerade bei im hohen Alter Verstorbenen eine genaue Aussage treffen lässt."
Mühsam rekonstruiert
Man darf auch nicht übersehen, was Knochen, Steinhäuser oder Keramikscherben verschweigen – die Ausgestaltung all des organischen Materials, von dem nichts Greifbares blieb. All die geflochtenen Körbe, die Textilien, die Farben, die den Alltag bestimmten, müssen mühsam rekonstruiert werden. Nicht alles wurde in Keramik gelagert und auch antike Skulpturen waren einmal farbenprächtig bemalt. "Generell war Holz über viele Jahrtausende der wichtigste Bau- und Werkstoff. Darauf stoßen wir nur durch Zufallsfunde, wenn zum Beispiel in Mooren oder im Seeschlamm etwas erhalten geblieben ist", sagt Binder. "Gerade in der Betrachtung nördlicher Kulturen führt das zu einem verzerrten Bild. In Nordafrika haben sich Holz und andere organische Materialien dagegen viel besser erhalten."
Vor ihrer aktuellen Tätigkeit war Binder als Bioarchäologin für die Österreichische Akademie der Wissenschaften tätig. Im Rahmen ihrer Dissertation am British Museum führte sie Grabungen im Sudan durch. "Dort stießen wir auf vollständige Holzsärge, die 3000 Jahre alt waren, und auf vollständig erhaltene Mumien, von denen man Frisur und Gesicht erkennen konnte", schildert die Archäologin. "Das eröffnet noch einmal einen ganz anderen Zugang zur Vergangenheit."
Von Menschen verursachte Gefahren ohne Ablaufdatum

Geht es um ihr Forschungsfeld der Altlasten, klingt für Verena Winiwarter das Wort "Langlebigkeit" viel zu positiv. "Reden wir lieber von langwierigen Problemen, die aus der ausgeprägten Fähigkeit des Menschen entstehen, die Erde zu vergiften", sagt die Umwelthistorikerin und Professorin am Institut für Soziale Ökologie der Wiener Boku.
Bei langfristigen Altlastproblemen denken wohl viele Menschen zuerst an radioaktiven Abfall, der in Endlagern über hunderttausende Jahre abgeschirmt werden muss, bevor die Strahlung wieder ein verträgliches Maß erreicht. Doch Substanzen wie Schwermetalle, die durch menschliche Aktivitäten zur Altlast wurden, bringen nicht einmal diese Perspektive mit. Viele der Krebs verursachenden oder neurotoxischen Materialien werden die Natur gefährden, solange es sie gibt.
Ein eindringliches Beispiel gibt Winiwarter mit der Giant Mine nahe Yellowknife in Kanada, wo bis 2004 Gold abgebaut wurde. Als Nebenprodukt der Minenarbeit fielen dort 237.000 Tonnen Arsentrioxid an, das in unterirdischen Kammern lagert. "Das ist eine hochgiftige Substanz, die geschmack- und geruchlos sowie wasserlöslich ist", erklärt Winiwarter. "Entsprechend auf dem Globus verteilt, könnte man mit der Menge den Großteil der Menschheit ausrotten."
Warnung an die Nachfahren
Damit das Gift an Ort und Stelle bleibt, darf kein Wasser eindringen. Kanadas Regierung setzt daher milliardenschwere Maßnahmen, um den Untergrund mittels "wartungsfreier" Wärmetauscher auf Dauer gefroren zu halten. Doch das langfristige Schicksal der Lagerstätte unter Klimawandelbedingungen bleibt unberechenbar. "Wie soll man Erdbewohnern, die 50.000 Jahre in der Zukunft leben, die Gefahr kommunizieren? Nichts hat so lange Bestand", sagt Winiwarter. "Die lokale indigene Bevölkerung hat die Mine deshalb als ein neues ‚Monster‘ in ihre Mythen eingeführt, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die Bewohner glauben, dass das ihre beste Chance ist, ihre Nachfahren zu warnen."
"Die Menschen leben auf einer toxischen Müllhalde, und die Politik ignoriert dieses Problem", lautet das düstere Urteil der Wissenschafterin. Doch nicht jeder Eingriff des Menschen in die Natur sei per se negativ. "Als Beispiel für eine langanhaltende positive Einflussnahme kann man die Entstehung der Terra preta im Amazonasgebiet sehen", sagt Winiwarter. "Die durch Menschenhand mit Holzkohle und Tonscherben versetzte ‚schwarze Erde‘ steigert für viele Jahrhunderte die Fruchtbarkeit des Bodens. Das ist eine Hinterlassenschaft, die die Bezeichnung ‚langlebig‘ verdient."
Sensoren für ein langes Leben von Leichtbauteilen
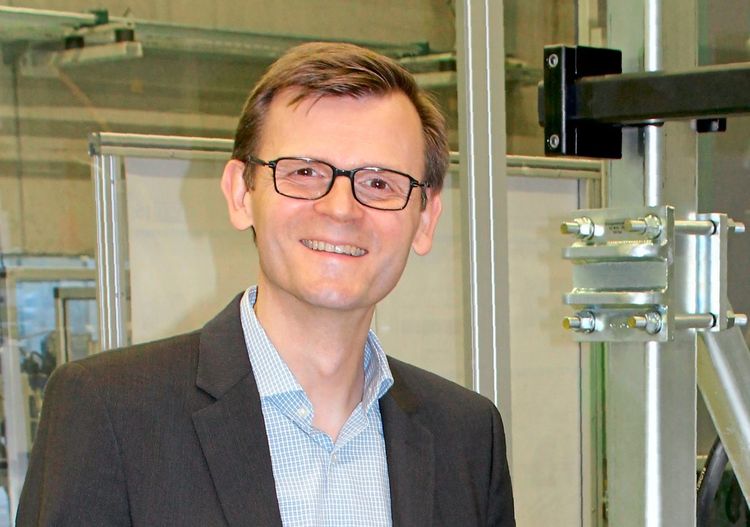
Von Verkehrsflugzeugen wird eine Lebensdauer von 25 Jahren oder 50.000 Flugstunden erwartet. Auf der Langstrecke sollen 20.000 Starts absolviert werden können, auf Kurzstrecke sogar 75.000. Die Entwickler arbeiten aber auch daran, die Konstruktionen leichter und energiesparender zu machen.
Die Faktoren Langlebigkeit und Gewichtsreduktion schließen einander zwar nicht aus, sie stehen aber doch oft in einem Konkurrenzverhältnis. "Leichtbau ist eine Optimierungsarbeit. Man greift in jede Trickkiste, um Gewicht zu sparen. Eine der Nebenbedingungen, die in die Optimierung miteinbezogen werden müssen, ist aber die erforderliche Betriebszeit", sagt Martin Schagerl, der das Institut für Konstruktiven Leichtbau der Johannes-Kepler-Universität Linz leitet.
Leichtbauentwicklung ist immer auf eine konkrete Anwendung fokussiert. "Teil des Konzepts sind Vorgaben für den Einsatz – zum Beispiel welche Manöver mit einem Flugzeug durchgeführt werden dürfen – sowie strenge Inspektionsprogramme, die etwa die Materialermüdung kontrollieren", erklärt Schagerl. Rigide angewendet lässt sich damit die Einsatzdauer weiter verlängern. Beim Airbus A320 wird etwa eine verfeinerte Inspektion angeboten, die die Lebenserwartung auf 120.000 Flugstunden verdoppeln soll.
Health-Monitoring der Technik
Bei Militärflugzeugen, bei denen die Belastungen viel schwerer vorhersagbar sind, laufen dagegen zusätzlich auf Basis von Sensoren im Flugzeug und Telemetriedaten im Hintergrund eigene Simulationen mit, die den Zustand der Materialien abzuschätzen helfen. Ist ein Grenzwert für ein Bauteil erreicht, verliert es die Zulassung und wird ausgetauscht.
Für Schagerl ist Health-Monitoring, die automatische Überwachung des Materialzustands, ein großes Thema. Sein Team arbeitet an Sensortechnologien, die auch im Bereich von Zivilflugzeugen Bauteile während ihres Einsatzes prüfen können und Alarm schlagen, wenn die Daten auf ein ungewöhnliches Verhalten hindeuten. Die Einsatzdauer der Bauteile kann so maximiert werden.
"Technisch kann ein derartiges System etwa mit Sensoren umgesetzt werden, die den elektrischen Widerstand in Metall- oder Faserverbundbauteilen messen. Aus den Daten zur Leitfähigkeit wird auf Schädigungen zurückgeschlossen", erklärt Schagerl. Auch bei Brücken, die weniger auf Leichtbau und mehr auf Langlebigkeit hinoptimiert werden, überwachen bereits spezielle Sensoren die Konstruktionen und schlagen Alarm, wenn Gefahr gegeben ist, dass die Tragfähigkeit nachlässt.
Pflanzensamen mit Geduld und Ausdauer

Wie lange kann man Saatgut aufbewahren? Und wie wirkt sich der Klimawandel auf die Haltbarkeit der Pflanzensamen aus? Das sind Fragen, mit denen sich Ilse Kranner vom Institut für Botanik der Universität Innsbruck beschäftigt. Die Antworten darauf sind nicht nur für Landwirtschaft und Agrarunternehmen, die mit Veränderungen durch den Klimawandel umgehen müssen, relevant, sondern etwa auch für die Erhaltung der bestehenden Biodiversität in Genbanken für zukünftige Generationen.
Die meisten Pflanzen verfügen selbst über Mechanismen, die ihre Samen recht lange überleben lassen. "Es gibt weltweit geschätzte 400.000 Arten von Samenpflanzen. 90 Prozent davon produzieren austrocknungstolerante Samen – eine Grundbedingung für ihre Aufbewahrung", erklärt Kranner. Ihr Wassergehalt kann sich auf wenige Prozent reduzieren, der Stoffwechsel wird extrem verlangsamt. "Bei extrem trockenen Bedingungen erreicht das Zellplasma in den Samen einen Zustand, der Fensterglas gleicht", sagt die Pflanzenphysiologin.
"Das Zellplasma wird zu einer zähflüssigen Substanz mit den viskosen Eigenschaften eines Festkörpers." Austrocknungstolerante Samen haben die Fähigkeit, den Glaszustand zu überdauern und zu keimen, wenn Wasser zur Verfügung steht – im Gegensatz etwa zu vielen tropischen Bäumen, die beim Austrocknen sofort ihre Keimfähigkeit verlieren. Von diesen müssten die Embryos aufwendig isoliert und im flüssigen Stickstoff gelagert werden, um sie zu erhalten.
Uralte Samen
In einzelnen Fällen konnten trockenresistente Samen noch nach Jahrhunderten zum Keimen gebracht werden. Zu den wissenschaftlich belegten Rekordhaltern gehören etwa 1000 Jahre alte Lotussamen oder 2000 Jahre alte Samen der Judäischen Dattelpalme.
In Genbanken – Kranner hat auch fast zehn Jahre lang in der britischen Millennium Seed Bank gearbeitet, wo Samen von zehn Prozent der Weltflora lagern – wird dagegen mit technischen Mitteln nachgeholfen. Samen werden dort etwa zwischen minus 20 und minus 196 Grad Celsius in oder über flüssigem Stickstoff aufbewahrt. "Man nimmt an, dass die Samen unter diesen Bedingungen über mehrere Jahrtausende haltbar bleiben", sagt die Pflanzenphysiologin.
Manche der Samen zeigen sich aber auch bei der künstlichen Konservierung verhaltensauffällig. "Papayas lassen sich gut bei plus fünf, minus acht oder minus 80 Grad lagern, nicht aber bei minus 20: Offenbar sorgt die Zusammensetzung der Fettsäuren in den Zellmembranen der Samen dafür, dass sie gerade bei dieser Temperatur nicht überdauern."
Die Ewigkeit dauert auch nur ein Googolplex Jahre

Wenn man nach den langlebigsten von der Wissenschaft erfassbaren Strukturen sucht, steht wohl das Universum selbst ganz oben auf der Liste. Wie lang wird also das All, unsere Raumzeit überhaupt noch bestehen?
Eine Antwort auf diese Frage kann Daniel Grumiller geben, der am Institut für Theoretische Physik der TU Wien über Schwarze Löcher forscht. "Wenn wir unsere besten Theorien sowie den aktuell verstandenen Energieinhalt des Universums zugrunde legen, kommen wir auf einen Wert, der 10 hoch 10 hoch 123 Erdenjahren entspricht."
Diese Dauer kann kaum begreifbar gemacht werden. Die Zahl 10 hoch 100 – eine 1 mit 100 Nullen – wird als Googol bezeichnet, doch hier hat man es mit einem Googolplex, also 10 hoch Googol, zu tun, eine 1 mit 10 hoch 100 Nullen. Die Expansion des Alls ist dann gleich einer Wellenbewegung ausgelaufen. "Der plausibelste Mechanismus ist, dass das instabil gewordene Universum gleichsam in ein anderes ‚tunnelt‘, in dem Urknall und Expansion erneut stattfinden", erklärt Grumiller eine Theorie der Quantenkosmologie.
Universum im Embryonalstadium
Angesichts dieser Zeitskalen ist unser Universum mit einem Alter von etwa 14 Milliarden Jahren noch im Embryonalstadium. Die fünf Milliarden Jahre, die die Erde besteht, sowie die sieben Milliarden, die ihr noch bleiben, bis die Sonne ihre Kernfusion beendet und zum Roten Riesen wird – alles ein Wimpernschlag. Selbst Schwarze Löcher, die mit Abstand langlebigsten Strukturen im Universum, sind dann verschwunden.
Folgt man Einsteins Relativitätstheorie, sind im Zentrum Schwarzer Löcher Singularitäten, bei denen die Krümmung der Raumzeit unendlich wird. Doch in der Wissenschaft geht man davon aus, dass unter diesen Extrembedingungen die Relativitätstheorie nicht mehr gültig ist. Erst mit einer – noch ausständigen – Theorie der Quantengravitation würde man die Gebilde besser verstehen lernen.
Dass die Schwarzen Löcher noch lange vor dem Universum selbst das Zeitliche segnen, folgt aus einem quantenmechanischen Effekt, den der Physiker Stephen Hawking entdeckte. "Aus dem Hawking-Effekt resultiert, dass selbst Schwarze Löcher nicht vollkommen schwarz sind. Sie haben eine Temperaturabstrahlung im Nanokelvinbereich – das restliche Universum ist mit drei Kelvin etwa eine Milliarde Mal ‚heißer‘", sagt Grumiller. "Das vor zwei Jahren erstmals fotografierte Schwarze Loch M87 ist demnach bereits nach 10 hoch 104 Jahren zerstrahlt – also nach zehntausend Googol-Jahren. Auch wenn uns das lang erscheint, im Vergleich zur Lebensdauer des Alls ist das noch immer kurz." (Alois Pumhösel, 23.5.2021)