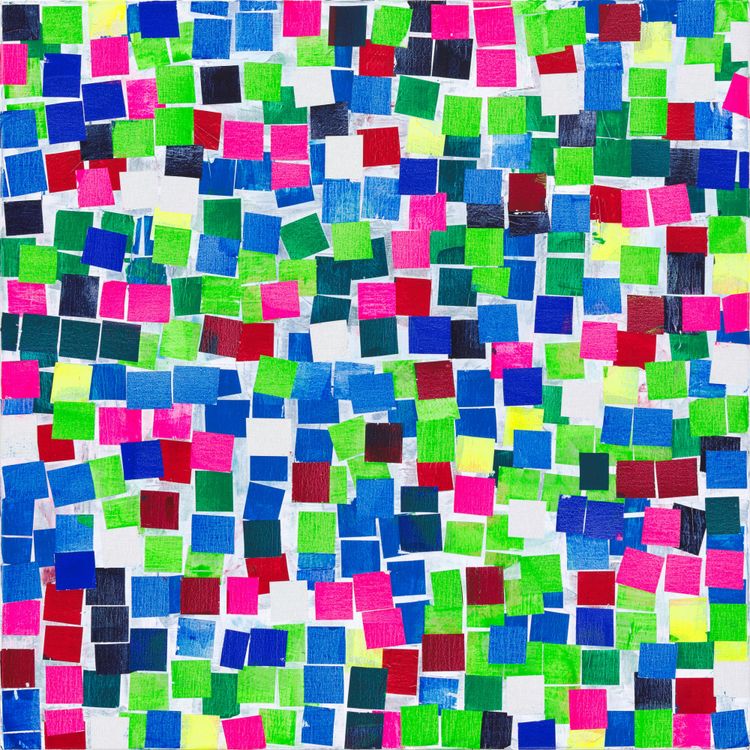
Als unter Dreißigjährige kann man sich gar nicht vorstellen, dass es das Wiener Museumsquartier einmal nicht gab. Einerseits als Jugendtreffpunkt, andererseits als kulturelles Zentrum. Dazugehörig die großen Institutionen, so auch das Museum moderner Kunst (Mumok), das seit 20 Jahren im blockartigen Bauwerk beheimatet ist. Mit einem großen Ausstellungsauftakt werden dieses Jubiläum – und auch zwei weitere – jetzt gefeiert: Vor 40 Jahren wurde die Ludwig-Stiftung gegründet, Karola Kraus zeigte vor zehn Jahren ihre erste Ausstellung als neue Direktorin.
Was seitdem geschah: Als gesetzter Schwerpunkt galt es zum Beispiel, mehr Werke weiblicher, jüngerer sowie außereuropäischer Positionen in die Sammlung aufzunehmen. Dieser Wandel wird in der Überblicksschau Enjoy auf allen Ebenen des Museums gezeigt, wobei jede Etage eine eigene Ausstellung für sich darstellt.
Tête-à-Tête und Kubus
Im Dach beginnt man bei einer Revue der Moderne, trifft im Erdgeschoß Pop-Art sowie Anti-Pop und findet sich, vorbei an Abstraktion und Aktionismus, im Keller bei politischen Themen wieder. Das ist zwar als Gesamtpaket durchaus üppig, wird aber nicht trocken heruntergebetet. Zum Glück. Denn mit der Gegenüberstellung bekannter historischer und jüngerer, zeitgenössischer Positionen gelingt ein neuer Blick auf die Sammlung, die Geschichte und den Status quo: Henri Matisse und Maja Vukoje. Ulrike Müller, Sophie Taeuber-Arp und Virginia Fraser. James Rosenquist und Jakob Lena Knebl. Yto Barrado und Mark Dion. Why not?

Der Skulptur wird als Genre auch ein eigenes Kapitel gewidmet: Roland Goeschl, Fritz Wotruba, Joannis Avramidis. Obwohl man sich hier noch in der Sammlungsschau befindet, geht man bereits ein klandestines Tête-à-Tête mit dem Protagonisten der zweiten neuen Ausstellung ein: Heimo Zobernig. Dass er den Durchgang zu seiner eigenen Schau mit einer Aufstellwand verbarrikadiert hat, hat einen Zobernig’schen Kniff. Schuf er ja selbst auf Einladung des Ex-Mumok-Direktors Edelbert Köb die Architektur für den weißen Kubus, in dem sich die Skulpturen jetzt befinden.
Vom Stiegenhaus aus blickt man auf diese räumliche Erweiterung, die eine Brücke zwischen den beiden Etagenhälften bildet und zwischen den Außenwänden zu klemmen scheint. Auf diesem bereits seit 2002 zum Museum gehörigen weißen Ziegel hat der Künstler nun einen schwarzen Würfel gesetzt. Damals zeigte das Mumok Zobernigs erste große Retrospektive – nun, fast 20 Jahre später, eröffnet seine nächste und knüpft somit direkt daran an.

In der für den 1958 geborenen Künstler typischen minimalistischen Sprache setzt er in den Ausstellungsraum nun eine weitere Architektur hinein. Dabei nimmt er auf den klassisch-modernistischen Sonsbeek-Pavillon Bezug, den Gerrit Rietveld 1955 für eine Skulpturenausstellung im niederländischen Arnheim konzipiert hat. Dabei werden Spanholzplatten zu Trennwänden, Leinwände zu Raumteilern und Regale zu Skulpturen. Die Nähte bleiben sichtbar – Zobernig vertuscht nichts. Wo "painting" draufsteht, ist Painting drin.
Ausgestellt in Zobernigs eigens gestalteten – und von Kraus kuratierten – Schau sind Werke, die in den letzten Jahren entstanden sind, wobei sein erweiterter Malereibegriff zentral ist. Und wenn man so will, liest man auch den Wandel in seinem Werk heraus: Neben der fast brutalen Abstraktion (mit Schriftzeichen) wird Zobernigs Display-Landschaft von Figuren oder zumindest deren Fragmenten besucht. Ganz offensichtlich sind sie als ganze Körper nicht, man muss sie schon suchen.

Ohne Titel heißt ohne Titel
Davor trifft man noch auf Bekanntes: die weißen Sitzbänke, die er 2015 in den österreichischen Pavillon auf der Biennale in Venedig stellte – und dort als Kunstwerk alleine ließ. Wie freche Zitate auf Horizontalen in der Gesamtkonstruktion schieben sie sich zugleich als Möbel und Skulptur vor Wände oder sogar zwischen die Stellwände.
Trifft man dann auf die Figurengruppe in der hintersten Nische, ist man mit Schaufensterpuppen konfrontiert. Nackt, tropfend vor Farbe stehen sie in ungesunden Positionen da. Bei näherer Betrachtung blicken einem zwei Gesichter des Künstlers entgegen. Er selbst wollte die Pose einnehmen. Hui!

Erklärungen sind bei Zobernig oft kryptisch, aber eigentlich bedarf es ihrer gar nicht. Nicht ohne Grund trägt keine seiner Arbeiten einen Titel. Szenen wie ein Gips-Guy mit großem Phallus, der sich an einem der Regale vergeht, sind verstörend-witzig und durchbrechen den sonst vielleicht braven Parcours. Die Aneinanderreihung und Zusammenstellen des Immergleichen wird stellenweise unerwartet fad. Wo bleibt das geordnete Chaos?
Aber vielleicht verbietet das auch die Architektur des schlichten Vorbilds. Eine schwarz-weiß karierte Schachinstallation mit Wuscheldecke lädt dann zur Interaktion mit der Raumarchitektur – längst ist man Teil dieser riesigen Skulptur. Und erinnert sich: schwarzer Würfel, weißer Kubus. Ob sich auch Zobernigs nächste Retrospektive damit befassen wird, bleibt abzuwarten. Wir sprechen in 20 Jahren noch einmal darüber. (Katharina Rustler, 19.6.2021)