Bild nicht mehr verfügbar.
Es war ein Foto aus dem Wiener Prater, das 1997 den Ausschlag zu Andrea Petős Forschung gab. Als Teil einer Ausstellung über Wien 1945 zeigte die Aufnahme den Leichnam einer vergewaltigten, ermordeten Frau. Pető beschloss, das Thema Kriegsvergewaltigungen und soldatische sexuelle Gewalt im Zweiten Weltkrieg in ihrem Heimatland Ungarn wissenschaftlich aufzuarbeiten. Die heutige Professorin der Central European University (CEU) fuhr nach Budapest und erkundigte sich im Freundeskreis, ob jemand von ähnlichen Kriegsverbrechen gehört habe.
Das Echo war überwältigend. "Viele der damals lebenden Großmütter waren Zeuginnen von Vergewaltigungen durch Militärs, und sie waren bereit, davon zu erzählen", erinnert sich die Geschichtswissenschafterin. Zahlreiche Frauen sprachen zum ersten Mal über ihre Erlebnisse. "Es war eine paradoxe Situation, in der jeder von den Vergehen wusste oder, je nach politischem Lager, derartige Fälle vehement leugnete", beschreibt Pető die Ausgangslage.
Sporadische Dokumentation
Neben diesem Widerspruch stieß sie bald auf methodische Grenzen der historischen Aufarbeitung. Viele gerichtliche und militärische Dokumente lagern nach wie vor in verschlossenen Militärarchiven; selbst verfügbare Aufzeichnungen waren und sind mit Vorsicht zu genießen. Denn je nach politischem und nationalem Standpunkt variiert die Interpretation der Delikte. Auch wurden Aufzeichnungen wegen damaliger Interessenlagen vielfach gefälscht oder weisen große Lücken auf.
Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und danach war es wenig ratsam, im Militär Fälle sexueller Gewalt zu dokumentieren oder anzuprangern. Die von August 1944 bis Juni 1991 in Ungarn stationierten sowjetischen Truppen standen außerhalb der ungarischen Gerichtsbarkeit, Kläger wurden teilweise gar verhaftet und in sibirische Arbeitslager deportiert.
Pető durchkämmte diverse Archive nach administrativen, militärischen, medizinischen, politischen, kirchlichen und juristischen Unterlagen. Zu den verfügbaren Quellen zählten häufig Aufzeichnungen aus Pfarren, die schutzsuchende Frauen aufnahmen.
Vielschichtiges Schweigen
Anhaltspunkte für das Ausmaß sexueller Gewalt geben neben Geburtenstatistiken auch Dokumente aus Gesundheitseinrichtungen. Aus Berichten des Budapester Gesundheitsamts geht etwa hervor, dass sich die Zahl der Geschlechtskrankheiten um 1945 verdreifachte.
Die Erkenntnisse ihrer jahrelangen Forschung hat die Wissenschafterin in dem Buch "Das Unsagbare erzählen. Sexuelle Gewalt im Ungarn des Zweiten Weltkriegs" zusammengefasst. Pető arbeitet darin die Faktoren auf, die das lange Schweigen um das stark tabuisierte Thema bedingten und begünstigten. Gerade auf institutioneller Ebene fehlte der Raum, um über die Vergewaltigungen zu sprechen, da ungarische Gerichte sowjetische Soldaten nicht belangen konnten.
Für betroffene Frauen selbst war das Schweigen häufig die Bedingung zum Überleben und für die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft. Davon abgesehen, fehlte den Opfern auch das nötige Vokabular, um das Erlebte überhaupt in Worte fassen zu können. "Wenn sie erzählten, beschrieben sie die erlittenen Vergewaltigungen mit Bildern aus Romanen wie 'Vom Winde verweht' und aus einer Distanz, als wären sie einer anderen Frau geschehen", berichtet Pető von den Interviews. "In der Regel waren die Frauen der Ansicht, dass ihnen nichts Ungewöhnliches widerfahren war."
Schuld bei Frauen gesucht
Sexuelle Freiheit und damit verbundene Rechte hätten sich erst mit der 1968er-Bewegung ergeben. Die Schuld an der Vergewaltigung wurde oft auch bei den Frauen gesucht, die sich eben "nicht gut genug" vor den Soldaten versteckt hätten. Um nicht selbst verantwortlich gemacht zu werden, behielten viele Frauen ihre Erlebnisse für sich.
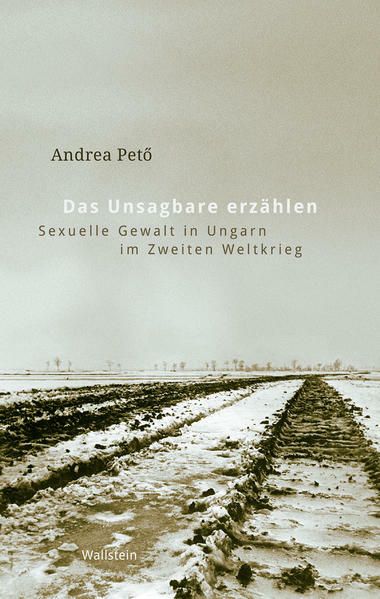
Auf nationaler Ebene wurde Stillschweigen gewahrt, da ein wiederholtes Erzählen der Kriegsvergewaltigungen das kollektive Gefühl von Verlust und Demütigung verstärkt hätte. "Die Frau war in ihrer Funktion als Mutter und Ehefrau verantwortlich für den Wohlstand der Gemeinschaft", sagt die Wissenschafterin. Eine Verletzung der Ehre der Frau zog immer auch den Mann und die gesamte Gesellschaft in Mitleidenschaft. Frauen werden deshalb in bewaffneten Konflikten nach wie vor zur militärischen Zielscheibe.
Bei der Auswertung und Interpretation der Dokumente und Erzählungen sei jedoch äußerste Vorsicht geboten, mahnt Pető. Spezifische Schlüsse ließen sich angesichts der vielen Einschränkungen kaum ziehen, insbesondere deshalb, weil Narrative der Erinnerungspolitik Kriegsvergewaltigungen häufig instrumentalisieren.
Missbrauch als Propaganda
Auch in aktuellen bewaffneten Konflikten werden die Geschichten der Opfer oft für propagandistische Zwecke missbraucht. Meist geht es darum, eine bestimmte ethnische Gruppe als alleinige Täter darzustellen oder Verbrechen einer einzigen Nation zuzuschreiben. Derartige Deutungen verhindern jedoch, die strukturellen Allgemeinheiten, Motivationen und Funktionen militärischer Vergewaltigungen aufzuzeigen. Die Forscherin analysierte das Thema deshalb aus vergleichender Perspektive und zog auch Österreich als Beispiel heran.
Dieser große Rahmen und die Gegenüberstellung mit anderen Kriegsschauplätzen aus Vergangenheit und Gegenwart ermöglichen Schlüsse auf grundlegende Muster sexueller soldatischer Gewalt. "Wir wissen etwa, dass es eine Kontinuität der Gewalt gibt und sexuelle Gewalt zunimmt, wenn Soldaten von der Front heimkehren", sagt Pető.
Um noch immer existente Tabus zu brechen und einen neuen Raum des Diskurses zu schaffen, ist ein Mahnmalprojekt in Budapest entstanden, an dessen Vorbereitung auch Pető mitwirkte. Die Enthüllung des Mahnmals ist für 2023 geplant. Es wird europaweit das erste Projekt seiner Art sein, das als dauerhafte Installation an alle Frauen erinnern soll, die Opfer militärischer Vergewaltigungen wurden. (Marlene Erhart, 12.9.2021)