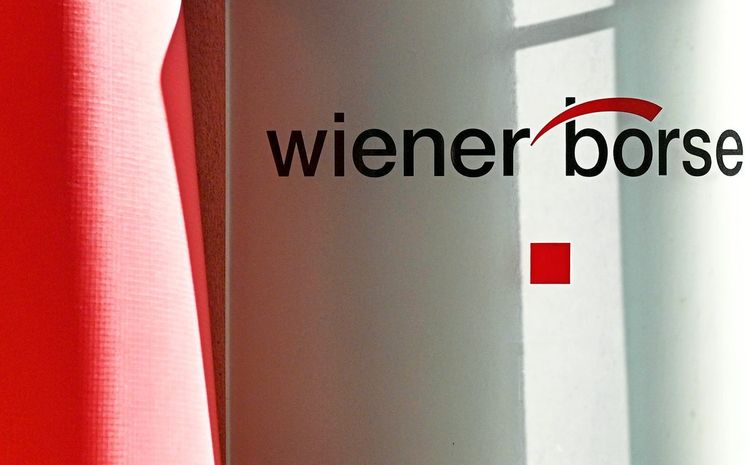
Die Übernahmekommission prüft als unabhängige Behörde Übernahmen an der Wiener Börse.
Ermittler, Ankläger, Richter – und das alles in Personalunion: Die aktuelle Organisation der österreichischen Übernahmekommission ist laut dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) nicht mit EU-Recht vereinbar. Die Behörde, die Übernahmen an der Wiener Börse überprüft, bietet aus Sicht des Höchstgerichts keinen ausreichenden Rechtsschutz.
Österreich ist nun gefordert, das Übernahmegesetz zu überarbeiten und wirksame Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen der Kommission einzurichten. Anlassfall der aktuellen Entscheidung war die geplante Übernahme des Immobilienkonzerns Conwert durch die Adler Real Estate vor sechs Jahren (EuGH 9.9.2021, C-546/18 – Adler Real Estate AG).
Umstrittene Übernahme
Große Conwert-Aktionäre rund um Adler Real Estate hatten laut Übernahmekommission im Herbst 2015 eine kontrollierende Beteiligung an Conwert erlangt, weil sie einheitlich agierten und damit ein sogenanntes "acting in concert" betrieben. Sie überschritten aus Sicht der Übernahmekommission daher gemeinsam den im Übernahmegesetz vorgesehen Schwellenwert von 30 Prozent und hätten allen anderen Conwert-Anteilshabern ein Pflichtangebot unterbreiten müssen. Die Bestimmung soll kleineren Aktionären die Möglichkeit geben, ihre Anteile ebenfalls an die kontrollierenden Anteilshaber zu verkaufen.
Der Strafbescheid, den die Übernahmekommission daraufhin gegen die Adler Real Estate und weitere Großaktionäre ausstellte, wurde von den Beteiligten beim Bundesverwaltungsgericht bekämpft. Im weiteren Verfahren legte das Gericht dem Europäischen Gerichtshof die Frage vor, ob der Rechtsschutz gegen Entscheidungen der Übernahmekommission den europarechtlichen Vorgaben gerecht werde.
Defizite beim Rechtsschutz
Im Falle eines Verstoßes gegen das Übernahmegesetz erlässt zunächst die Übernahmekommission einen Feststellungsbescheid. Diese Entscheidung ist dann für das nachfolgende Verwaltungsstrafverfahren bindend – unter Umständen auch für Personen, die zuvor im Verfahren der Übernahmekommission keine Parteienrechte wahrnehmen konnten. Der Feststellungsbescheid kann zwar beim Obersten Gerichtshof bekämpft werden, das Höchstgericht überprüft allerdings nur reine Rechtsfragen und nicht die Feststellungen der Behörden.
Im Ergebnis führt das dazu, dass sich Betroffene im Verwaltungsstrafverfahren nur eingeschränkt gegen die erhobenen Vorwürfe wehren können. Das aktuelle EuGH-Urteil bestätigt nun, dass diese Vorgangsweise nicht im Einklang mit den europäischen Anforderungen an einen "wirksamen Rechtsbehelf" steht. Marktteilnehmer müssen laut dem Höchstgericht die Möglichkeit haben, Entscheidungen der Behörde von einem unabhängigen Gericht vollumfänglich überprüfen zu lassen.
Das sei in Österreich nach aktueller Rechtslage aber nicht gegeben: Die Übernahmekommission ist laut EuGH sowohl für die Ermittlungen als auch die Verfahrenseinleitung und die Verhängung von Sanktionen zuständig. Deshalb erfülle die Kommission nicht die Anforderungen der EU-Grundrechtecharta an ein "unabhängiges und unparteiisches Gericht". Dass verwaltungsbehördliche Entscheidungen für Folgeverfahren bindend sind, sei grundsätzlich kein Problem. Allerdings müsse dann zumindest eine wirksame Beschwerdemöglichkeit gegeben sein.
Mehrere Verfahren
"Die Entscheidung bietet die Chance für die Republik Österreich, durch eine Novellierung des Übernahmegesetzes europarechtskonforme faire und rechtlich verlässliche Rahmenbedingungen zur Überprüfung von Entscheidungen der Übernahmekommission zu schaffen", sagt Schönherr-Partner Sascha Hödl, der Adler im Verfahren vor dem EuGH vertreten hat. Eine Möglichkeit wäre etwa ein Instanzenzug an einen Übernahmesenat am Oberlandesgericht Wien.
Neben dem aktuellen Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof laufen seit Jahren auch mehrere Zivilprozesse. So hat etwa der Wiener Prozessfinanzierer Advofin im Namen von ehemaligen Conwert-Aktionären eine Schadenersatzklage gegen die Adler Real Estate eingebracht. Der Grund: Adler habe die Conwert-Papiere zu einem Durchschnittspreis von 16,65 Euro je Aktie gekauft und hätte den übrigen Anteilshabern ein ähnliches Angebot machen müssen. Dadurch sei allen Aktionären, die damals ihre Papiere um einen niedrigeren Preis verkauften, ein Schaden entstanden. (Jakob Pflügl, 9.9.2021)