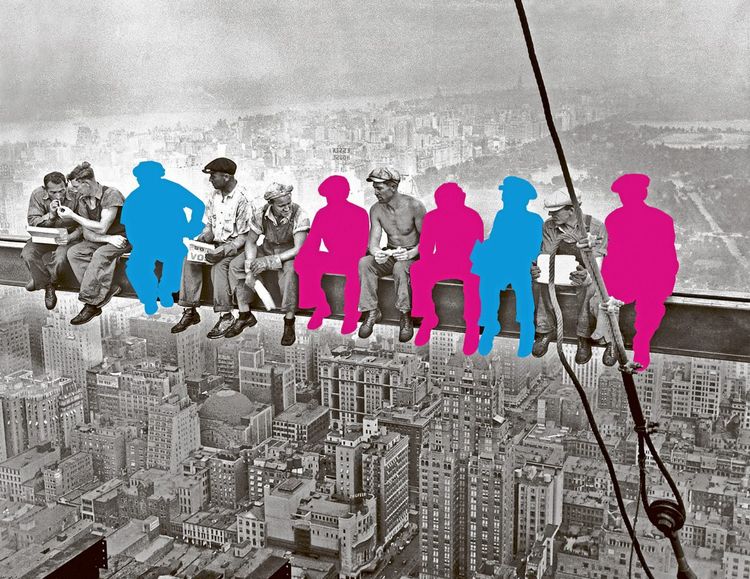
Wieso fehlen so viele Menschen, die in Unternehmen traditionelle Jobs machen wollen? Die "Great Resignation", wie sie der "Atlantic" kürzlich für die USA sichtbar gemacht hat, betrifft fast alle hochentwickelten Länder.
"Nein, danke." An diese Antwort auf ihre Jobangebote müssen sich Arbeitgeber derzeit gewöhnen. Nach 19 Monaten Pandemie grassiert mitten im Wiederaufschwung auf den Jobmärkten von Amerika bis Vietnam ein revolutionäres Virus: Immer mehr Menschen verweigern die ihnen angebotene Arbeit oder schmeißen ihre Jobs gleich hin.
In den USA steigen seit April dieses Jahres monatlich rund vier Millionen Arbeitende einfach aus, Tendenz steigend. Das ist unter der Bezeichnung "Great Resignation" mittlerweile zum Thema Nummer eins für Unternehmen am Arbeitsmarkt geworden. In den Corona-bedingt stockenden globalen Lieferketten geht es damit um Überlebensfragen für viele Firmen in unterschiedlichen Branchen.
Es gibt zu wenige Menschen, die produzieren, Dienstleitungen erbringen, das Geschäft am Laufen halten. Gleichzeitig steigen die Löhne, weil nun unerbittlich mehr gefordert wird. Sogar in den traditionell arbeitgeberfreundlichen USA sind jetzt Gewerkschaften hoch aktiv. Harte Matches zwischen Firmen und den oftmals als "Humanressourcen" bezeichneten Arbeitnehmern sind im Gange.
Mehr Homeoffice
Dazu gesellt sich ein weiterer Trend, der die Sorgenfalten von Unternehmenschefs sich noch ein Stück tiefer eingraben lässt – die von US-Kommentatoren etwas despektierlich als "Pyjama-Revolution" bezeichnete Forderung von Bürobelegschaften nach mehr Homeoffice. Nicht nur ausnahmsweise mal einen Tag als kleine Belohnung, sondern frei gewählt und fortlaufend, selbstverständlich. Was ist plötzlich passiert? Was steckt hinter diesen globalen Trends? Und ist Österreichs Arbeitnehmerschaft auch schon infiziert?
Begonnen hat alles vor gut einer Dekade, als die Wissens- und Kreativarbeiterschaft ein bis dahin noch unbekanntes Statussymbol gefunden hatte: weniger Arbeit. "Career downsizing", wie Computerwissenschafter Cal Newport das nennt, wurde zum Trend für Leute, die es sich leisten konnten, sich gegen die herrschende Pflicht zur Dauerarbeit zu positionieren.
Jahre vor der Corona-Pandemie, häuften sich Umfragen und Studien, wonach die jungen Generationen verweigern, in die Fußstapfen ihrer Eltern und Großeltern zu treten, deren Leben zuallererst von Arbeit dominiert ist. Auf dem Buchmarkt tauchten immer mehr Exegesen dazu auf, Bestseller wie etwa Unfuck Yourself oder Liebe dein Leben, nicht deinen Job. Sich abrackern wie die Alten war nicht mehr angesagt.
Die Lebensperspektive von der einen richtigen Ausbildung, dem einen sicheren und guten Job bis in die wohlverdiente Pension inklusive eines ordentlich Ersparten auf der Bank für ein gutes Auskommen gehörte dabei schon der Vorvergangenheit an.
Globalisierung, Digitalisierung, Plattformökonomien oder das Erleben seriell prekärer Beschäftigung trotz akademischer Ausbildung hatten den guten Glauben an lange bestehende soziale Kontrakte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern längst zerrüttet. Abstiegsängste und Furcht vor den Folgen der Wirtschaftsordnung für das Klima und den Planeten sind parallel gestiegen.
Gebrochene Versprechen
Dass sich Unternehmen offenbar immer tiefer in eine Vertrauenskrise manövriert haben, zeigt ein durch das Beraterhaus Deloitte in 26 Ländern erhobenes Stimmungsbild unter 18- bis 38-Jährigen (Generation Z und Millennials) aus dem Jahr 2018: Demnach vermisst die Hälfte der Befragten eine soziale Verantwortung von Unternehmen. Nur 28 Prozent können sich laut dieser Erhebung überhaupt vorstellen, länger als fünf Jahre bei ihrem Arbeitgeber zu bleiben.
Die gleiche international angelegte Umfrage aus dem laufenden Jahr ergibt: 40 Prozent dieser Generationen glauben, dass in Klimafragen bereits ein Point of no Return erreicht ist. Nur ein Drittel sieht einen "positiven Einfluss" der Wirtschaft auf die Gesellschaft. Fast 40 Prozent fühlen sich von ihren Arbeitgebern nicht oder nicht ausreichend unterstützt für ihr psychisches Wohlergehen, fast die Hälfte ist dauergestresst, und ganze 35 Prozent hatten bereits in den vergangenen Monaten Auszeiten genommen, weil sie Angst und Stress im Job nicht mehr ertragen konnten.
Zufrieden und sinnerfüllt arbeiten
Wie viele Menschen bereits ein "Nein, danke" zu ihrem Job innerlich mit sich tragen, erhellt eine andere, ebenfalls in Industrieländern international durchgeführte Befragung von Microsoft: Über 40 Prozent denken demnach ernsthaft darüber nach, in den kommenden Monaten ihre Arbeit hinzuschmeißen.
Mindestens die Hälfte der Angehörigen der jungen Generationen gibt aktuell bei der Jobplattform karriere.at zu Protokoll, dass sie nicht in ihrer Firma bleiben werden, wenn "örtlich flexibles Arbeiten nicht gewährt wird" – also Homeoffice keine Option ist.
Ein großer Umbruch, beschleunigt durch die Pandemiemonate, ist also auch in Österreich vielfach in Gang gekommen. Drei Fragen, berichten Personalberater, stehen jetzt im Zentrum: Bin ich zufrieden und kann ich sinnerfüllt arbeiten? Kann ich dort arbeiten, wo ich lebe? Ist meine Arbeitszeit so gestaltet, dass sie in mein Leben passt?
Viele haben diese Fragen für sich schon beantwortet, ist aus mehreren Unternehmen zu erfahren. Markus Tomaschitz, Personalchef des Automobilzulieferers AVL List in Graz, berichtet, dass aktuell "sehr viele unserer Leistungsträger" ihre Arbeitszeit auf 30, manchmal sogar auf 20 Stunden reduzieren wollen. Dazu heißt es in fast allen Branchen: Mangel!
Warum wollen sie nicht?
Der Ruf nach Personal wird immer lauter: Im Pflegebereich etwa fehlen rund 70.000 Fachkräfte; der Tourismus spricht von 20.000 fehlenden Mitarbeitern für die anstehende Wintersaison; bis hin zu Gewerbe und Handwerk, wo von über 30.000 fehlenden Mitarbeitern die Rede ist.
Arbeitnehmer verlangen rundum immer mehr: mehr Privatleben, weniger Arbeit, andere Arbeit. Nachdem Berater und IT-Dienstleister vor einigen Jahren hierzulande bereits mit der Vier-Tage-Woche experimentierten, probieren jetzt auch Betriebe wie Maschinenbau Koller bei Aflenz, mittels Vier-Tage-Woche mehr Freizeit anzubieten – teils durch Verdichtung der Arbeit, teils durch Reduktion bei gleichzeitig voller Bezahlung einer 40-Stunden-Woche.
Internationale Versuche, etwa das große isländische Experiment mit einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, haben nahezu euphorische Ergebnisse gebracht: Arbeitnehmer sind weniger oft krank, zufriedener und produktiver, wenn die Arbeitszeit auf vier Tage reduziert wird. Es scheint, als habe die 40-Stunden-Woche gerade ausgedient. Das neue Normal ist die 30-Stunden-Woche. Zumindest in der Firma.
Weniger Bewerbungen
"Der Einsatz für berufliche Tätigkeiten ist eher verhalten", berichtet Personalberater Martin Mayer (Iventa) aus seiner gegenwärtigen Erfahrung. Kandidatinnen und Kandidaten für Jobs wünschen die 30-Stunden-Woche. Mayer sieht das aber nicht als Trend "hin zu mehr Couch und weniger Leistung".
Sondern: "Menschen wollen vieles machen, nebenbei eine kleine eigene Firma gründen oder andere ihnen wichtige Tätigkeiten ausüben." Überraschend sei allerdings: "Weil die Kinderbetreuung stärker zwischen den Partnern geteilt wird, wollen nun auch Männer weniger Arbeitsstunden in Unternehmen."
"Es zieht sich durch alle Branchen, alle Kunden: weniger Bewerbungen", berichtet Deloitte-Partnerin Anna Nowshad aus ihrer Arbeit mit Unternehmen. Parallel gebe es auch in gewissen Segmenten nach wie vor ein Überangebot an Kandidatinnen und Kandidaten, etwa bei sehr starken Marken oder dort, wo aufgrund niedriger Qualifikation leicht getauscht werden könne.
Der Arbeitsmarkt insgesamt werde aber gerade "ordentlich durchgerüttelt". Ein Ende des traditionellen Jobverständnisses zeichnet sich für Anna Nowshad deutlich ab: "Ein Job für die eine ideale fixe Person, das läuft aus." Und was kommt dann? Nowshad sieht Unternehmen künftig geteilt in eine Kernbelegschaft und rundherum eine große Truppe freier projektbasiert Arbeitender. "Traditionelle Beschäftigungsverhältnisse lösen sich gerade auf." Das habe nicht nur mit Arbeitszeit zu tun, sondern stark auch mit Werten, sagt Nowshad.
Mitten im Wertewandel
"Alles bricht gerade um", formuliert es Gabi Faber-Wiener etwas dramatischer. Die Nachhaltigkeitsexpertin und Hochschullehrerin vom Institut für Responsible Management sagt, es krache im Wertekanon zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern. "Letztlich führt es zur Kündigung, wenn meine persönlichen Werte mit denen des Unternehmens nicht zusammenpassen."
Faber-Wiener sieht einen tiefen "credibility gap" auf Firmenseite, also ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Es werde blumig alles versprochen, von der tollen Arbeitsatmosphäre über die Versicherung, den "Menschen in den Mittelpunkt" zu stellen, bis hin zur sozialen und ökologischen Verantwortung. Gehalten werde sehr oft aber kaum eines dieser Versprechen.
"Ich kenne Unternehmen, wo Mitarbeiter wütend das Plakat mit den Unternehmenswerten von der Wand reißen", erzählt sie. Da stehe etwa "Fairness" als Wert ganz oben. Erlebt werde aber das Gegenteil. Faber-Wiener: "Wir befinden uns in einem Wertewandel, der geht immer mit einem ökonomischen Paradigmenwechsel einher."
Werte aufschreiben und sie den Mitarbeitenden beibringen, so laufe das nicht mehr. Der Prozess sei schleunigst umzudrehen, Firmen müssen sich zuerst die Frage stellen: "Was muss ich tun, damit du mich als fair empfindest?" – und so von innen nach außen arbeiten.
Die Macht verschiebt sich
Reputation und Vertrauen: Darauf hätten Firmen keinen selbstverständlichen Anspruch mehr, das lasse sich weder in Werbebotschaften erzeugen noch herbeikommunizieren. Vertrauen und damit der gute Ruf entstünden durch Handlungen, nicht durch Worte. "Mitarbeiter schauen sehr genau, was das Top-Management sagt und tut. Corona hat mehr verändert, als wir glauben."
"Die Machtverhältnisse verschieben sich gerade massiv", sagt Rudi Bauer von "We are developers", einer Plattform für Softwareentwickler. Menschen "möglichst billig am Markt einkaufen – das lassen sich Arbeitnehmer nicht mehr gefallen".
Er sieht ein großes "Missmatch". Man finde nicht zueinander. Einerseits müssen sich viele Unternehmen verkleinern, Gasträume sperren, Wellnessbereiche schließen. Andererseits würden Tausende gerne arbeiten und werden nicht genommen. Bauer: "Wenn man so umgeht mit Menschen, wie mit Bewerbern oft umgegangen wird, darf man sich nicht wundern." Wer Menschen als Ressource, gar als Rohstoff, möglichst günstig, betrachte, ernte Desinteresse und die Aufkündigung der Loyalität durch die Belegschaft.
Glaubwürdigkeitsproblem
Apropos Glaubwürdigkeitsproblem: Wie unwahr und rein werblich Videos von Unternehmen sind, die sich als attraktive Arbeitgeber in Szene setzen, beschreibt Rudi Bauer so: "Ich habe mir 200 dieser Employer-Branding-Videos angesehen. Sie sind alle gleich. Cappuccino und Rasenteppich im Meetingraum, lauter glückliche Gesichter."
Dass es beim aktuellen Phänomen der "Great Depression" um Werte und um ein neues, starkes Selbstbewusstsein der sogenannten "Workforce" nach Kurzarbeit und anstrengenden Homeoffice-Monaten geht, legt auch eine Umfrage des global tätigen Beraters McKinsey nahe. Die Studie befasst sich mit den vielen Millionen zurückgelegter Jobs in den USA. Interessant daran: Ein paar geldwerte Aktionen von Unternehmen helfen nicht gegen die "Great Resignation". Klar wird, dass es (nur) um höhere Löhne oder Renumerationen offenbar nicht geht. Sukkus der Studie: Die große Verknappung auf dem Arbeitsmarkt werde weiter voranschreiten.
Dass erschöpfte, um Angehörige trauernde und gestresste Menschen einfach nur mehr Freizeit und Erholung (Work-Life-Balance) wollen, sei aber nicht das Motiv, fand McKinsey heraus. Arbeitnehmer gehen, weil sie sich nicht wertgeschätzt und nicht zugehörig im Unternehmen fühlen. Kurz gesagt: Viele Menschen fühlten sich als Ressource, die für den Betrieb verwendet wird, solange sie etwas hergibt – dann wird sie ausgetauscht. Eingefordert wird ein anderes Menschenbild auf der Arbeitgeberseite.
Bedrohliche Demografie
Dazu kommt die demografische Entwicklung in den reichen Ländern. In Österreich etwa gibt es ab 2022 erstmals seit vielen Jahrzehnten weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64. Angesichts dessen werden die Forderungen der Arbeitnehmerschaft wohl Gehör finden müssen. Aussitzen wird keine Lösung sein. Sondern das, was prominente Redner und große Vorstandschefs seit Jahren auf den Bühnen der Digitalisierungsveranstaltungen proklamieren: "Die Renaissance des Menschen im Zeitalter der Automatisierung und der Digitalisierung."
Die letzte Frage geht an Personalchef Tomaschitz bei AVL List in Graz mit 11.000 Mitarbeitern: Wird die Arbeitswelt nun also gezwungenermaßen inklusiver, weniger aussortierend und diskriminierend nach Geschlecht, Alter oder sonstigen vermeintlichen Makeln? Dazu sagt Tomaschitz: "Ich glaube schon, wir müssen uns anstrengen." (Karin Bauer, 6.11.2021)