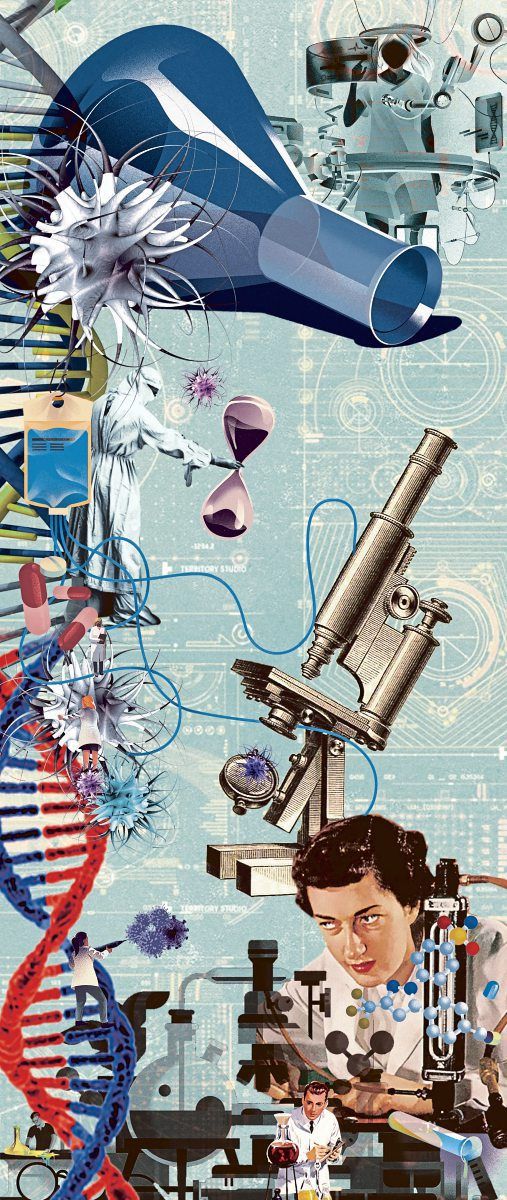
Wenn die Not nur allzu groß ist, lassen sich sowohl gemäßigte Machthaberinnen wie auch egomanische Diktatoren von den kühlen Köpfen der Wissenschaft beraten. Diesen Eindruck konnte man in der ersten Phase der Pandemie gewinnen. Zwei Jahre später ist das Bild wenig überraschend um einiges durchwachsener.
Die Anfangszeit der Corona-Pandemie war eine "Sternstunde für die Wissenschaft", sagt der Soziologe Alexander Bogner vom Institut für Technikfolgenabschätzung der Akademie der Wissenschaften in Wien. Allerorts wurden wissenschaftliche Gremien eingerichtet, und das Ansehen von Wissenschaftern und Wissenschafterinnen in der Öffentlichkeit setzte an zum Höhenflug – selbst in einem Land wie Österreich, das nicht besonders für seine Wissenschaftsbegeisterung bekannt ist.
Die Krise habe vielen Menschen drastisch vor Augen geführt, dass viele Gefährdungen ohne die Wissenschaft weder erkannt noch wirkungsvoll behandelt werden können, sagt Bogner: "Ohne die moderne Wissenschaft wäre das Coronavirus gar kein Virus, sondern ein Schicksal oder Gottes Wille." Im Vorjahr hat Bogner mit "Die Epistemisierung des Politischen: Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet" (Reclam-Verlag) eine Monografie über Wissenschaft und Politik in der Pandemie vorgelegt.
Applaus mit Ablaufdatum
Die relativ uneingeschränkte Begeisterung für Wissenschaft war allerdings nur von kurzer Dauer und ist teilweise sogar ins Gegenteil gekippt, wobei die Schatten dieser Entwicklung bis heute sichtbar sind. "Im Verlauf der Corona-Krise haben sich verschiedene Konflikte entwickelt", sagt Bogner. Dabei ging es etwa um die ökonomischen Folgen der Lockdowns oder um die psychosozialen Belastungen. Abermals ist die Wissenschaft dabei ins Zentrum geraten, als sich "Hass und Wut sichtbar an den öffentlichen Experten festgemacht haben".
Im Oktober des Vorjahrs berichtete das Fachblatt "Nature", wie weitverbreitet Morddrohungen oder Gewaltandrohung gegenüber Forschenden waren, die durch die Pandemie öffentlich exponiert waren. In einer Umfrage unter mehr als 300 Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, die zu Covid medial präsent waren, gaben 15 Prozent an, Morddrohungen erhalten zu haben, über 20 Prozent waren mit Androhungen von physischer oder sexueller Gewalt konfrontiert.
Auch Forschende, die sich in Österreich um die Bekämpfung der Pandemie verdient gemacht haben, sind mit Hass und Häme konfrontiert. So erhält etwa Dorothee von Laer, die das Institut für Virologie der Medizinischen Universität Innsbruck leitet, täglich Hass-E-Mails, gespickt mit Beschimpfungen und sexistischen Untergriffen. In Tirol geht sie nur mit Perücke auf die Straße, um unerkannt zu bleiben. "Das sind Entwicklungen, die befremdlich und völlig neu sind in dieser drastischen Form", sagt Bogner.
Wie Wissenschaft funktioniert
Die Anfeindungen gegenüber Forschenden entzündeten sich mitunter an inadäquaten Vorstellungen davon, was Wissenschaft leisten kann. Um das Vertrauen in die Wissenschaft auch in Krisenzeiten halten zu können, sei es wichtig, dass die Menschen verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, sagt Bogner.
Zentral ist dabei, dass Wissenschaft stets "inkrementelle Fortschritte auf der Basis von Versuch und Irrtum erzielt". Wissenschaft könne daher auch nie mit absoluten Wahrheiten aufwarten. Ihre vorläufigen Wahrheiten sind in aller Regel "gut begründet, empirisch fundiert und logisch konsistent formuliert", sagt Bogner. Dennoch kann man davon ausgehen, dass "diese vorläufigen Wahrheiten immer überholt werden". Das ist jedoch keine Schwäche der Wissenschaft, sondern gerade ihre Stärke. "Wenn ihre Wahrheitsansprüche nicht kritisiert werden würden, dann wäre das Geschäft der Wissenschaft am Ende."
Offener Austausch
Ein weiteres Phänomen im Austausch von Wissenschaft und Öffentlichkeit, das in der Pandemie in Echtzeit beobachtet werden konnte, war ein Paradigmenwechsel in der Praxis des wissenschaftlichen Publizierens. Als Goldstandard gilt das sogenannte Peer-Review-Verfahren, bei dem Arbeiten vor der Publikation anonym von Fachkolleginnen und -kollegen begutachtet werden.
Peer-Review ist zwar eine gute Absicherung für Qualität, doch der Prozess benötigt Zeit. Zeit, die man in einer Pandemie, wenn es gilt, rasch auf neueste Entwicklungen zu reagieren, kaum hat. Aus dieser Not ergab sich durch Covid-19 rasch, dass noch unbegutachtete Preprints zirkuliert sind und diskutiert wurden – eine Praxis, die zuvor in Fächern wie Physik oder Mathematik üblich war, jedoch nicht in der Medizin.
Zuverlässige Preprints
Vielfach wurde Besorgnis geäußert, dass das breite Zirkulieren von Preprints und deren Diskussion auf Plattformen wie Twitter die wissenschaftliche Integrität untergraben könnten. Erst kürzlich zeigte jedoch eine Studie im Fachjournal "PLOS Biology", dass diese Sorge unbegründet ist: Forschende der Queen-Mary-Universität in London analysierten 184 Forschungsartikel, von denen zunächst Preprints in der Anfangsphase der Pandemie zirkulierten und die erst viel später in Fachjournalen publiziert wurden.
Bei 82,8 Prozent der Arbeiten hatten sich keine Veränderungen der Aussagen der Studien durch den Begutachtungsprozess ergeben. Bei den restlichen 17,2 Prozent der Arbeiten gab es zwar Änderungen, diese betrafen aber meist abschwächende oder stärker betonende Formulierungen und änderten nicht die generelle Aussage. Selbst in der frühen Phase der Covid-19-Forschung war die Wissenschaft also bemerkenswert zuverlässig.
Ein wichtiger Grund dafür dürfte in der Kritikfähigkeit liegen, die Wissenschaft innewohnt. Darin sieht Alexander Bogner auch eine ihrer großen Stärken: "Die Überlegenheit der Wissenschaft gegenüber anderen Wissensformen besteht darin, dass sie extrem kritikfähig ist – und bereit zur Selbstkritik." (Tanja Traxler, 23.2.2022)