
Entschiedener Kampf gegen den Totalitarismus: Thomas Mann mit seiner Frau Katia und den Kindern Klaus und Erika. Das Bild entstand wahrscheinlich Anfang der 1930er-Jahre, das genaue Aufnahmedatum ist unbekannt.
Ein Buch wie dieses kommt zur rechten Zeit: Thomas Manns Krieg, verfasst vom amerikanischen Germanisten Tobias Boes, könnte aktueller nicht sein. Mit unerhörter Akribie wird der politische Kampf nachgezeichnet, den der von den Nazis ausgebürgerte Thomas Mann ab 1938 von Amerika aus führte.
Zum einen erinnert es uns daran, was einmal selbstverständliche Aufgabe eines politisch denkenden Künstlers war, zum anderen zeigt die gegenwärtige russische Aggression erschreckende Parallelen zum Agieren Nazideutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg. Auch damals wurde gemahnt, und allzu lange haben die Westmächte auf Appeasement gesetzt – im Nachhinein war klar, was unweigerlich kommen würde.
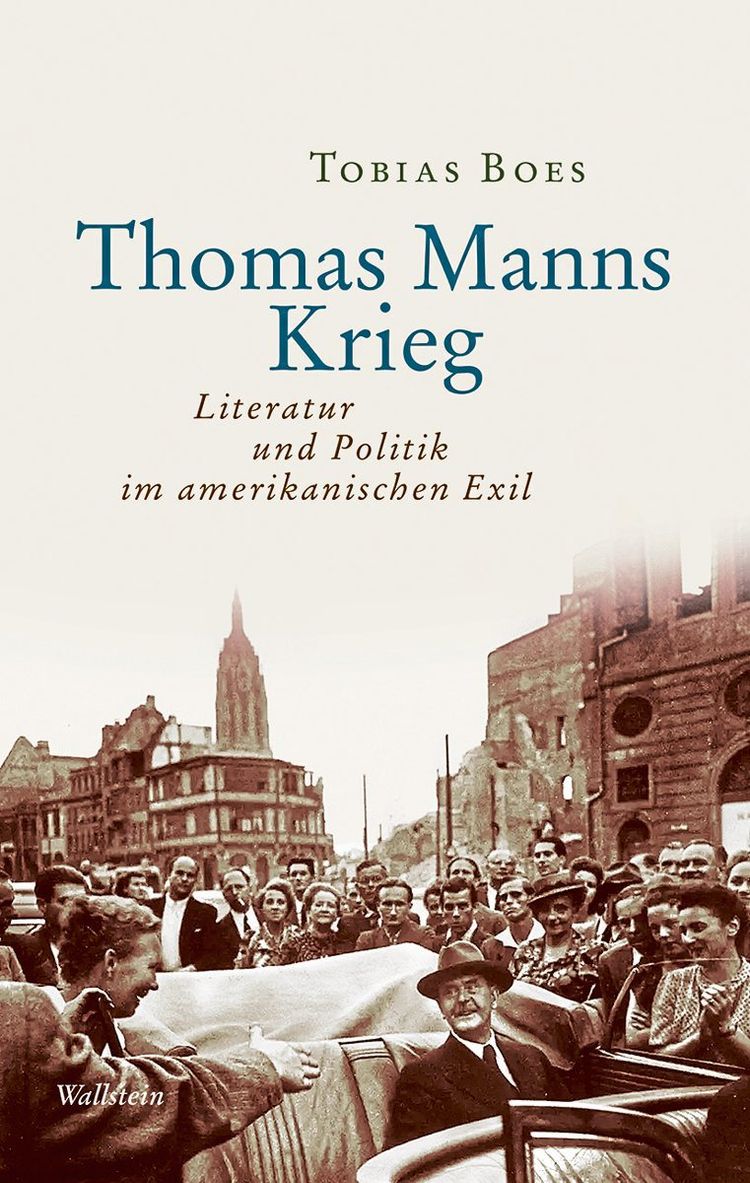
Thomas Mann hatte es vorausgesehen, er hatte schon 1933 Deutschland verlassen, fünf Jahre später fand er sein endgültiges Exil in den USA. Als er am 21. Februar 1938 in New York ankam, wurde er von einer Schar amerikanischer Reporter erwartet. Noch an Bord der Queen Mary gab er eine erste Pressekonferenz, verurteilte die Beschwichtigungspolitik des britischen Premierministers Neville Chamberlain und sagte voraus, woran in Europa noch kaum wer glauben wollte: die Annexion Österreichs.
Realitäten
Zwei Wochen später war es dann Wirklichkeit. Thomas Manns Schwiegermutter Hedwig Pringsheim, damals noch in München, notierte am 12. März in ihr Tagebuch: "Militär (…) in Oesterreich eingerückt!", und einen Tag später: "Es gibt kein Oesterreich mehr." Die Schwiegermutter, nicht minder politisch wach, überaus gebildet und kunstsinnig, hatte von 1885 an ein Journal geführt, das lange im Verborgenen ruhte.
Im vergangenen Herbst erschien der neunte und letzte Band einer umfangreichen, mustergültig besorgten Edition im Wallstein-Verlag, die auf die Familie Mann mehr als nur einen Seitenblick wirft und für die Thomas-Mann-Forschung eine unerlässliche Quelle bedeutet.
Die Pringsheims, Katja Manns Eltern, hatten zu den ersten Adressen im Münchner Kulturleben gezählt, im Nazideutschland war es damit schnell vorbei: Hedwig war ebenso jüdischer Herkunft wie ihr Mann Alfred Pringsheim, vermögender Mathematikprofessor und Kunstmäzen.
1939 gelang die rettende Übersiedlung in die Schweiz, allerdings musste sie mit einer 75-prozentigen Reichsfluchtsteuer bezahlt werden, die wertvolle Kunstsammlung wurde beschlagnahmt. Man erfährt auch von diesem Abschied, knapp und doch eindringlich, wie Hedwig Pringsheim Privates wie Weltpolitisches eben festhielt; gerade der letzte Tagebuch-Band, 1935–1941, umfasst die in beider Hinsicht ereignisreichsten Jahre.
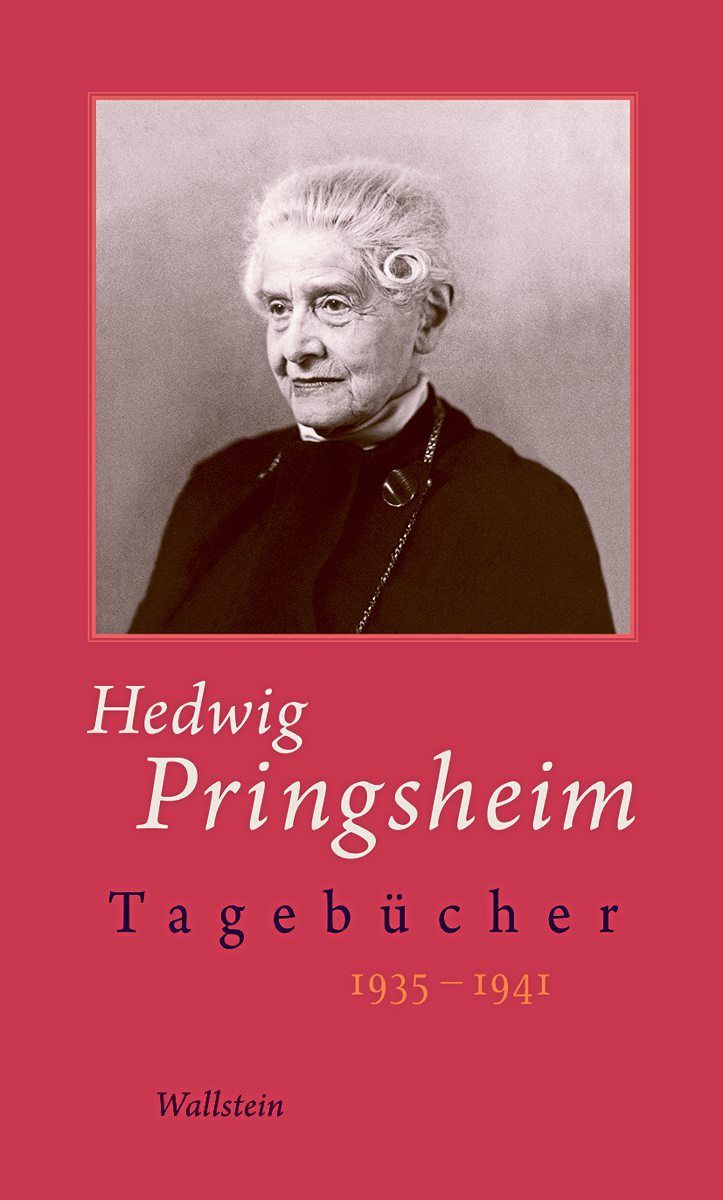
Zurück zu Thomas Mann, der seine Anti-Nazi-Haltung schon lange vor Hitlers Machtergreifung, und bevor seine Bücher in Deutschland verbrannt wurden, kundgetan hatte. 1921 schrieb er von "Hakenkreuz-Unfug", appellierte immer wieder für die Rettung der Demokratie.
Nach 1933 fand sein Engagement schließlich weltweit Beachtung, sein politisches Wort hatte im Ausland bald ebenso Gewicht wie sein literarisches Werk, die amerikanische Presse nannte ihn 1938 den "Greatest Man of Letters". In einem der ersten Briefe in den USA schrieb er am 22. März: "Wie lange wird die Welt diese Pest dulden?" Und in einem Brief ein Jahr später: "Mögen sie in Schande untergehen!"
Anklagen
Die amerikanische Öffentlichkeit wollte von Thomas Mann klare Worte hören, und die bekam sie auch. Er nannte Hitler einen "zehnfach Gescheiterten", einen "abgewiesenen Viertelskünstler", "Träumer fünften Ranges", einen "ganz und gar Schlechtweggekommenen", einen "Dauer-Asylisten", extrem faul und unfähig zu vernünftiger Arbeit, ehrlos, rachsüchtig, duckmäuserisch und zugleich sadistisch.
Im Übrigen wahrte er jedoch die klassische Form und setzte auf die literarische Tradition der Empörung, der Anklage. Einen offenen Brief, abgedruckt in der Zeitschrift Nation, übertitelte er mit "I Accuse the Hitler Regime". Das sollte an Émile Zolas berühmtes Manifest "J’Accuse" anklingen.
In seinen Aufsätzen und Reden betonte Thomas Mann stets, dass er dabei "als die Stimme der deutschen Kultur" sprechen wolle. Das hatte er auch schon bei seiner Ankunft deutlich gemacht: "Where I am, there is Germany", er trage wo immer seine "deutsche Kultur" in sich.
Es war ein zugleich nationaler und kultureller "Abwehrkampf": gegen den Faschismus, gegen Hitler-Deutschland, für die Demokratie, für die USA. Es scheint, als hätte er an einer zweiten Karriere gearbeitet, als wollte er unbedingt die "Anti-NS-Berühmtheit" werden, die man fortan mit seinem Namen verbinden sollte.
Insgesamt 134 Mal trat er als gefragter "Wanderredner der Demokratie" öffentlich gegen Hitler auf. Diese Karriere begann freilich noch in Europa, spätestens mit dem offenen Brief, den er 1936 in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlichte. Von da an veränderte sich Thomas Manns Selbstverständnis als Schriftsteller, bei seiner Ankunft in Amerika bezeichnete er sich als "Hitler’s most intimate enemy".
"Unbeschreiblicher Ekel"
Im März 1939 erschien schließlich sein berühmter Essay Bruder Hitler, zunächst auf Englisch: This Man Is My Brother. Von da an war er der ganz persönliche Antipode Hitlers, dabei suggeriert der merkwürdige Titel geradezu geistige Verwandtschaft. Tatsächlich verband ihn nicht nur "unbeschreiblicher Ekel" mit "dieser Figur", da war auch noch ein kultureller Kontext.
Seine Literatur, so Thomas Mann, würde ebenso wie der Nationalsozialismus im Fin de Siècle wurzeln – für diese kühne These führt er als Beispiel etwa den Tod in Venedig an, und möglicherweise mag man in dieser Erzählung so etwas wie faschistische Morbidität erkennen. Jedenfalls spricht er von "einer neuen Entschlossenheit und Vereinfachung der Seele", ein Phänomen, das er in der Massenbewegung der Nazis wiederfand.
Mit solchen Befunden ging Thomas Mann ein wenig an der Realität vorbei, umso mehr, als er Hitler vorrangig als schlechte Künstlerfigur sah, die nicht rational, sondern in Form "verhunzter" Wagner’scher Spektakel wie auf einer Bühne agiere. Auf die peinliche Ästhetisierung im Faschismus hat freilich schon vorher Walter Benjamin hingewiesen, seine Faschismuskritik aber nicht darauf fixiert.

Bei Thomas Mann mag fragwürdig erscheinen, dass er den Faschismus als kulturelles Problem sah und sich in seinen Einlassungen zum deutschen Prediger stilisierte, zum einzig wahren, wie Boes schreibt. Nicht selten bediente er sich dabei auch einer biblischen Sprache, was ihn, verglichen etwa mit Benjamin oder Brecht, zum konservativen Antifaschisten machte.
Deutschtum
Nicht zuletzt war auch seine Faschismuskritik ein genau kalkulierter Propagandakrieg, bis hin zum Erhalt der US-Staatsbürgerschaft im Jahr 1944. Aber gerade weil er an Propagandasendungen amerikanischer und britischer Rundfunkstationen mitwirkte, in denen er sich explizit an die "deutschen Zuhörer" wandte, sah er sich erst recht als "Repräsentant alles Deutschen", dessen Werke "vom Deutschesten handeln", wie er betonte.
Je mehr er sich an Hitler rieb, umso stärker pochte er auf sein "Deutschtum". Vielleicht bedurfte sein Krieg auch dieser Wechselwirkung. Den Zorn der Nazis zog er noch auf sich, als es längst egal war. Über eine Rundfunkrede Manns im August 1941 erboste sich Goebbels so sehr, dass er sie in seinem Tagebuch als "so blöde" festhielt, dass er sie gar nicht kommentieren wollte, ohnehin sei ihr Verfasser ein "verkommener und wurmstichiger Literat".
Der Sicherheitsdienst der SS protokollierte jedes Statement, während Hitler die "üble Hetze" wenig zu kümmern schien. Als Mann im September 1938 vor 20.000 Zuhörern im Madison Square Garden zu dessen Sturz aufrief ("Hitler muss fallen"), mag das auf den Angesprochenen nicht anders gewirkt haben als Joe Bidens Ansage, Putin könne nicht an der Macht bleiben.
Belletristisch verpackt
Genug der Realität. Mittlerweile gibt es Thomas Mann auch als Romanfigur. Der irische Erfolgsautor Colm Tóibín ist zwar nicht der Erste, aber er hat gleich das ganze Mann’sche Leben belletristisch verpackt: Der Zauberer. Das Ergebnis ist nur leider enttäuschend. Zum einen erfährt man nichts, was man nicht ohnehin schon weiß, und das obendrein meist berichtartig; zum anderen wird etwa Manns Homosexualität so viel Aufmerksamkeit geschenkt, dass es nicht nur indiskret, sondern spekulativ und plakativ wirkt.

Und auch sprachlich ist der etwas bieder geratene Text nicht von übermäßiger Qualität, dafür voller fragwürdiger Deutungsmuster und Ausflüge ins Anekdotenhafte. Viel Psychologie, viel Illusion. Breiten Raum nimmt auch die Auseinandersetzung mit den Nazis ein, sodass man den Künstlerroman immerhin als Ergänzung zu obigem Buch lesen mag.
Etwas völlig anderes, freilich mehr für Spezialisten, ist Manuel Bamerts literaturwissenschaftliche Untersuchung Stifte am Werk, in dem es um "Lesespuren" in Thomas Manns privaten Büchern und damit verbundene textuelle Phänomene geht.
Bamert hat dazu zehntausende Fundstellen in der Nachlassbibliothek ausgewertet. Mit Vorliebe hat Thomas Mann mit Blei- oder Farbstift annotiert: unterstrichen, angestrichen, Ausrufe- und Fragezeichen an den Rand gesetzt, kleine Vermerke angebracht. Einmal steht am Seitenrand bloß "Oha!", was auch etwas sagt. Das Staunen gehört zum Lesen.
In einer Miniatur 1923 schrieb Thomas Mann: "Ich bin kein Bücherwurm, aber der Anblick einer Bibliothek kann mich zuweilen erschüttern." Seine Privatbibliothek war übrigens nicht groß, er selbst schreibt an anderer Stelle von der "kleinen Büchersammlung", die ihm "mit den Jahren zugewachsen" ist. Er hat sie, soweit möglich, später ins Exil mitübersiedelt, wo sie weiter Wissens- und Rezeptionsarchiv war, sein "Stift" markierte darin alles "Sittliche", das ihm relevant schien.
Raubgut
Durch die Exilsituation ging aber vieles verloren, wurde Raubgut; heute zählt man an der ETH Zürich, die den Nachlass verwahrt, ungefähr 4300 Bände. Wie sehr die "Stiftlektüren" Rückschlüsse auf Thomas Manns Werk erschließen, ist ein weites, noch gar nicht beackertes Feld – hier werden künftige Generationen von Germanisten noch reichlich Betätigung finden. (Gerhard Zeillinger, ALBUM, 18.4.2022)