Ob der Aktivismus von queeren Menschen, Feministinnen oder Menschen mit Migrationsgeschichte, derzeit erwecken viele polarisierte Debatten den Eindruck, als ob diskriminierte Gruppen sich eher voneinander abgrenzten, als untereinander solidarisch zu sein. Geschlechteridentität oder spezifische Diskriminierungserfahrungen scheinen als Eintrittskarte für, aber auch als Ausladung aus bestimmten Debatten zu dienen. Nach ihrem Buch über Identitätspolitik haben die Autor:innen Lea Susemichel und Jens Kastner das Buch "Unbedingte Solidarität" herausgegeben, um Auswege aus den oft wenig konstruktiven Debatten um Identitätspolitik aufzuzeigen.
STANDARD: Ihr habt den aktuellen Sammelband nach eurem Buch über aktuelle identitätspolitische Debatten veröffentlicht. Haben wir Solidarität als politische Kategorie während der identitätspolitischen Kämpfe der letzten Jahre aus den Augen verloren?
Susemichel: Ja, das war tatsächlich eine wichtige Bilanz unseres Buches über Identitätspolitik: dass es zentral immer um die Frage gehen sollte, wie Solidarität zwischen unterschiedlichen Menschen möglich wird. Bei der Kritik an Identitätspolitik lautet ein zentraler Vorwurf, dass sie breite Solidarisierungen verhindern würde. Das stimmt pauschal definitiv nicht. Denn emanzipatorische Identitätspolitik war zunächst einfach eine Notwehrreaktion auf erlebte Diskriminierung, mit ihr wurde Solidarität gerade eingefordert. Menschen, die aufgrund der ihnen zugeschriebenen Identität – also zum Beispiel als Homosexuelle, Frauen, Schwarze, aber auch als Angehörige der Arbeiterklasse – ähnliche Lebens- und Leidenserfahrungen machen müssen, schlossen sich zusammen, um Gerechtigkeit und Gleichberechtigung zu fordern. Diese Form von "Identitätspolitik" war der Motor des emanzipatorischen Fortschritts und der Kitt der großen sozialen Bewegungen des 20. Jahrhunderts wie des Feminismus oder der US-Bürgerrechtsbewegung. Uns war es wichtig, auf dieses große Verdienst hinzuweisen, weil in den aufgeregten Feuilletondebatten ja häufig so getan wird, als hätten uns linke Identitätspolitiken nichts als überkandidelte Debatten um Triggerwarnungen und Cultural Appropriation gebracht – wobei es das natürlich auch gibt.
STANDARD: Ihr aktuelles Buch heißt "Unbedingte Solidarität". Was bedeutet das?
Kastner: Es geht um ein Verständnis von Solidarität, das nicht Gleichheit zur Bedingung hat. Solidarität wird häufig auf den Appell gegründet, die Gleichheit und Verbundenheit mit jenen zu erkennen, mit denen wir solidarisch sein sollen. Doch Gleichheit sollte das Ziel von Solidarität sein, nicht aber ihr Ausgangspunkt. Darüber hinaus sollte Solidarität auch in einem weiteren Sinne bedingungslos sein, dass sie nämlich ohne unmittelbare Gegenleistung erfolgt, also kein Tauschgeschäft von Kosten und Nutzen oder Rechten und Pflichten ist. Das bedeutet aber nicht, dass sich Solidarität nur in eine Richtung vollzieht, im Gegenteil: Unseres Erachtens kann eine wirklich wechselseitige, solidarische Beziehung nur entstehen, wenn es dabei nicht um die Frage "Was habe ich davon?" geht. Solidarität ist außerdem noch in einem dritten Sinne "unbedingt", nämlich insofern, als dass sie angesichts der gegenwärtigen globalen Krisen unbedingt nötig ist.
Susemichel: Allerdings scheint die Forderung nach unbedingter Solidarität vielen Menschen illusorisch, weil die Krisen immer zahlreicher werden und in immer kürzeren Abständen über uns hereinbrechen. Ein Totschlagargument in der Debatte um Solidarität lautet dann: Wir müssen "realistisch" bleiben, wir können nicht bedingungslos allen helfen, nicht alle aufnehmen usw. Doch diese multiplen Krisen hängen zusammen. Die Klimakatastrophe macht Pandemien wahrscheinlicher, der Krieg in der Ukraine führt zu Hungerkrisen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verstärkt soziale Ungleichheit weltweit. Und wegen dieser Zusammenhänge braucht es eine tatsächlich tiefgreifende "unbedingte" Solidarität, die nicht weniger als ein gutes Leben für alle überall auf der Welt zum Ziel hat. Diese Solidarität muss darauf abzielen, globale Ungleichheit zu beseitigen, und unbedingt auch eine Klimasolidarität umfassen, die auch mit künftigen Generationen solidarisch ist. Und diese globale Perspektive unterscheidet unbedingte Solidarität auch von paternalistischen Hilfsmaßnahmen oder religiös motivierter Barmherzigkeit.
STANDARD: Sind Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe und persönliche Betroffenheit in politischen Debatten der letzten Jahre immer wichtiger geworden? Macht erst das die Solidarität glaubwürdig?
Susemichel: Nein, ganz im Gegenteil. Zugehörigkeit und geteilte Erfahrung dürfen eben auf keinen Fall die Voraussetzung für solidarisches Handeln sein. Wie bereits gesagt, ist Solidarität zwar immer auch die Basis identitätspolitischer Allianzen und in dieser Form natürlich absolut legitim und wichtig. Aber sie darf dabei nicht stehenbleiben. Was wir unbedingte Solidarität nennen, zeichnet sich im Gegenteil gerade dadurch aus, dass man auch mit Menschen solidarisch ist, mit denen man gerade nicht das Geschlecht, das Milieu, die ethnische Herkunft oder den Aufenthaltsstatus teilt. Sie beruht also im Kern auf Differenz und gerade nicht auf Gleichheit.
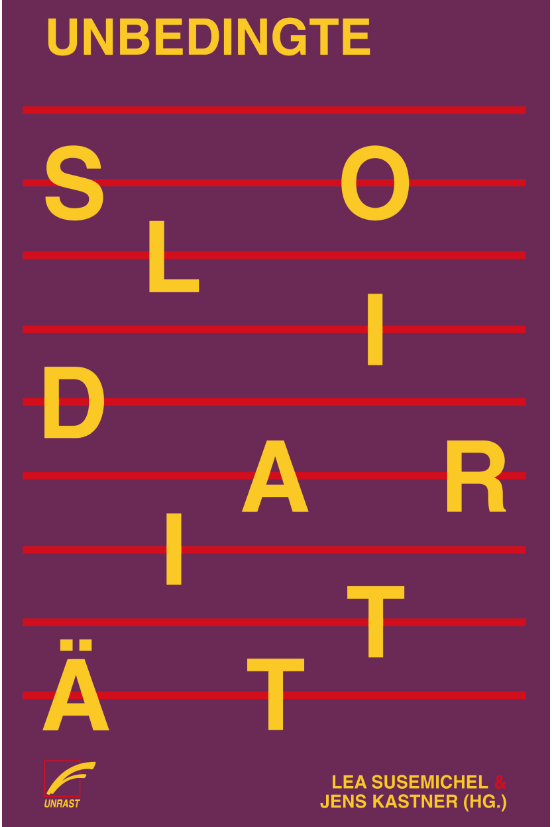
Es ist natürlich völlig okay, sich in einer Gewerkschaft zu engagieren, aber wenn sich die Solidarität dabei nur auf die eigene Berufsgruppe beschränkt und sich den anderen verweigert wird, ist es mit ihr nicht allzu weit her. Etwa wenn Gewerkschaften oder auch linke Politik nur für die "inländischen" Lohnabhängigen eintreten, die vor der durch Migrant:innen ausgelösten Lohndrückerei geschützt werden müssten. Das ist eine Form von exklusiver Solidarität, die diesen Namen eigentlich nicht verdient. Eine andere Form von exklusiver Solidarität gibt es aber auch als Folge falsch verstandener Identitätspolitik, bei der alle Solidaritätsbekundungen, die nicht aus persönlicher Betroffenheit erfolgen, sofort als privilegierter Paternalismus abgetan werden. Aber wo führt das hin, wenn jede:r nur noch für sich selbst sprechen und kämpfen darf und Allys immer unter dem Generalverdacht stehen, sich nur moralisch profilieren zu wollen? Das wäre das Ende von Solidarität.
Kastner: Solidarität sollte unseres Erachtens also auch deshalb an den Differenzen zwischen Menschen ansetzen, weil Gleichheit als konzeptionelle Voraussetzung viele ausgrenzt und den Kreis der potenziell Solidarischen sehr einschränkt. Auch wenn identitätspolitisch motivierte Kämpfe zu Solidarität führen können, ist es wichtig zu betonen, dass solidarische Praxis sich nie auf diejenigen beschränken kann, mit denen eine kollektive Identität geteilt wird. Das gilt für die Kämpfe von Minderheiten, das gilt aber auch ganz allgemein: Die Menschen in der Ukraine verdienen nicht deshalb unsere Solidarität, weil sie "auch Europäer:innen" sind, sondern weil sie einem Angriffskrieg ausgesetzt sind und leiden.
STANDARD: Wie können wir solidarisch sein, auch wenn wir nicht dieselben Erfahrungen teilen?
Kastner: Es gibt ja viele historische Beispiele für diese Art von Solidarität: Der Kampf gegen Sklaverei wurde nicht allein von Versklavten geführt, es gab Unterstützungen für Frauenrechtsforderungen von Männern, für Bergarbeiterstreiks von liberalen Intellektuellen, gegen die Apartheid in Südafrika von westeuropäischen Weißen usw. Diese Solidarität ohne gemeinsamen Grund, diese unbedingte Solidarität kann sehr unterschiedlich motiviert sein: moralisch, humanistisch oder sozialrevolutionär. Inhaltlich geht es um den Einsatz für andere – und nicht für Gleiche und Ähnliche –, und um die Unterstützung bei der Durchsetzung kollektiver Rechte. Das können Bürger:innenrechte wie in den Kämpfen der US-Bürgerrechtsbewegung sein, das kann aber auch ganz allgemein ein Recht auf Leben sein. Die Organisation Sea Watch, die Refugees rettet, die auf ihrer Flucht über das Mittelmeer zu ertrinken drohen, wirbt in diesem Sinne mit dem Slogan "Defend Solidarity" für ihre Arbeit.

Susemichel: Ein eingängiges Beispiel, auf das wir in unserem Buch eingehen, sind die Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM), die den britischen Bergarbeiterstreik 1984/85 unterstützt haben. LGSM mobilisierte während des einjährigen Arbeitskampfes gegen die Politik Margaret Thatchers und sammelte Geldspenden für die Familien der Streikenden. Später zeigten sich im Gegenzug die Minenarbeiter solidarisch und marschierten 1985 ganz vorne bei der Lesbian and Gay Pride Parade in London mit.
STANDARD: Wie habt ihr den Umgang mit Solidarität beziehungsweise dem Begriff während der ersten Wochen des Ukraine-Krieges erlebt?
Kastner: Es ist einerseits immer wieder sehr ermutigend zu sehen, wie viele Menschen spontan bereit sind, sich solidarisch zu verhalten: Geld spenden, Menschen aufnehmen usw. Es braucht auch gar kein politisch gefestigtes Weltbild, um solidarisch zu sein. Doch die Ukraine-Solidarität hat auch problematische Seiten. Vor allem konservative Kräfte haben schnell "gute", also legitime Flüchtlinge, von "schlechten", also vermeintlich illegitimen, unterschieden. Ich bezweifle auch, dass die ukrainische Nationalflagge ein gutes Symbol für Unterstützung ist, schließlich sollte es um konkrete Menschen jenseits nationaler Zugehörigkeit gehen. Und es ist ja auch nicht alles gutzuheißen, was im Namen des ukrainischen Nationalismus geschieht. Ein weiteres Dilemma ergibt sich direkt aus der Kritik am Paternalismus, die fordert, dass diejenigen mehr Definitionsmacht bekommen sollen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Was aber, wenn die nun sagen: Eure Soli-Partys und Care-Pakete sind ja nett, aber wir wollen Waffen. Das zeigt einmal mehr, dass Solidarität eine Beziehung ist, die allen Beteiligten viel abverlangt, und kein einmaliger Akt der Hilfeleistung.
STANDARD: Frauensolidarität ist ein Begriff, der verwunden zu sein scheint. Warum? Reicht "Frausein" nicht mehr, um solidarisch miteinander zu sein?
Susemichel: Das hat noch nie gereicht. Von Anfang an wurde darum gerungen, wer denn eigentlich das politische Subjekt des Feminismus ist, ob etwa auch für die Rechte von Arbeiterinnen, von schwarzen Frauen, Prostituierten, von lesbischen Frauen gekämpft wird. Und wer überhaupt als Frau gilt! Im Feminismus zeigt sich exemplarisch, inwiefern Identitätspolitik problematisch werden kann, nämlich dann, wenn sie "essenzialistisch" ist und zu rigiden Ausschließungen führt, also eine exklusive Form von Solidarität betreibt. Dass es zum Beispiel bis heute Feministinnen gibt, die nur mit Frauen mit Gebärmutter solidarisch sind und Transfrauen diskriminieren, hat leider auch den Begriff "Frauensolidarität" in Mitleidenschaft gezogen.
Kastner: Zuletzt hat das vielleicht die argentinische Soziologin Verónica Gago sehr schön auf den Punkt gebracht: Es gehe bei den neuen feministischen Kämpfen darum, schreibt sie, Verbindungen zwischen Erfahrungen, Werdegängen und Kämpfen herzustellen – und diese Verbundenheit nicht vorauszusetzen. Auch sie nennt diese Politik der Solidarität eine, die "nicht auf Ähnlichkeit anspricht, sondern auf Differenz".

STANDARD: Wie könnte Solidarität als politisches Instrument wieder greifbarer und konkreter werden?
Susemichel: Die Corona-Krise hat Solidarität ja sehr greifbar gemacht. Schließlich repräsentiert die Arbeit der "Systemerhalter:innen", von denen so viel die Rede war, eine Form von Solidarität, die gut veranschaulicht, wie sehr wir alle voneinander abhängig sind und wie existenziell diese wechselseitige Abhängigkeit ist. Die Pandemie hat zudem deutlich werden lassen, dass sich Krisen nur selten lokal einhegen lassen, sondern dazu tendieren, sich auszubreiten, und deshalb auch global bekämpft werden müssen. Leider hat das noch nicht dazu geführt, dass die Relevanz von Solidarität als politisches Instrument erkannt wird, also dass es zum Beispiel global eine solidarische Impfstoffverteilung gibt, was ja auch aus epidemiologischer Sicht sinnvoll wäre. Oder dass es Solidarität bei der Bezahlung dieser Systemerhalter:innen gibt. Ich habe dennoch die Hoffnung, dass diese Debatten zumindest etwas angestoßen haben. Nicht zuletzt hat die ungewohnte Aufmerksamkeit für Care-Arbeit auch das traditionell männliche Konzept von Solidarität infrage gestellt. Solidarität wird demokratietheoretisch nicht zufällig oft mit "Brüderlichkeit" gleichgesetzt. Das hatte mitunter ein soldatisches Solidaritätsverständnis zur Folge, das mit Loyalität, Entschlossenheit und männlichem Mut assoziiert ist. Wenn wir Solidarität konkreter machen wollen, sollten wir solidarisches Handeln jedoch entheroisieren und vielmehr auf die alltäglichen Abhängigkeits- und Fürsorgebeziehungen fokussieren.
Kastner: Allerdings argumentieren wir auch gegen eine einfache Gleichsetzung von Solidarität und Kooperation. Die frühen Theoretiker der Solidarität – Émile Durkheim, León Bourgeois und Pjotr Kropotkin – haben sowohl auf die Verallgemeinerung "gegenseitiger Hilfe" (Kropotkin) als auch auf die positiven Effekte von Arbeitsteilung gesetzt, bei der Kooperation einfach notwendig ist und sich deshalb vervielfachen würde. Aber nicht jede empathische Zuwendung und schon gar nicht jede Kooperation ist schon Solidarität. Natürlich braucht Solidarität auch institutionelle Rahmenbedingungen, die es Menschen ermöglichen, gemeinwohlorientiert zu handeln, ohne sich beispielsweise bei Konsumentscheidungen jedes Mal als "guter Mensch" beweisen zu müssen. Ein Lieferkettengesetz etwa wäre hierfür ein Beispiel, weil dadurch vermieden – oder zumindest stark eingeschränkt – werden könnte, dass wir alle von der Ausbeutung von Menschen aus dem Globalen Süden profitieren, wie es derzeit der Fall ist. Und Solidarität würde dabei auch nicht als moralischer Anspruch auf der oder dem Einzelnen lasten.
Susemichel: Bei der Auseinandersetzung mit Solidarität landet man ja unweigerlich bald bei der moralphilosophischen Frage, ob Menschen nun "von Natur aus" eher gut oder schlecht sind. Doch obwohl es unzählige ermutigende Beispiele dafür gibt, dass es etwa nach Naturkatastrophen viel häufiger zu Kooperation und nicht zu Konkurrenz kommt und sich viele Menschen spontan sehr solidarisch und gar nicht selbstsüchtig verhalten, lässt sich diese müßige Frage wohl nicht abschließend klären. Deshalb wäre es doch viel lohnender, darüber nachzudenken, welche Voraussetzungen und Verhältnisse nötig sind, damit Menschen sich solidarisch verhalten. Denn Solidarität darf nicht nur als individuelle Handlung und Haltung verstanden werden, die auf einer moralischen Überzeugung basiert, entscheidend sind eben auch die institutionalisierten Formen von Solidarität, etablierte Solidarsysteme, sei es bei der Gesundheits-, der Finanz-, der Klima- oder der Asylpolitik. Was sind die gesellschaftlichen Gelingensbedingungen von Solidarität? Das ist die entscheidende Frage. (Beate Hausbichler, 27.6.2022)