Bürokratismus ohne Grenzen
Ronald Pohl, Kultur

Mit den Ansichten des Privatmannes Uwe Tellkamp ist womöglich wirklich kein Staat zu machen. Seit dem durchschlagenden Erfolg des Wenderomans Der Turm (2008) pflegt der Dresdner das Image des Dauerbeleidigten. Tellkamp nörgelt unausgesetzt: vor allem über eine Öffentlichkeit, die Wutbürgern wie ihm – angeblich – den Mund verbietet. Mit patzigen, rechtskonservativen Aussagen über Gott und die Welt hat er vor allem seinem neuen Buch einen echten Bärendienst erwiesen.
Dabei bildet der Romankomplex Der Schlaf in den Uhren ein faszinierendes, rund tausendseitiges Unikum. Wie in den Monumentalwerken der großen Wienerin Marianne Fritz (1948–2007) steht die Leserin vor einem Festungskomplex: Darin wimmelt es von Figuren der alten DDR, Entscheidungsträgern, untergetauchten Mitläufern, niedergedrückten Rechthabern. Die DDR und die alte Bonner Republik wirken zeitweise wie ineinandergeblendet.
Tellkamps Konstruktion verwirklicht etwas Unerhörtes. Indem er das Personal von 1989 in die heutige Berliner Republik hinüberprojiziert, gelingt ihm eine Art Palimpsest. Die Gesamtgesellschaft erscheint als Wasserstadt. In deren Gerinnseln und Adern fließen die Ideologeme von einst und jetzt zusammen, gemeinsam vergiften sie die Meinungsfreiheit. Die Welt, wie wir sie (nicht) kennen, erscheint als ein einziger, pervers-bürokratischer Erfassungsvorgang.
Tellkamps Fantasieland "Treva" ergibt ein Kontinuum, eine Art Suprabürokratie, aus deren Kapillaren das Gift des Totalitarismus tropft. Die Gesinnungswächter im bundesdeutschen Feuilleton haben dem Autor nicht nur sein vielfach törichtes Gerede übelgenommen – sie haben sein Buch vorsorglich, ohne es allzu gründlich studiert zu haben, in Grund und Boden verrissen. Manchmal sind Werke freilich interessanter und triftiger als die Urheber, die für ihr Zustandekommen verantwortlich zeichnen. Uwe Tellkamp ist ein brillanter Prosaist; sein Schlaf in den Uhren, ein Roman so "unmöglich" wie die berühmten paradoxen Bildobjekte M. C. Eschers, verdient jeden Leseaufwand.
Aufstieg, rauf ins Nirgendwo
Beate Hausbichler, dieStandard

Die Disziplin der Autofiktion schien bisher vor allem in Frankreich daheim zu sein. Auf den Spuren der französischen Soziologie-Berühmtheit Pierre Bourdieu und seines ordentlich akademischen Ein soziologischer Selbstversuch wird inzwischen auch in Romanform der starken Wirkung der sozialen Herkunft nachgespürt. Und der Erfolg von Annie Ernaux, Édouard Louis oder Didier Eribon zeigt, wie groß das Interesse an Lebensgeschichten ist, die unsere Herkunft als stillen Kompass für alles Weitere ins Zentrum stellen. Romane wie diese verkauften sich zuletzt wie ein kühles Cornetto am lauwarmen Baggersee.
Nun erzählt auch eine Britin nah an ihrem eigenen Leben eine Geschichte über die komplizierte Beziehung aus dem Selbst, Herkunft und Gesellschaft. Einer sexistischen, rassistischen und klassistischen Gesellschaft, in der aber vielleicht gerade deswegen die meisten fest an "Leistung" glauben, so wie in Natascha Browns Roman Zusammenkunft. Sie, die Leistung, ist das Allheilmittel, das zum guten Leben führt.
Auch die namenlose Protagonistin in dieser kurzen Geschichte leistet unaufhörlich, sie liefert, seit sie denken kann. Arbeite hart, dann ist es egal, dass du schwarz bist, eine Frau bist! Sie arbeitet in der Finanzbranche, sie verdient viel Geld. Sie hat es geschafft in dem Land, in das ihre Vorfahren migriert sind und in Armut lebten. Sie hat alles richtig gemacht, wie es so schön heißt. Und sie hasst es. Sie verabscheut es, der Diversity-Beweis zu sein, Schülerinnen bei Vorträgen vorzumachen, dass auch sie es schaffen können.
Ja, was denn eigentlich? Mit verschwitzten Typen im Großraumbüro Kohle zu scheffeln, die bei gebotener Gelegenheit gern ihre Überlegenheit demonstrieren, indem sie in ihren Sesseln weit zurückgelehnt darüber sinnieren, welche Sprache über Frauen oder schwarze Menschen sie akzeptieren können? Oder durch welche "politische Korrektheiten" ihnen diverse Gelegenheiten entgehen? Das würde ihr bestens erzogener Upperclass-Freund freilich so nie sagen, er liebt sie. Oder doch sein progressives Bild von sich, zu dem sie ihm verhilft? All die Arbeit, um dorthin zu kommen? Dann schon lieber noch eine Woche Ferien dranhängen. Das ist nur eine mögliche Botschaft dieser Urlaubslektüre.
Beziehungen und andere Kampfzonen
Michael Wurmitzer, Kultur
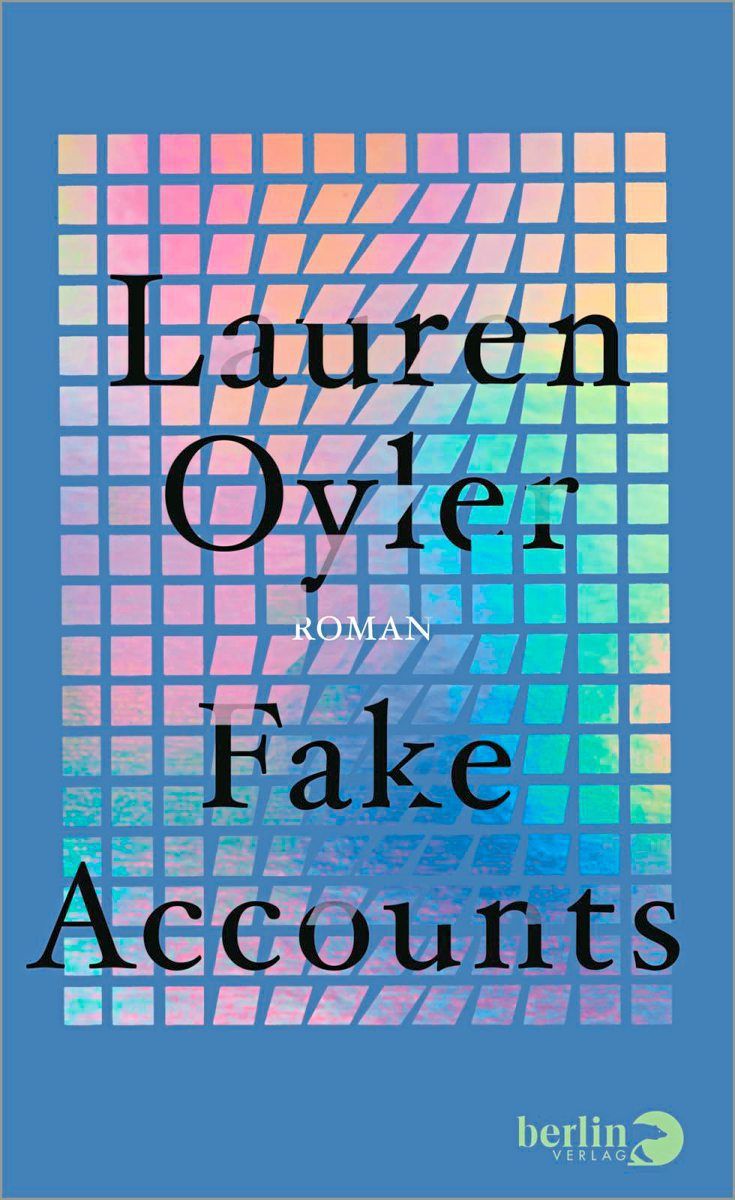
Lust auf Berlin? Dann böte sich ein Trip mit Lauren Oyler an. Touristenprogramm liefert die Autorin zwar nicht. Dass Berlin so "chill" sei, erzählt die Hauptfigur in Fake Accounts ihren Freunden nur, um einer echten Antwort aus dem Weg zu gehen. Sie ist in die deutsche Hauptstadt gekommen, nachdem ihr Freund Felix bei einem Unfall gestorben ist. Zwar hatte sie überlegt, sich von ihm zu trennen, seit sie draufgekommen war, dass er auf Instagram Verschwörungstheorien verbreitete. Das hat sie entdeckt, als sie sein Handy wegen des Verdachts inspizierte, er träfe andere Frauen.
Doch sein Tod nimmt sie mit. In Berlin hatte sie ihn kennengelernt. Später kommt ihr dieses sich in Felix verliebende Ich vor wie "eine meiner Freundinnen, die ständig in Liebesnöte geraten, deren Entscheidungsprozesse ich einfach nicht verstehe". Warum sie noch mit ihm zusammen war, erklärt sie mit dem ökonomischen Modell "versunkener Kosten".
Sightseeing und Clubs spielen in Fake Accounts also weniger eine Rolle als die Suche nach einer WG, die Krankenversicherung, die Ausländerbehörde und Onlinedating ("ohne Quantität fand man keine Qualität"). Oyler (30) hat Witz. Scharf streift sie alle möglichen gegenwärtigen Themen wie "Privilegienscham", sexuelle Identität, Partnerschaftskonstellationen, Selbstdarstellung auf Instagram. Politisch alert, nimmt ihre Heldin am Frauenprotestmarsch nach Donald Trumps Amtseinführung teil, kauft in poshen Läden überteuerte Lebensmittel. Generationenporträt, lautete immer wieder das Lob, und das Buch wurde zum Bestseller.
Als Angestellte eines Onlinemediums hat die Heldin zu vielem eine Meinung. Das hat sie mit der US-Autorin gemein, die in Yale studiert hat, später nach Berlin und New York zog. Dort hat Lauren Oyler Artikel über Gender und Identität geschrieben, inzwischen liefert sie Essays und Kritiken an The New Yorker oder die New York Times. Schnell erzählt, enthält Fake Accounts viele treffende Beobachtungen, auch wenn der Roman zum Ende hin etwas an Prägnanz verliert.
Meuchelmörderische Zivilisation
Margarete Affenzeller, Kultur
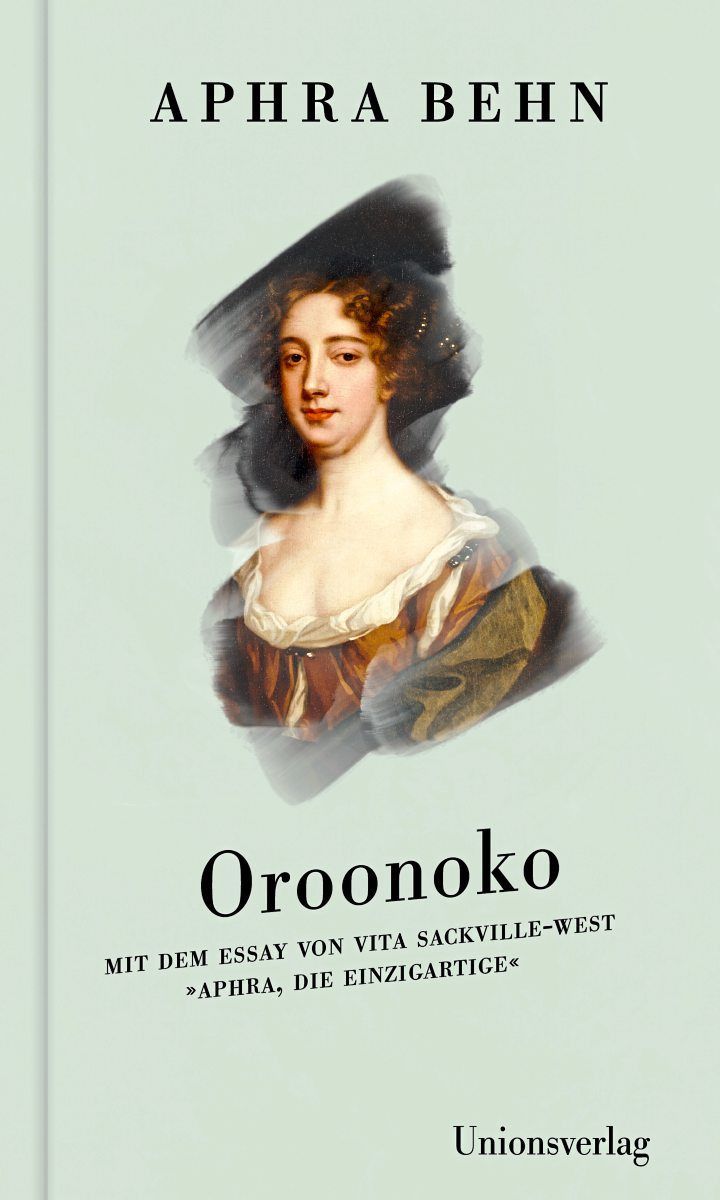
Aphra Behn galt zu ihrer Zeit (1640–1689) in England als gefeierte Theaterautorin, die von den Tantiemen ihrer Werke auch leben konnte. Eine bemerkenswerte Sache! Dennoch ist ihr Œuvre heute kaum bekannt. Behns wildes Schreiben, unkonventionell und tabubrechend (ihr Gedicht The Disappointment handelt vom weiblichen Nichtorgasmus), hat dennoch immer wieder ansprechende Übertragungen ins Deutsche hervorgebracht. So auch nun von ihrem Roman Oroonoko, der neu im Unionsverlag erschienen ist.
Er erzählt vom versklavten Prinzen Oroonoko und seiner Braut, beide PoC, die in den Mühlen der Kolonialgewalt und einer maroden Zivilgesellschaft buchstäblich vor die Hunde gehen. Behn recherchierte die Geschichte im südamerikanischen Surinam, einer damals britischen Kolonie, wo sie, Spross einer zu Kolonialisten aufgestiegenen Barbiersfamilie, in ihren frühen Jahren lebte. Der Roman schildert, wie verderblich patriarchale und ehrgesteuerte Herrschaftsmodelle wirken und wie weit ein einzelnes Individuum seine Prinzipien verteidigen kann. Plot: Aufgrund einer Intrige seines Großvaters, der die Braut des Enkels für den eigenen Harem beansprucht, landen Oroonoko und Imoinda in der Versklavung.
Die Gratwanderung zwischen Leibeigenschaft und königlichem Selbstverständnis, die Korrumpiertheit von Entscheidungsträgern und die Angst voneinander abhängiger Personen spinnen das Geflecht einer fragilen, meuchelmörderischen Zivilisation. Behn erzählt geschmeidig und kraftvoll, so heillos mitfühlend wie auch hemmungslos sachlich.
Man könnte sagen: Jane Austen goes Splatter, denn hier werden aus Liebe wahrlich Eingeweide herausgerissen: Frauenmord, erweiterter Suizid, Besitzdenken – alles da. Drei Essays sind dem Band beigefügt, unter anderem gibt Vita Sackville-West Einblick in die Wirkungsgeschichte des Romans sowie in Behns Biografie – sie war auch Spionin.
Wahrhaftige Yin-Yang-Hochschaubahn
Mia Eidlhuber, Album
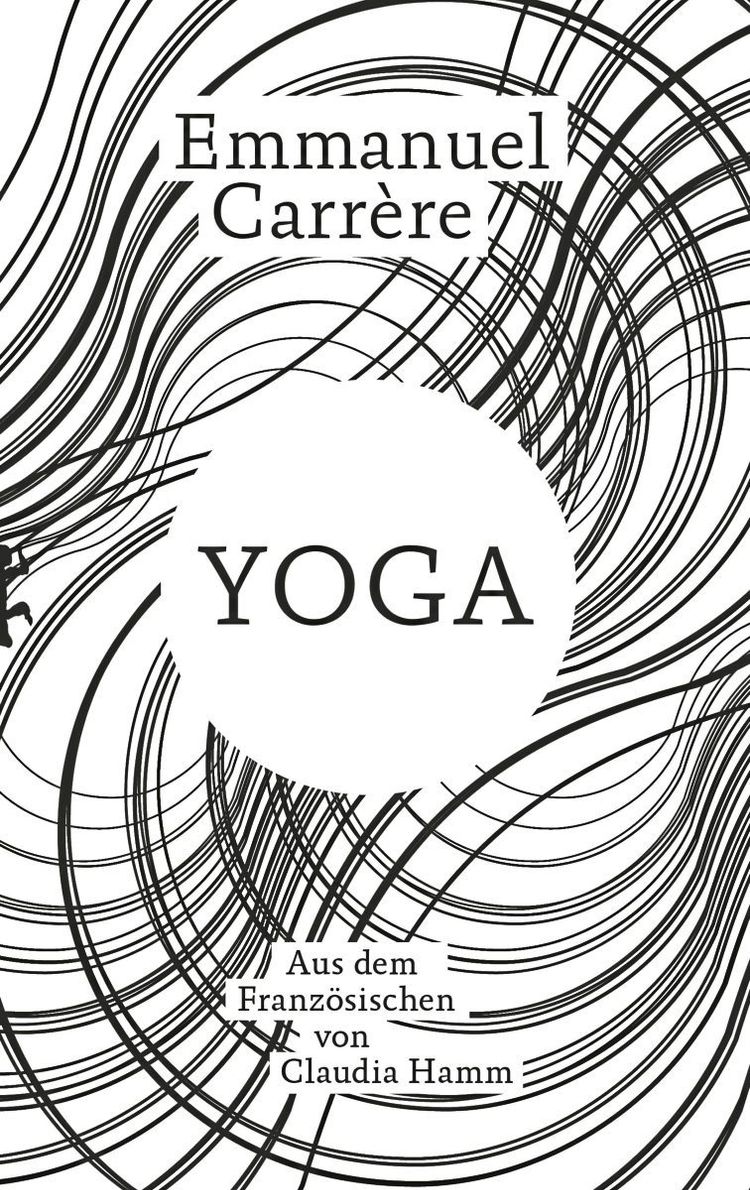
Yoga entwickelt von Beginn an einen Sog. Dass es ein Lieblingsbuch wird, das hat sich bereits beim Lesen des ersten Satzes entschieden, der tatsächlich (in einer wunderbaren deutschen Übersetzung) 13 Zeilen lang ist und sofort klarmacht, dass Emmanuel Carrères Buch zunächst zwar von einem Meditations- und Schweige-Retreat, also von Yoga, wie wir es kennen, handelt, aber dann eben von vielem anderen auch: Jihad-Terrorismus in Frankreich, der europäischen Flüchtlingskrise, schweren Depressionen und einem Aufenthalt in der Psychiatrie und nicht zuletzt einer Trennung, über die in diesem autobiografischen Buch aber (per Verfügung der Ex-Frau) nicht geschrieben werden durfte, weil der Autor Carrère mit diesem jüngsten Roman in Frankreich einen veritablen Skandal um Wahrheit in der Literatur ausgelöst hatte.
Das allerdings wusste ich bei Lektürebeginn nicht, ich habe zuvor nichts von Carrère gelesen, auch nicht das interessante Interview mit seiner Übersetzerin Claudia Hamm, die erklärt, was "Yoga" im Wortsinn bedeutet, nämlich: "zwei widerstrebende Kräfte unter ein Joch zwingen". Der Titel ist also Programm dieses oft als atemlos beschriebenen Romans, denn er handelt spielerisch komponiert und in einer Tour von Polaritäten: Leben und Tod, Privates und Politik, Überfluss und Armut, Freude und Schmerz, Verwirrtheit und Klarsicht, der Liebe und deren Ende.
In Yoga formuliert Carrère sein oberstes Credo so: "Die Literatur ist der Ort, an dem man nicht lügt", und man glaubt ihm das. Dieser wahrhaftige Erzähler setzt uns in eine Art Yin-Yang-Hochschaubahn und lässt uns die Bewegungen seines Lebens zwischen 2014 und 2018 nachspüren: vom gelassenen Yoga-Retreat, von dem aus er zurück nach Paris geholt wird, weil ein Freund beim Anschlag auf Charlie Hebdo ums Leben gekommen ist, bis auf die griechische Insel Leros, auf die er aus seinem alten, depressiv machenden Leben flüchtet, um jugendliche Flüchtlinge zu betreuen und dabei selbst wieder ins Leben zu finden. Am Ende steht die Hoffnung und Lesenden das Wasser in den Augen. Alles ist wahr liegt schon bereit.
Diskursive Wespennester
Dominik Kamalzadeh, Kultur

Nicht nur die Freiheit per se, schon der Begriff ist umkämpft. Dass Anti-Corona-Demonstranten etwa mit der "Freiheit" auf ihrem Banner marschiert sind, zeigt auf, wie stark man sie verkürzt, wenn man darunter nur das Gegenteil von Pflicht versteht. Die US-Essayistin Maggie Nelson (Die Argonauten) hat sich mit ihrem Buch Freiheit der delikaten Aufgabe gestellt, den Begriff im Kontext aktueller Debatten neu zu beleuchten. Sie beruft sich dabei auf das, was der französische Philosoph Michel Foucault "Praktiken der Freiheit" nannte – behutsame Versuche darüber, wie Freiheit mit Umsicht gegenüber anderen zusammengeht. Die Widersprüche, die dabei entstehen, werden ausgetragen. In einer Zeit der übereindeutigen Ansagen ist dies keine Kleinigkeit.
Nelsons Buch trägt den Untertitel Vier Variationen über Zuwendung und Zwang. Ihr Fokus richtet sich auf kontrovers diskutierte Felder: die Freiheit der Kunst, den diskursiven Umgang mit Sex (im Zusammenhang mit MeToo) sowie mit Drogen und der Klimakrise. Vor allem mit den ersten beiden Themenfeldern tappt Nelson in Wespennester, denn ihr abwägendes Denken trachtet nicht danach, sich eilig auf eine Seite zu schlagen.
In der Auseinandersetzung mit Dana Schutz’ Gemälde Open Casket, dessen Darstellung eines ermordeten Schwarzen auf der Whitney Biennale 2017 eine heftige Debatte über Appropriation und Cancel-Culture auslöste, beweist Nelson dialektisches Geschick: Sie lässt die Einsprüche der Gegner gelten, ohne der Forderung nach Entfernung oder gar Zerstörung zuzustimmen. Man müsse anerkennen, so Nelson, dass in der Kunst auch "verstörende" Elemente Ausdruck finden, und den Kontext jeweils gesondert diskutieren.
Ähnliches Fingerspitzengefühl beweist Nelson, wenn es um die Forderung nach gesellschaftlichen Regeln im Umgang mit sexuellem Fehlverhalten geht. Nelson argumentiert hier auch aus der Position einer queeren Minderheit, die eine andere Sensibilität dafür besitzt, was von der Mehrheitsgesellschaft als sexuell akzeptabel oder abscheulich eingestuft wird. Es verwundert nicht, dass Nelson für ihr Buch in den USA viel Kritik einstecken musste. Wer Ambiguitäten sucht, sollte es jedoch unbedingt lesen.
Eine Familie am Scheideweg
Petra Stuiber, stv. Chefredakteurin

Einerseits ist dieser Roman keine Urlaubslektüre. Weil: 800 Seiten! Und das vom virtuosen Wort- und Sätzedrechsler Jonathan Franzen, also: anstrengend! Andererseits ist dieser Roman genau die richtige Urlaubslektüre. Weil: 800 Seiten! Und Franzens erzählerische Wucht, seine schreiberische Virtuosität kann man nur genießen, wenn man seelisch in der Hängematte baumelt.
Die Hildebrandts leben 1971 in einem Vorort von Chicago, in den sich noch nie ein Mensch schwarzer Hautfarbe verirrt hat. Sie sind alle weiß und spießig und haben, drei Jahre nach dem Bürgerrechtserweckungsjahr 1968, ihre beste Zeit hinter sich. Der Vater, Russ, ist ein beliebter Pastor, der gegen den Vietnamkrieg predigt. Dass in Wahrheit seine Frau Marion, Hausfrau und Mutter von vier Kindern, die Predigten schreibt, schiebt er beiseite.
So lange, bis ein jüngerer Pastor in sein Reich eindringt und die Jugendgruppe "Crossroads" gründet. Der Zulauf ist gewaltig, weil man in Ambrose’ Gruppe nicht kniet beim Beten, das jeweilige Verhältnis zu Gott über das Verhältnis zu den anderen in der Gruppe definiert – und überhaupt alles anders macht als bei Russ. Der stürzt in eine gewaltige Midlife-Crisis, deren Höhepunkt sich auf einem Charity-Camp in Arizona entfaltet.
Russ’ zweitjüngster Sohn, Perry, stürzt in einen gewaltigen – auch sprachgewaltigen – Drogenrausch ab, sein ältester Sohn Clem zieht, zu spät, in den Vietnamkrieg – aus Gründen sozialer Gerechtigkeit, seine verklärte Tochter Becky wird mit 17 von einem Hippie-Folksänger aus der Crossroads-Gemeinde geschwängert, sie heiratet und ist fortan Hausfrau. Und seine Frau Marion verlässt ihn – beinahe.
Jeder ist ständig, ganz unzynisch, damit beschäftigt, besser zu werden, gottesfürchtiger, hinterfragt seine Motive auf teils anstrengende Weise. Franzen hat ein explizit langsames Buch geschrieben. Um sich in das Schicksal der protestantischen Pastorenfamilie Hildebrandt einzufühlen – dafür braucht man Geduld. Und man muss sich, wie die Süddeutsche Zeitung in einer Rezension schrieb, ein wenig ins 19. Jahrhundert zurückversetzen, als man sich noch in aller Unschuld, unberührt von der Abgeklärtheit einer digitalen Mediengesellschaft, in moralphilosophischen Entwicklungsromanen ergoss. Aber es zahlt sich aus. Franzen ist ein virtuoser Erzähler, das kann man besonders genießen, wenn man auf einen See oder ein Meer schaut und sich mental dem Zen-Buddhismus nähert. Dieser Urlaubszustand wird Crossroads auf jeden Fall gerecht. (ALBUM, 26.6.2022)