Mehr als 50 Bücher mit Gedichten, literarisch-essayistischen Texten und lyrischer Prosa hat Julian Schutting in den letzten fünf Jahrzehnten geschrieben. Unabhängigkeit von Markt- und Literaturbetriebsgesetzen und das Verfolgen eines eigenen poetischen Weges waren ihm dabei stets wichtiger als das Rampenlicht. Mit dem Germanisten Gerhard Zeillinger, der als 16-Jähriger begann, Schutting zu lesen, später über ihn dissertierte und vor zwanzig Jahren von Julian Schutting zu dessen künftigem Nachlassverwalter bestimmt wurde, spricht er über sein Schreiben, Narrenfreiheiten und den Alltag.
STANDARD: Als im Mai die Vergabe des Artmann-Preises an Sie bekannt wurde, haben Sie in einem APA-Interview verkündet, Sie hätten Gott sei Dank keine Fantasie, sind Rationalist durch und durch. Wie kann man, wenn man keine Fantasie hat, eigentlich Dichter werden?
Schutting: Indem man davor gefeit ist, sich was zusammenzudichten. Man hält sich an das Alltägliche, und wenn man Glück hat wie ich, hat man vom lieben Gott eine gute Imaginationskraft bekommen, die einen befähigt, sich aus kleinen Beobachtungen delikat beunruhigender Art beispielsweise gesellschaftliche, politische Ängste aufsteigen zu lassen. Man wird bei so vielem an Praktiken der NS-Zeit gemahnt.
STANDARD: Und das wäre dann gedichttauglich? Wo fängt etwas an, ein Gedicht zu werden?
Schutting: Ich habe es mir zur Vorschrift gemacht, ein jedes Gedicht habe auch eine Rechtfertigung zu sein, wodurch es ein Gedicht sei. Nämlich durch sein Formales, durch Variationen eines Einfalls in ihn umkreisenden Zeilen. Der Leser müsste ein Gedicht als das erkennen, selbst wenn es in Prosa gedruckt wäre. Wenn er dann sagt: "Aber das ist doch ein Gedicht!", wäre das für mich ein großes Kompliment. Wovor man sich aber zu hüten hat, das ist lebensphilosophischer Schwachsinn.
STANDARD: Ihr erstes Buch, ein Gedichtband, erschien vor bald 50 Jahren. Hat sich an der Art, Gedichte zu schreiben, viel verändert?
Schutting: Stil oder Manier ist einem eingeboren, das muss nur kultiviert werden. In meiner Frühzeit habe ich Gedichte über die Natur von Gedichten geschrieben, in etwas großgoscherter Thesenform. Aber da ich nicht mehr blutjung war, ist da nichts, was gedanklich unterm Hund wäre.
STANDARD: Sie waren 36, als das erste Buch erschien ...
Schutting: ... und da war vieles noch sehr kopflastig. Die Narrenfreiheit von heute habe ich damals natürlich nicht gehabt.
STANDARD: Ein Gedicht ist ja auch nicht etwas, das einem zufliegt.
Schutting: Also, am besten geraten mir die Gedichte, deren erste Zeile mir tatsächlich zuzufliegen scheint, die stellt sich ein.
STANDARD: Und danach die Knochenarbeit?
Schutting: Arbeit? Ich weiß nicht. Das Vergnügen ist doch: wie ein Architekt vor dem in Rohform Hingeschriebenen zu verfahren. Oder wie ein Lokführer auf einem Verschubbahnhof Zeilen- und Wortgruppenverschiebungen durchzuprobieren. Gedichte sind vor allem Gemachtes, Erklügeltes, selbst wenn ihnen Empfundenes oder Gefühltes zugrunde liegt. Es lässt sich nur nicht alles zugunsten eines strengen Gebildes zurückdrängen.
STANDARD: Manches entsteht im Gehen.
Schutting: Man sitzt ja nicht nur am Schreibtisch, ich könnte das gar nicht.
STANDARD: Sie haben einmal gesagt: Vier Stunden gehen, vier Stunden schreiben. Ist das noch immer so?
Schutting: Das dürfte sich ganz von selbst so eingebürgert haben. Heute wäre das etwa drei zu drei. Und was Zweiteres betrifft, das war immer schon mehr ein Am-Schreibplatz-Hocken als ein zügiges Schreiben. Zügig wird nur gegangen, mit einem Zeit- und Schrittzähler am Hosenbund. Und seit geraumer Zeit mit einem Walkingstock, weil mich des Öfteren so ein Schwankschwindel belästigt – wer möchte schon gern am Vormittag als angetrunken eingestuft werden!

STANDARD: Im Stadtbild von Wien kann man Ihnen leicht begegnen. Kann man sagen, Sie sind ein Stadtflaneur?
Schutting: Ein Stadtflaneur an den mehrheitlich faulen Tagen, ansonsten ein Weinberg- und Wienerwaldwanderer. Einmal pro Woche bin ich ein Ersteiger des Kahlengebirges.
STANDARD: Wie darf man sich insgesamt den Alltag eines Dichters vorstellen?
Schutting: Dichter bin ich ja nur in dem Moment, wo ich angesichts von etwas Geschriebenem feststelle: "Da ist dir was mehr als Taugliches gelungen!" Nach immer viel zu kurzem Schlaf sitze ich früh, oft schon um fünf, im Pyjama an meinem Fensterplatz und notiere, was mir in der Nacht im Halbschlaf eingefallen ist.
STANDARD: Sie "dichten" auch im Schlaf?
Schutting: Ja, als ein Zwangsnachtarbeiter. Wer schlecht schläft, träumt viel, das sind wirklich eigenartige, komplexe Sachen, und das bildet dann meine Morgenarbeit. Dann aber drängt es mich bald hinaus, meist für ein zweieinhalbstündiges Dahinziehen, bei dem ich selten für Stichwortnotizen kurz stehenbleiben muss. Wieder zu Hause, will ich ungeduldig an den Schreibplatz, für etwa eineinhalb Stunden. Danach halte ich Rast mit den zwei Gratisblättern ...
STANDARD: Sie lesen "Heute" und "Österreich"?
Schutting: Ja, beides unglaubliche Quellen der Inspiration!
STANDARD: Und wenn ich jetzt frage: Könnten Sie auch schreiben ohne das tägliche Gehen?
Schutting: Eine mehr als taktlose, eine an meine Existenz rührende Frage! Vor vielleicht sieben Jahren hätte ich noch gesagt: Das Schlimmste für mich wäre es, nicht mehr schreiben zu können – eine schwere Krankheit, ein böser Unfall wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Heute sage ich mir öfter: Nicht mehr halbwegs flott unterwegs sein zu können, das wäre mir längst schlimmer, als wenn mir nichts Aufschreibenswertes mehr zufiele!
STANDARD: Gehen bedeutet ja ein ständiges Beobachten. Wie sehr hat das mit Ihrer ursprünglichen Ausbildung als Fotograf zu tun?
Schutting: Gehen heißt bei mir vor allem: zu schauen, aber ohne mich an jeden Schmarrn zu verlieren, da ich ja kaum stehen bliebe. Der Fotografie habe ich ein ganz gutes visuelles Gedächtnis zu verdanken.
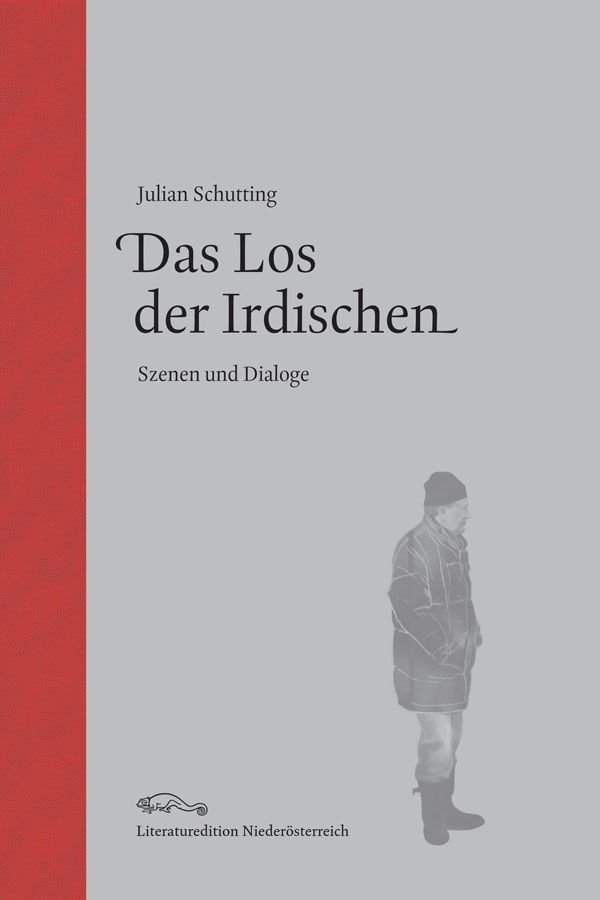
STANDARD: Im jüngsten Gedichtband, "Winterreise" geht es auch um das Wandern, aber im existenziellen Sinn. Ist das Irren durch die Welt, so wie im Schubert’schen Liederzyklus, ein notwendiges Programm?
Schutting: Ich bin nie ein Schmerzsucher gewesen, aber in Liebesschmerz habe ich mein Ich am deutlichsten zu spüren bekommen – in Liebesexzessen, da wird man durchwühlt von der Gewissheit zu leben.
STANDARD: Sie haben in den 1970er-Jahren zu publizieren begonnen und hatten schnell als Avantgardist einen Platz in der Literaturlandschaft. Das muss eine spannende Zeit gewesen sein.
Schutting: Falls ja, habe ich davon so gut wie nichts gemerkt. Als Hausautor des Residenz-Verlags habe ich pflichtschuldig an Veranstaltungen teilgenommen, aber mich nie sehr für "gleichaltrige" österreichische Literatur interessiert. Das Café Hawelka habe ich nie betreten. Galerien sind das Meine gewesen und die Oper.
STANDARD: Heute sind Sie eher der eigenwillige Klassiker, der sich um Konventionen nicht schert. Würden Sie zustimmen: Ihre Lyrik ist im Reiferwerden auch unabhängiger geworden?
Schutting: Unabhängig in dem Sinn, dass ich mir öfter erlaube, von meinen Konventionen und den mir auferlegten Normen abzuweichen. Das gilt auch für sprachliche Gebote, dass ich etwa dann und wann ein Satzgefüge nicht mehr sklavisch genau die Logik befolgen lasse.
STANDARD: Das sind dann noch mehr die Zeilen eines Sprachakrobaten.
Schutting: Ach, Sprachakrobatik würde ich das gar nicht nennen. Die einstmals geschlagenen Pfauenräder eines Artisten bin ich längst losgeworden.
STANDARD: Fühlt man sich mit bald 85 da befreiter?
Schutting: Wirklich will ich es mir noch nicht glauben, dass ich demnächst 85 werde. Manchmal im Aufwachen denke ich an Loriot: "... und dann wacht man eines Tages alt auf!" Und für mich füge ich hinzu: "Aber bitte nicht auch noch tot!" Aber bald nach diesem grässlichen Geburtstag werde ich im Überholen gemütlich dahinspazierender junger Leutel sagen: "Muss mich beeilen, bin ja zumindest viermal so alt wie ihr!"
STANDARD: Eben ist ein Buch mit szenischen Texten erschienen. In einer der Szenen fragt ein Waldgänger nach dem Weg, auf die Antwort, der führe, wohin er wolle, sagt er: "Da kehre ich lieber um." So viel Angst vor dem freien Willen?
Schutting: Unser jetziger Papst nimmt Anstoß an der Zeile des Vaterunser: "... und führe uns nicht in Versuchung!", weil doch nur der Teufel verführe. Vielleicht sollte man es ihm ins Schlichtere übersetzen: "Gib uns nicht Möglichkeiten, denen wir moralische Krüppel nicht gewachsen wären ..." Und mein besagter Wanderer überlegt wie ich im Schreiben, wie viele unwiderstehliche Situationen sich da plötzlich für ihn ergeben könnten, bis zum Sich-Erhängen!
STANDARD: In einer anderen Szene – sie ist nicht erfunden – gibt sich ein Verrückter als "Dein Tod" zu erkennen. Muss man in solchen Augenblicken erschrecken?
Schutting: Mir war dieser Verrückte nur unbehaglich als unberechenbar, er könnte mich ja im Neben-mir-Hergehen hinunterrempeln wollen auf die Eisenbahnschienen. Es ist niemand außer uns beiden da gewesen.
STANDARD: Und die Angst vor der Endlichkeit?
Schutting: Das ist eine vor den Umständen: falls ich dazu nicht mehr fähig sein sollte, mich beizeiten wie auch immer davonzumachen. Eines möchte ich als unwahrscheinlich abtun können: in meinem Bett "in statu verwesendi" vorgefunden zu werden! (Interview: Gerhard Zeillinger, 3.9.2022)