Manchmal – wahrscheinlich nur, wenn man selbst schreibt – verschärft sich das Problem noch dadurch, dass sie gar in einem ist; so tief Einzug gehalten hat in das eigene Schaffen, dass man kaum mehr etwas sagen kann, ohne sie zu referenzieren. Claudia Müllers Film Die Sprache von der Leine lassen war ein willkommener Anlass, einen solchen Versuch der Entfernung zu unternehmen – zu versuchen, die Autorin, die für mich für Jahrzehnte so entscheidend war, von außen zu sehen.

Elfriede Jelinek ist ohne jeden Zweifel der Grund, warum ich schreibe, wie ich schreibe. Als ich 15 Jahre alt war und begann an einer schweren Angststörung zu leiden, griff ich vor einem Flug, bloß weil mein Lieblingsmagazin vergriffen war, in Schwechat nach einem Nobelpreis-2004-Stapel. Es handelte sich um Michael. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft, und ich las es während der wenige Stunden andauernden Reise nach Hamburg durch. Ich las es am nächsten Tag ein zweites Mal, und am dritten Tag wieder. Elfriede Jelinek ist die einzige Autorin, deren Œuvre ich als Ganzes – einschließlich jedes Kinderbuchs und Hörspielchens – gelesen habe.
Alltag von Angst dominiert
Wenn man unter schweren psychischen Erkrankungen leidet, kann es mitunter schwierig sein, sich zu vergegenwärtigen, wofür es sich zu leben lohnt. Aber das – die Erkenntnis, dass die Sprache selbst geformt werden konnte und dass ein Mensch, dessen Alltag wie meiner von Angst dominiert war, eine solche Perfektion darin entwickeln konnte –, das war eine solche Sache.
Versteht man sich selbst aus einer solchen mythologisierenden Berufungsgeschichte heraus, wird es unmöglich, noch ein objektives Wort zu finden. Wie gesagt: Ich muss mich erst entfernen. Eine Strategie dazu könnte die Erkenntnis sein, dass meine eigene Geschichte vielleicht gar keine besondere ist. Vielleicht ist sie eine ganz ordinäre angesichts einer Frau, die für Generationen von Schreibenden ein singulärer Referenzpunkt ist und war.

Elfriede Jelinek also.
Die Rebellin, die Feministin und die Nobelpreisgewinnerin – die Skandalautorin, die FPÖ-Gegnerin und die Kommunistin. Die "mit der Mutter", die Organistin, die Modenärrin, die Antiheimatstilistin. Wenn man über Elfriede Jelinek schreibt, muss man die Phrasen umschiffen wie ein Wildwasserkanute die Torstäbe.
Man muss die Rede von der musikalischen Sprache vermeiden und sich dem Strom aus Nestbeschmutzertum und unermüdlichem Kämpfen gegen die politischen Verhältnisse entziehen, der selbst in spezialisiertesten Forschungstexten auf- und abgebetet wird wie der Katechismus. Nicht etwa weil es nicht wahr wäre, was da gesagt wird. Vielmehr, weil es von Tausenden schon gesagt wurde und weil man es einem lebendigen Menschen – einem, der noch immer schreibt – schuldig ist, ihn nicht zu einer Floskelsammlung erstarren zu lassen, die sich in den 1990ern verfestigt hat.
Was ist Musikalische Sprache?
Sich einer Autorin zu nähern heißt auch, sich zu fragen, was genau das eigentlich heißen soll: Musikalische Sprache? Was hat man selbst all die Jahre gemeint, wenn man von der einzigartigen Spielart politischer Brisanz redete, die man Elfriede Jelinek zusprach? Und was macht ihre – diese vielzitierte Sprache – ganz technisch, ganz spezifisch anders als die aller anderen?
Ich bin im Wesentlichen der Ansicht, dass große Literatur sich vage auf drei Konzepte beziehen lässt: Handwerk, Innovation und Kraft. Während Handwerk – das akkurate Schöpfen aus der Formenvielfalt und das sachverständige Einknüpfen kultureller Referenzen – sowie die kaum erklärungsbedürftige Innovation sich einigermaßen einordnen lassen, behält die Kraft für mich stets etwas Undurchsichtiges.

Die ganze Welt ist der Text
Kraft, das ist für mich die unmittelbare Kraft eines sprachlichen Ausdrucks. Ich denke oft, dass wir dieser schwer fasslichen Qualität etwa dort begegnen können, wo uns ein Witz zum Lachen bringt, dort wo ein einziges Wort uns erregt oder das Wiedererzählen eines unangenehmen Erlebnisses uns erstarren lässt – kurzum, das Eingreifen der Sprache in unseren Körper, in die sogenannte Wirklichkeit. Diese Kraft ist die Erfahrung, dass die Sprache eben nicht etwas ist, was zur Welt hinzutritt, um sie zu "beschreiben", sondern dass beide ineinander nahtlos eingreifen, weil sie von derselben Substanz sind. In diesen Momenten gibt es keine klare Demarkationslinie zwischen den Sphären.
Ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Schriftsteller*innen ich in meinem Leben gelesen haben, die diese Qualität souverän einsetzen konnten. Elfriede Jelinek war die erste und für mich bis heute entscheidendste.
Glücklicher Zufall und Kalkül
Aber worin die Kraft besteht; wie sie sich herbeiführen lässt; wie sie sich von der glücklichen Koinzidenz, die mir beim Schreiben unvermittelt widerfährt, zu einem Kalkül verwandeln lässt, habe ich bisher nicht herausgefunden. Elfriede Jelinek schrieb einmal, dass das, was sie an Texten am meisten beeindrucke, jenes sei, von dem sie nicht verstehe, wie es gemacht wurde. Vielleicht kann man sagen: sich der Vorstellung der Gemachtheit der Sprache überhaupt zu widersetzen, indem man zeigt, dass alles ohnehin schon da war.
Lassen Sie mich noch einmal weniger philosophisch ausholen: Eine der genuinen Besonderheiten an Elfriede Jelineks Sprache ist es, dass sie – man könnte sagen nach sprachkritischer Façon der Wiener Gruppe – Alltagsphrasen, Fernsehslogans, Interviewfetzen, liturgische Formeln, kurzum alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, für ihre Texte verwendet.
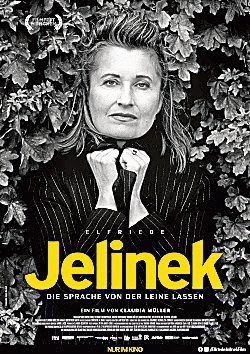
Kunstvolle Collagen
Das allein wäre noch kein Unique Selling Point, sondern ließe sich von postmoderner Montage ebenso behaupten. Elfriede Jelineks Texte sind aber eben nicht bloß collagiert, sondern auf kunstvollste Weise gerade so verformt, dass sie beides nicht sind – nicht ganz künstlich, nicht ganz Alltag. Werke, in denen diese Semidichotomie am stärksten durchscheint sind neben Michael (1972) etwa wir sind lockvögel baby! (1970), aber auch viel spätere Arbeiten wie Bambiland (2003) oder Babel (2005), in der die aus den Schienen geratene Sprache des Kollektivs jeden Versuch des Menschen, sich den Status eines Individuums zu erkämpfen, vernichtet.
Aus meiner Sicht ist dies bis zu einem gewissen Grad allen Jelinekwerken gemein. Nur den Marktmechanismen des Literaturbetriebs wegen, glauben viele Leser*innen, dass der sogenannten erzählenden Prosa, wie der berühmten Klavierspielerin (1983) oder den Liebhaberinnen (1975), eine Sonderposition zukommt.
nur bei dem richtigen mann, da liegt man richtig. der richtige mann ist gleich oder ein wenig oder möglichst viel besser als man selber ist. bei einem mann liegt man schief, wenn er unter dem eigenen niveau liegt. susis niveau ist hoch, wie susi meint.
Don’t shoot the messenger
Für eine Erzählhaltung, in der alle gemeinsam – die Misogynie, ein ganzer Landstrich und seine Bewohner, ein marodes Wertesystem – aktiv mitsprechen, fehlt der Narratologie ein Terminus.
Schon das Beschreiben wird bei Jelinek zu einem aufschlussgebenden Akt, und die Blindheit gegenüber dem, was in den eigenen Äußerungen steckt, erschlägt einen fast. Der vielzitierte Kalauer ist kein Witzchen, sondern todernstes Anspielen auf die Nähe von Normalität und Abgrund in der Sprache. Jede Äußerung, die jemals getätigt wurde, ist so gleichsam Teil von Jelineks Œuvre, denn es ist permeabel gegenüber den Konnotationen und Kehrseiten seiner eigenen Sätze, die sich – man könnte manchmal fast vermuten außerhalb der Kontrolle der Autorin – ergeben. Der Binsenweisheit, dass die Sprache sich unablässig wandelt, weil jedes Benützen die Bedeutungen potenziell verändert; dieser endlosen Rekursion kommt Jelinek zuvor, indem sie keine Trennlinie zwischen die Welt, das vermeintliche Objekt einer Referenz, und die Referenz selbst setzt. Ihre Texte fließen über die Bücher hinaus.
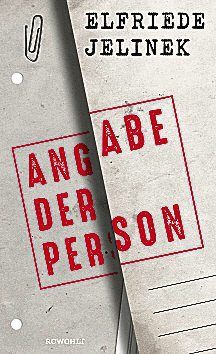
Fledermaus mit Echolot
Eine solche Literatur hat mehr Realitätsanspruch als das Echte selbst, weil sie Kondensat ist, beispielhaft, ideell. Das ist es auch, was sie zuweilen so schwer erträglich macht. Die Vergewaltigungen in Lust sind nicht Einzelinstanzen, sondern tausende Vergewaltigungen, die Gewalt per se. In den Kindern der Toten wird nicht ein partikuläres Verbrechen besungen, sondern die Millionen in der Erde Liegenden, überall, zu allen Zeiten.
Jelinek macht wie eine Fledermaus mit einem Echolot, das, was ohnehin schon Struktur gibt, aus dem Nebel des Gleichzeitigen heraus sichtbar. Sie "erfindet" oder fiktionalisiert nicht. Auch in ihrer Figurengenese wendet sie eine ganz ähnliche Technik an. Die quasimenschlichen Charaktere, die in den meisten anderen Romanen auftreten, sucht man hier vergeblich.
Überbringerin schlechter Nachrichten
Die Frau, der Mann, das Kind: Namenlos und außerhalb ihrer Funktion nicht existent, wird deutlich, dass wir es hier nicht mit Persönlichkeiten zu tun haben. Die fehlgeleitete Annahme, der etwa Marcel Reich-Ranicki anhing, Elfriede Jelinek würde damit einem zutiefst misanthropen, ja fast deterministischen Menschenbild Ausdruck verleihen, ist ein weiteres Missverständnis.
Was etwa in Gier oder in Die Kinder der Toten aufgemacht wird, ist vielmehr ein Mythos, in dem die Muster und Wiederholungen der Geschichte, die Rollen die uns zugewiesen sind, größer sind als der Einzelne. Es geht in diesen Texten um die Urgewalt, die Handlungen bekommen, indem sie nicht von Personen, sondern von archaischen Prinzipien ausgeführt werden. Im Gegensatz zur Misanthropie bedeutet dies jedoch, dass Jelineks Texte nie auf Einzelpersonen zielen, sondern auf Gruppen und Machtgefüge. Dass sie dafür in den 80ern und 90ern mit der Missgunst der Öffentlichkeit zu kämpfen hatte, die gar in einer Plakatkampagne der FPÖ gipfelte ("Lieben Sie Scholten, Jelinek, Häupl, Peymann, Pasterk ... oder Kunst und Kultur?"), ist nur eine von vielen Ungerechtigkeiten. Statt sich gegen die gesellschaftlichen Missstände zu wenden, klagt man die Überbringerin schlechter Nachrichten an.

Literarischer Ethos braucht Raum
Doch es geht hier auch um die Verteidigung eines literarischen Ethos: Bei Jelinek werden nicht einfach Geschichten erzählt, sondern Geschichte – einer, in der wir alle Verantwortung tragen und in der daher nie die Täter als Monstren oder Alleinverantwortliche angeprangert werden.
Doch auch hier hören die Missverständnisse nicht auf. Das Pendant zur Häme gegenüber Jelineks früherer Schaffensphase ist die jetzt hinter vorgehaltener Hand getuschelte Frage, warum die seit den 2000ern verfassten Texte nur so umständlich, so lang, so unzugänglich sein müssten. Textflächen? Theatermonologe? Mühsam!
Abstraktionen
Dass aus jener Tradition kommend jedoch irgendwann die de-personalisierte Textfläche stehen muss, erscheint mir plausibel: Da es nicht um spezifische "Charaktere" geht, kann diesen auch kein "Plot" widerfahren – die Jelinek’schen Konfigurationen sind von Anfang an als Abstraktionen angelegt, und es ist bloß konsequent, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Der Stoff, der beschrieben wird, ist Jelineks neuen Texten nur mehr eine Verhüllung – eine, die, wenn sie fällt, zeigt, dass nichts unter diesem Gewand ist; und das ist eine tiefe Wahrheit.
Zudem – das kann ich jenen versprechen, die sich etwa auf Neid (Online"roman") oder Schwarzwasser (2020) einlassen – besitzen diese Texte genau dieselben Qualitäten wie alle anderen Jelinek-Texte. Witz etwa.Wie man Jelinek nicht für eine der größten Humoristinnen der österreichischen Literatur halten kann, war mir schon immer unbegreiflich. Angesichts des philosophischen Brimboriums, vor dem ich meine Eloge aufgezogen habe, muss ich nochmal an die anfangs beschworene Kraft erinnern – und die unmittelbare, sinnliche Qualität, die ihr innewohnt.
Komik und Tragik
Unablässig finden sich in ihren Texten Perlen. Wie etwa die Verteidigungsrede des Fakir-Heizgeräts, das zur Katastrophe von Kaprun beigetragen hat ("Ich habe selbst schon zwei Stück Fakire in zwei Stück Klo eingebaut, und was habe ich laut und deutlich, sogar unterstrichen, in der Gebrauchsanweisung gelesen: nicht zum Einbau in Fahrzeugen geeignet!"), oder der bizarre Monolog des Bodybuilders Andreas Münzer in Ein Sportstück ("Nichts Schlechtes, Schmutziges essen, das ist überhaupt die Hauptsache. So kam es, daß ich, ein riesenhaftes Kind, den ganzen Arnie in die Tasche stecken wollte und erst im letzten Moment merkte, daß ich gar keine Taschen hatte.").
Warum und wie diese ungeheure Komik noch in den tragischsten Momenten zustande kommt, kann ich ihnen nicht auch noch analysieren. Bei großer Literatur kann man ja, wie Elfriede Jelinek ganz richtig sagte, nie ganz beurteilen, wie sie gemacht wurde. Claudia Müllers Film ist auch deswegen ein so gelungenes Portrait Jelineks, weil es diese Analyse gar nicht versucht, sondern der Autorin zugesteht, selbst von sich zu sprechen. (Raphaela Edelbauer, 6.11.2022)