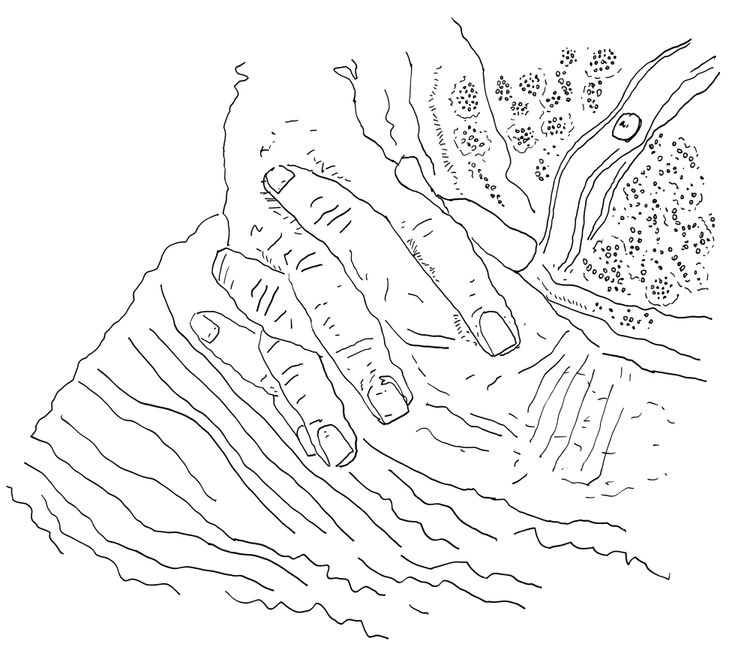
Seinen einst doch ganz guten Ruf hat der Glaube längst verloren. Und das aus gutem Grund. Allzu lange haben allzu viele Hüter der uralten römischen Verträge das schöne Substantiv – Glaube – als ein Verb missverstanden. Und sogleich missbraucht als Imperativ: Glaube! Sowas kann auf Dauer nicht gutgehen. Der Glaube lässt sich, auch wenn er halt irgendwie ins Ritual organisiert werden muss, nicht anschaffen. Was sich erzwingen lässt, sind bloß Glaubensbezeugungen. Aber die sind, wie sich immer und immer wieder erweist, das Gegenteil davon.
"Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub’ ins Fenster. Wenn die Götter ihr verjagt, kommen die Gespenster."
Emanuel Geibel
Die europäische Aufklärung – wenn dieser kurze Schlenker in die Philosophiegeschichte erlaubt ist – rüstete sich mit der doch recht blauäugigen Einschätzung von Immanuel Kant, es ließe sich der "Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit" finden. Kant hat die Fähigkeit der Menschen ziemlich überschätzt. Unterschätzt hat er aber gleichzeitig die Fähigkeit, sich an sich und einander emporzuranken. Zum Glauben an sich: Gott hin, Gott her – wir sind ja, bitt’schön, auch noch wer!
Es entstand ein unseliges Gegensatzpaar: wissen statt glauben. "Wer nichts weiß, muss alles glauben", schrieb die Marie Ebner von Eschenbach ins Stammbuch der – heißt das nicht so? – Fortschrittsgläubigen. Aber erst die Umkehrung ist spannend: Wer nichts glaubt, muss alles wissen. Leicht einzusehen, dass das zwar ein löbliches, aber doch aussichtsloses Unterfangen ist. Der "Baum der Erkenntnis" mag im Paradies gestanden sein. In den Himmel wächst er deswegen noch lange nicht.
Die Aufklärung war denn auch eine recht zweischneidige Entwicklung. Mitten im Weltenbrand des 20. Jahrhunderts redeten sich Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, um Fassung ringend, die "Dialektik der Aufklärung" von der wunden Seele des von Barbarenvernunft desillusionierten Kulturmenschen.
Vor den Fährnissen der Glaubensleere hatte freilich schon der eingangs zitierte Hausgebrauchsdichter Emanuel Geibel im 19. Jahrhundert gewarnt. Die selbstbezügliche Immanenz – das humanozentristische Weltbild – schien auch dem Geheimrat Goethe nicht ganz geheuer. Im Faust II lässt er Mephistopheles den von Fausts Lehrling Wagner erschaffenen Homunculus auf die dann Geibel’sche Welt vorbereiten: "Denn, wo Gespenster Platz genommen, – ist auch der Philosoph willkommen. – Damit man seiner Kunst und Gunst sich freue, – erschafft er gleich ein Dutzend neue."
Nein, weder Geibel noch Goethe haben die postmoderne Beliebigkeit vorausgesehen. Aber fast könnte man es – ‘tschuldigung – glauben.
*
Der Selbstberauschung des Menschen an sich selber ist der Kater gefolgt. Der große, verbindende Glaube, eine Art Grundkonsens des Daseins, ist gleichwohl nicht zurückgekehrt. Nur eben seine Gespenster. Da eines, dort eines.
Jeder glaubt für sich und seine Partie. In den nunmehrigen Krisenjahren, da selbst das europäische Credo – "Ich glaube an Frieden in Freiheit und Wohlstand" – wankt, hat das beinahe gefährliche Ausmaße erreicht. Man spricht von tiefer Spaltung. Für die sei verantwortlich der jeweils andere, dem man zunehmend alles zuzutrauen bereit ist. Nicht nur die verfreundeten Mitgliedsstaaten machen das. Staatsgläubige Impfapologeten rempeln gegen Schwurbler und die zurück; Europagläubige versus Neonationalisten; Islamophobe versus Willkommensklatscher; Klimasünder versus Gretagläubige. Oft übersehen wir gerne, wie tief religiös, wie glaubenseifernd die modernen Debatten geworden sind. Das ist mehr als bloßes Meinen.
Zur Basis dieser Glaubensgespenster zählt auch – oder vielleicht vor allem – die Unterstellung. So ist der kleinliche Hader zurückgekehrt in die ohnehin krisengebeutelte Welt; ein vergifteter Streit um des Kaisers Bart. Bereitwillig vermutet man im je anderen die schlechtesten Absichten. Böswillig versteht man zielgerichtet miss. Ein jeder bringt sich vorsorglich in Stellung. Sowas schafft keine vernunftgeleitete Auseinandersetzung. Dazu muss einer schon ganz fest glauben.
Die Geibel’schen Gespenster nehmen aber nicht nur Platz. Sie spielen Reise nach Jerusalem; immer weniger Plätze sollen es sein. Das ist die Crux des Glaubenseifers: dass er sich so exklusiv plustert. Es gilt, nicht nur selber etwas (oder jemanden) für wahr zu halten, sondern dieses Fürwahrhalten anderen um die Ohren zu hauen. Der Glaube ist nie bloß Privatsache.
Wissenschaftsgläubige und Klangschalenesoteriker, Querdenker oder Queerdenker – wo zwei oder drei in solchen Namen zusammenkommen, ist die erste Tat die Gründung einer Glaubenskongregation mit ihrem unantastbaren Heiligen Officium. Und schon beginnt die inquisitorische Suche nach Ungläubigen, Zweiflern, Abtrünnigen. Die gilt es, weil man sie ja – noch – nicht dingfest machen kann, jedenfalls namhaft zu machen.
So, nur zum Beispiel, funktioniert Twitter. Jede Blase hat ihr Credo. Und jedes Credo sein credo quia absurdum. Nur zwei biologische Geschlechter gebe es, sagt sie? Kreuzigt sie!
*
Ganz ohne das Glauben geht es sowieso nicht. Jedenfalls dort, wo das Wissen an seine natürlichen Grenzen stößt. Im ganz Großen zum Beispiel ans Rätsel des Urknalls (den übrigens ein Priester, der Belgier Georges Lemaître, in den 1920er-Jahren erstmals in Raum und Zeit gestellt hat). Im Kleinlichen an jedes Wahlversprechen. Auch das muss ja geglaubt werden. Dass die Wahlwerber es immer weniger schaffen, ihre Versprechen glaub-würdig zu machen, hat jenen säkularen Glaubensverlust ans mühsame demokratische Procedere zur Folge, der seinerseits wieder eine Reihe von Gespenstern schafft. Man kennt sie unterm Sammelbegriff Populist.
Populismus: Ein Wort ist das freilich auch wie eine Keule. Gespenster argumentieren nicht. Höchstens im Inneren der von ihnen aufgestellten Glaubensschranken. Innerhalb so einer Beschränkung kann es dann zum Beispiel auch sehr sinnvoll erscheinen, nur noch selbstbestätigend – um nicht zu sagen: selbstbefriedigend – zu reden. Denn mit dem Teufel spricht man nicht. Das wäre false balance. Wen der Glaube dazu verführt, sich für unfehlbar zu halten, wird verkniffen und unleidlich; ein besserwisserischer Grantscherm, ein dominikanischer. Hunde Gottes nannte man die einst, die domini canes. Wer auf diese Weise glaubt, kann sich ebenso gut mit dem Hammer auf den Daumen schlagen. Das togatzt dann auch.
*
Jetzt aber ist einmal Weihnachten. Und dieses Fest funktioniert – erstaunlicherweise oder nicht erstaunlicherweise – immer noch, übers Ende des alten Christglaubens hinaus, in dessen Geschichten das Fest ja fußt. An den verheißenen Frieden wird man, gerade heuer, wohl oder übel glauben müssen. Evident ist er jedenfalls nicht. Man muss ja nicht gleich beten um ihn, das wär’ eh bloß magisches Wünschen. Aber hoffen darf man schon. Und was wäre die Hoffnung ohne das Glauben daran?
Das Lateinische kennt zwei Wörter fürs Glauben. Das Substantiv, fides, ist eng verknotet mit der Treue. Das Zeitwort ist credere, das hat mit dem Herzen zu tun. Einer glaubt, wenn er jemandem das Herz gibt; cor dare. Unter Umständen auch das Börserl: credit heißt, er oder sie glaubt.
Oder es: Weihnachten ist ein Fest, das in der Hauptsache den Kindern gilt. Und die sind tatsächlich auf Treu und Glauben angewiesen. Das Vertrauen – auch das ein Licht im Bedeutungsschein des Wortes Glaube – ist ihr Lebenserhaltungssystem. Diese Einsicht bedarf keiner Gottes-, nur einer Kindsgewissheit.
*
Weihnachten ist’s. Und das bis übers Jahr, bis Heiligdreikönig. Es ist die Zeit, da die Welt für gewöhnlich Pause macht für 14 Tage. Auch in entgötterten, gespensterprallen Zeiten sind das geheiligte Tage. In den Weihnachtstagen braucht auch niemand die Nase zu rümpfen aus lauter Angst vorm Kitsch. Draußen ist es kalt. Schmalzig und zuckersüß – das ist eine gute Grundlage, sich warm zu halten.
Und dann noch – weil’s eh schon wurscht ist: Glaub’s einfach – ein überraschender, blitzschneller Blick aus den Augenwinkeln. So haben wir uns als Kinder die leisen Zweifel am Christkind weggespeanzelt. Denn: Da war doch was!
Als Vater war’s dann nicht viel anders. Ein schneller Seitenblick. Die großen, glühenden, strahlenden Augen. Jedes Kind ist doch auch – oder vor allem – ein Christkind. Es bringt, wenn man ganz fest an es glaubt, reichlich Geschenke. Dazu bedarf es neben dem Glauben nur noch zweier weiterer Dinge. Aber an dieser Stelle den 13. Vers aus dem 13. Kapitel des 1. Paulusbriefes an die Korinther zu zitieren wäre dann doch ein wenig zu viel des Kitsches. Das sollte ein jeder und eine jede bei Gelegenheit selber nachblättern. Frohe Weihnachten, alle miteinander. (Wolfgang Weisgram, 21.12.2022)