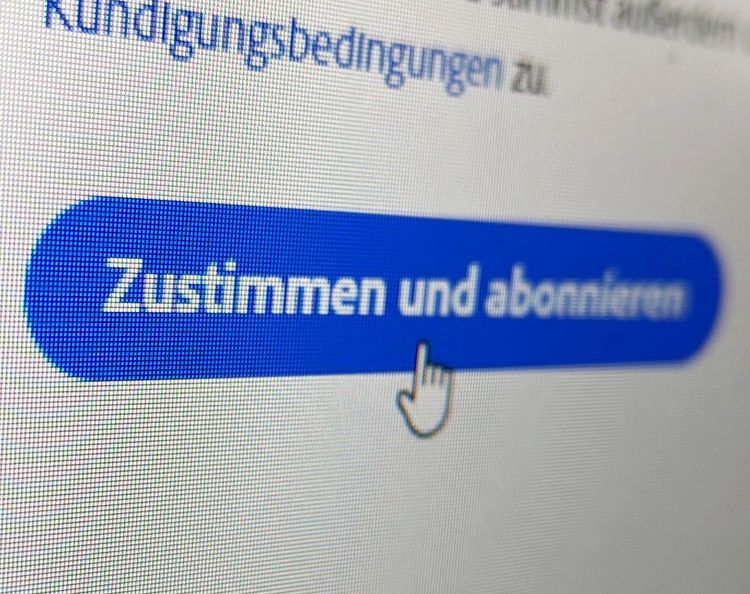
Vieles lässt sich nicht mehr dauerhauft kaufen, sondern muss abonniert werden. Prominentes "Opfer" dieser Monetarisierungsstrategie: die Kreativsoftware von Adobe.
Es gibt kaum noch eine digitale Dienstleistung, die nicht als Handy-App oder auf einer Webseite angeboten wird. Und das ist auch gut so, denn es bedeutet, dass man von Musik-Remastering über Bildgenerierung mit künstlicher Intelligenz bis zu 3D-Modelling nunmehr Dinge am Handy und im Browser erledigen kann, für die sonst ein halbwegs leistungsstarker PC oder Laptop Voraussetzung wäre.
Allerdings gibt es einen Haken, der mir, anderen Internetnutzern und auch Verbraucherschützern aufstößt – und zwar immer fragwürdigere Abo-Maschen. Ich finde mich ungern im Chor der "Früher war alles besser"-Schreier ein, stelle mir aber durchaus die Frage, ob die gute, alte Einmalzahlung nicht langsam vom Aussterben bedroht ist.
Abo statt Einmalkauf
Einige Anbieter setzen auf gemeine Taktiken, um den User dazu zu drängen, ein Monatsabo abzuschließen, auf dessen fristgerechte Kündigung dann idealerweise erst einmal vergessen wird. Man lockt mit einer kostenlosen Probe, lässt den Nutzer ein Modell kreieren, einen Song remastern oder anderweitig ein Ergebnis mit dem angebotenen Dienst erzielen.
Aber wehe, wenn das fertige Werk dann zwecks Verwendung heruntergeladen werden soll. Dann soll man doch bitteschön Abo-Kunde werden. Je länger man sich verpflichtet, desto günstiger wird es natürlich pro Monat. Und das mit teils absurder Preisgestaltung, bei der die Einmonatsvariante beinahe so viel kostet wie ein Halbjahresabo. Die Möglichkeit, das eigene Werk gegen einen fairen Einmalbetrag aus seinem Gefängnis zu befreien, fehlt oft gänzlich.
Leider ist der Status quo eine logische Folge des schon länger anhaltenden Trends, alle erdenklichen Produkte als "Service" anzubieten. Was für die Nutzung von Onlinefunktionen oder Streamingservices durchaus Sinn ergeben kann, ist an anderer Stelle nichts anderes als Umsatzsteigerung ohne Mehrwert. Insbesondere wenn es Software betrifft, die man zuvor noch "normal" kaufen konnte (looking at you, Adobe).
Zeit für mehr Transparenz
Das ist zwar fragwürdig, aber natürlich steht es den Firmen frei, ihre Services nach eigenem Ermessen zu monetarisieren. Die Abo-Pest wäre auch nur halb so nervig, wenn neben dem in fetten Lettern ausgeschilderten "kostenlosen" Test gut erkennbar darauf hingewiesen würde, welchen Umfang dieser hat. Stattdessen wird gerne suggeriert, dass man alle Features ausprobieren kann, und die Information zu den Einschränkungen – wenn überhaupt – im "Kleingedruckten" versteckt. Die App-Stores sind mit ihren Richtlinien dabei keine allzu große Hilfe. Hier muss lediglich darauf hingewiesen werden, dass Mikrotransaktionen angeboten werden. Die Aussagekraft dieses Hinweises bewegt sich nahe null, weil ohnehin die große Mehrheit der Apps gratis installiert werden kann und sich mit In-App-Käufen finanziert.
Es wäre für Google, Microsoft und Apple an der Zeit, hier die Zügel anzuziehen und für mehr Transparenz im Sinne ihrer Nutzer zu sorgen. Vielleicht bewegt ja das den einen oder anderen Hersteller zum Umdenken. (Georg Pichler, 12.1.2023)