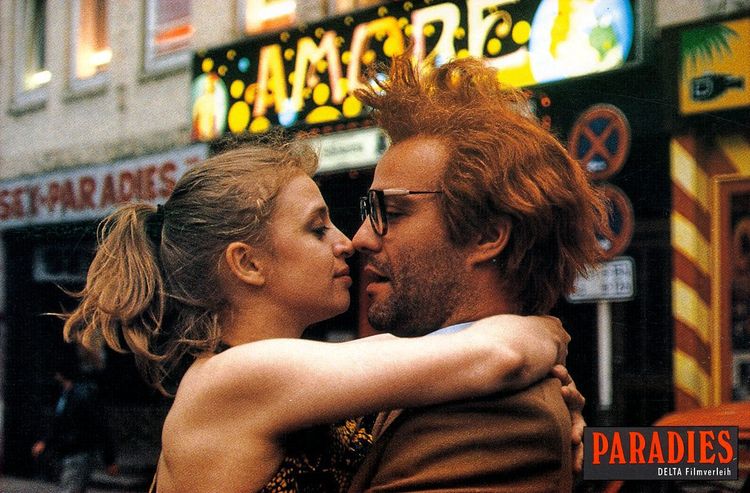Es ist der Tag nach den Oscars. Doris Dörrie nimmt sich Zeit für ein Gespräch mit einem Österreicher in Berlin – Anlass ist ihre Retrospektive im Filmarchiv Austria. Den Vorschlag eines Zoom-Meetings lässt sie elegant ins Leere laufen. "Könnten wir nicht einfach auf die gute, alte Weise telefonieren?" So unkompliziert erweist sie sich dann auch mit ihren Antworten. Man spürt, dass es ihr gutgeht.
STANDARD: Ihre Filme werden nun in Wien gezeigt. Haben Sie eine spontane Assoziation zu Österreich?
Dörrie: Oh, sehr viele. Schinkenfleckerln, Landschaft, Valie Export, Elfriede Jelinek, Marillenknödel, Maria Lassnig, Axel Corti, Kürbiskernöl, Josef Hader, Adrian Goiginger, Ursula Strauss, leiwand ...
STANDARD: Wenn man Ihr Werk betrachtet: Was ist darin stärker, das Komische oder das Tragische?
Dörrie: Ich habe eigentlich relativ wenige Komödien gemacht. Mein Interesse war immer, Schweres leicht zu machen und nicht noch schwerer. Tragödie kann jeder.
STANDARD: Das Leben ist leider oft ein ziemlicher Experte für Tragödien. Kann man da etwas dagegenhalten?
Dörrie: Es ist eine sportliche Übung, im Tragischen das Komische zu sehen. Diese Übung hält mich am Leben. Ich betrachte es durchaus als meinen Auftrag, das zu erzählen. Immer wieder zu schauen: Wo offenbart sich eine Komik einer eigentlich tragischen Situation? Kirschblüten & Dämonen, Glück, Keiner liebt mich – da gibt es viele Filme, in denen ich das versucht habe.
STANDARD: Sie schauen auch auf andere Kulturen, in Japan oder in Mexiko. Ist das Komische überall gleich?
Dörrie: Ja und nein. Ich war erstaunt, wie gut sich viele komische Filme in andere Kulturen übersetzt haben. Männer war einer der ersten Filme aus dem Ausland, die in China gelaufen sind. Ich bin damit quer durch das Land gereist, und die Leute haben sich kaputtgelacht. Ich habe nicht verstanden, worüber eigentlich, weil so vieles ihnen doch gar nicht bekannt sein konnte.
STANDARD: Mit "Männer" wurden Sie 1985 berühmt. Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht ...
Dörrie: Für mich war es ein politischer Film. Ich habe mit "diesen Männern" ja auch zusammengewohnt. Da gab es die einen, die sich sehr stromlinienförmig dem Turbokapitalismus angeglichen haben, und dann die linken Dogmatiker. Die begannen aber auch mit den Errungenschaften des Kapitalismus zu flirten. Ich konnte beobachten, wie sie sich heimlich Seidenhemden gekauft haben, die sie dann nur trugen, wenn kein Genosse in der Nähe war. Diesen Ausverkauf der Ideale von 1968, für die ich zu jung war, das fand ich sehr lustig.
STANDARD: Wie konnten Sie sich damals durchsetzen? Die Filmbranche war noch eine Männerbastion.
Dörrie: Das hatte mit Amerika zu tun. Ich bin mit siebzehn Jahren dorthin und musste sehr schnell eine andere Sprache lernen, aber auch einen bestimmten Humor, diesen Willen zu unterhalten. Ein Culture-Clash.
STANDARD: Einer Ihrer Filme heißt "Glück". Ist das ein Leitthema?
Dörrie: Die Beschäftigung mit dem Glück ist eine historische Ausnahme. Es ist selten, dass Menschen die Muße haben, über das Glück nachzudenken, wie das in einem Land wie Deutschland eine Weile normal schien. Es scheint ja auch hier gerade wieder aufzuhören.
STANDARD: Wegen des Kriegs?
Dörrie: Ich habe immer mehr das Gefühl, dass diese Zeit des Friedens, in der ich aufgewachsen bin, und diese Möglichkeit, sich Dinge für sein Leben vorzustellen und zu verwirklichen, besonders als Frau, dass das vielleicht nur eine kurze Öffnung war. Dieses Fenster schließt sich gerade dramatisch.
STANDARD: Was halten Sie von dem Friedensappell, den einige hunderttausend Menschen in Deutschland unterstützen?
Dörrie: Diese Aufrufe von Alice Schwarzer und Frau Wagenknecht finde ich entsetzlich, weil da mitschwingt, dass man sich überhaupt nicht in die Lage derer versetzt, denen gerade alles um die Ohren fliegt. Alle Ukrainer:innen werden sich nach nichts mehr sehnen als nach Frieden, na logisch. Aber was da mitschwingt, ist immer nur die Sorge, dass wir in Deutschland in eine Kriegssituation geraten, das ist im höchsten Maß egozentrisch.
STANDARD: Haben Sie da gegendert?
Dörrie: Ich gendere, wann immer ich kann. Ich tue es deshalb, weil es ein Denkanstoß ist und weil es sich darüber nachzudenken lohnt. Das mit dem Sternchen oder dem Doppelpunkt ist noch nicht besonders schön. Ich glaube, dass es sprachlich dafür noch einmal eine andere Lösung geben wird eines Tages.
STANDARD: Zuletzt haben Sie mit "Freibad" eine Komödie über die modernen Kulturkämpfe gemacht.
Dörrie: Freibad ist gut gelaufen. Es war schon klar, Männer werden in diesen Film nicht gehen, und es wird im Arthouse-Bereich bleiben. Ich habe den Film absichtlich mit zwei Frauen geschrieben, einer sehr jungen und einer mit einem migrantischen Background. Es sollte multiperspektivisch sein, nicht nur aus meiner Sicht. Bauchschmerzen sollte man bekommen, wenn man über andere Gruppen schreibt, ohne da intimere Kenntnisse zu haben oder sie miteinzubeziehen. Die Vorstellung von gerechter Teilhabe vertrete ich schon sehr.
STANDARD: Sie glauben wohl doch an das Gute im Menschen?
Dörrie: Ich muss immer an meine Familie denken, wir waren viele Geschwister, ein großer Tisch, und es wurde sich immer gekloppt um den Kuchen. Diese Situation haben wir gerade, dass viele Leute endlich mit am Tisch sitzen und nicht in einer Ecke abgespeist werden. Lange Zeit hat die Mehrheitsgesellschaft gesagt: Das ist unser Kuchen. Diese Diskussion müssen wir aushalten. Ich habe Vergnügen an der Gelegenheit zur Selbstreflexion. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die unbewusst danebengehen, weil wir als weiße Mehrheitsgesellschaft oft nicht nachdenken. (Bert Rebhandl, 20.3.2023)