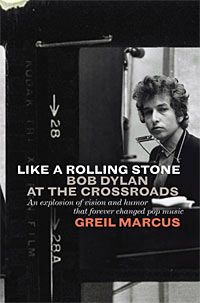
STANDARD: Ihr Buch über "Like a Rolling Stone" heißt im amerikanischen Untertitel "Bob Dylan at the Crossroads" (Verlag: Kiepenheuer & Witsch). Welche Kreuzungen sind damit gemeint?
Marcus: Ich hätte gern einen anderen Titel genommen. Aber kein Verleger mochte meinen Titel "In the Air". So heißt das Kapitel, in dem es darum geht, wie der Song das wird, was er ist. Der Song steigt in die Luft, bleibt dort. Er kommt nie wieder herunter – er ist irgendwo, wo ihn der letzte Schwall aus der Harmonika hintreibt. "Bob Dylan at the Crossroads" war der Vorschlag eines Freunds.
STANDARD: Die Kreuzung betrifft einerseits Dylan, der Folk hinter sich lässt und Rock ’n’ Roll spielt. Andererseits geht es um die USA, die 1965 "vielleicht zum letzten Mal" die Chance einer fundamentalen Veränderung zum Besseren hatten.
Marcus: Das ist ein Zitat aus einem Brief von meinem Freund Michael Pisaro. In diesem Buch möchte ich Dinge geschehen lassen, ich möchte sie nicht selbst erklären. Ich möchte, dass andere Stimmen ihre Erklärungen bringen. 1965 ist ein paradoxes Jahr, in dem zwei Dinge passieren: Kennedy ist nicht viel mehr als ein Jahr davor ermordet worden. Das Land ist unter Schock. Niemand vertraut auf etwas. Diese Energie, diese Ungewissheit gehen in die Popmusik, die sich gerade von ihrem eigenen Schock erholt – dem Auftreten der Beatles. Alles klingt nun anders, alles klingt neu, alles ist wunderbar erfindungsreich.
1965 ist noch unklar, was in Vietnam geschieht. Das Civil Rights Movement verändert sich – das Land meint zu verstehen, was das "negro problem" ist. Und dann geschehen die Watts Riots in Los Angeles. Das alles steuert auf 1968 hin. Man denkt, in heroischen Zeiten zu leben.
STANDARD: Die Zeiten sind aber auch ein Rätsel, das seiner Lösung harrt, schreiben Sie. Was macht Dylan?
Marcus: Mit "Like a Rolling Stone" zeichnet Bob Dylan eine Linie in den Sand – die Metapher kommt aus dem Alamo –, eine Linie, die eine Wahl bezeichnet: Hier ist eine sechsminütige Single mit einem gloriosen Sound, der dich durch diese Story trägt, die über das Ende hinaus offen bleibt. Das ist nun möglich in der Popmusik. Hast du die Nerven, den Willen, zu folgen? Das gilt auch für Dylan selbst. Er hat jetzt etwas getan, das ihm nicht mehr erlaubt, dahinter zurückzugehen, und dem er vielleicht aber nie mehr etwas Ebenbürtiges folgen lassen kann.
STANDARD: Sie bezeichnen das, was "Like a Rolling Stone" schafft, als "totalen Sound".
Marcus: Ich glaube wirklich, dass Rock ’n’ Roll wie Blues und Jazz, aber anders als Swing, Country oder Crooning eine Kunstbewegung ist. Diese Form ist hier, um Dinge zu verändern, vor allem aber, um den totalen Sound zu finden – ihn zu entdecken, darin verloren zu gehen. The Drifters kamen 1953 mit "Money Honey" sehr nahe, aber das ist nur ein Beispiel. Bei "Like a Rolling Stone" entsteht totaler Sound aus ungewissen Umständen bei der Aufnahme, aus seiner Länge, aus den Bildern, aus seiner Kontingenz, seinem Zweifel, aus der Tatsache, dass am Anfang noch nicht feststeht, was das Ende sein wird.
STANDARD: Der Filmkritikerin Pauline Kael haben Sie das Buch "Invisible Republic" gewidmet. In Ihrer Monografie über "The Manchurian Candidate" haben Sie sie zitiert: "Wir nehmen unsere Geschichten nicht mehr ernst."
Marcus: Sie meinte: Wir können nichts mehr ohne Ironie wahrnehmen, ohne uns unserer Überlegenheit darüber zu versichern. Mein Schreiben ist sicher ein Versuch, das Gegenteil zu erreichen.
STANDARD: Ihr Begriff gegen die Ironie ist "das Prophetische in der amerikanischen Stimme". In Europa werden die USA als ein Land mit vielen falschen Propheten wahrgenommen.
Marcus: Das Land ist gespalten. Die religiöse Rechte ist stärker, hat engagiertere Anhänger, bessere Organisationen, versetzt die Medien in Angst. Sie tun so, als hätte eine kleine Schar teilnahmsloser Beatniks für John Kerry gestimmt und nicht das halbe Land.
STANDARD: Seit den späten 90ern gibt es eine Selbstkritik der US-Linken, weil sie sich zu sehr in Identitätspolitik von Minderheiten verstrickt hat, statt eine gemeinsame Basis zu suchen. Schreiben Sie dagegen an?
Marcus: Absolut, und ganz bewusst. Für mich ist Amerika keine "Fiktion", keine "Konstruktion", sondern ein Raum.
STANDARD: In "Mystery Train" erzählten Sie die US-Musikgeschichte als Abfolge von Ahnherrn und Erben. Steht Dylan über diesen Kategorien?
Marcus: Es ist ein Teil der Faszination für Dylan. Er ist sein eigener Vorfahre und sein eigener Erbe geworden. Was mich an "Chronicles" so begeistert, ist, dass es ein literarisches Werk wurde. Man versteht den Unterschied, der zwischen Wörtern besteht. Es ist "geschrieben" in einem literarischen Sinn. Als John Hammond ihm 1961 Aufnahmen von Robert Johnson gab, geschieht etwas mit ihm. Er begreift, dass er etwas in dieser Art noch nicht gehört hat.